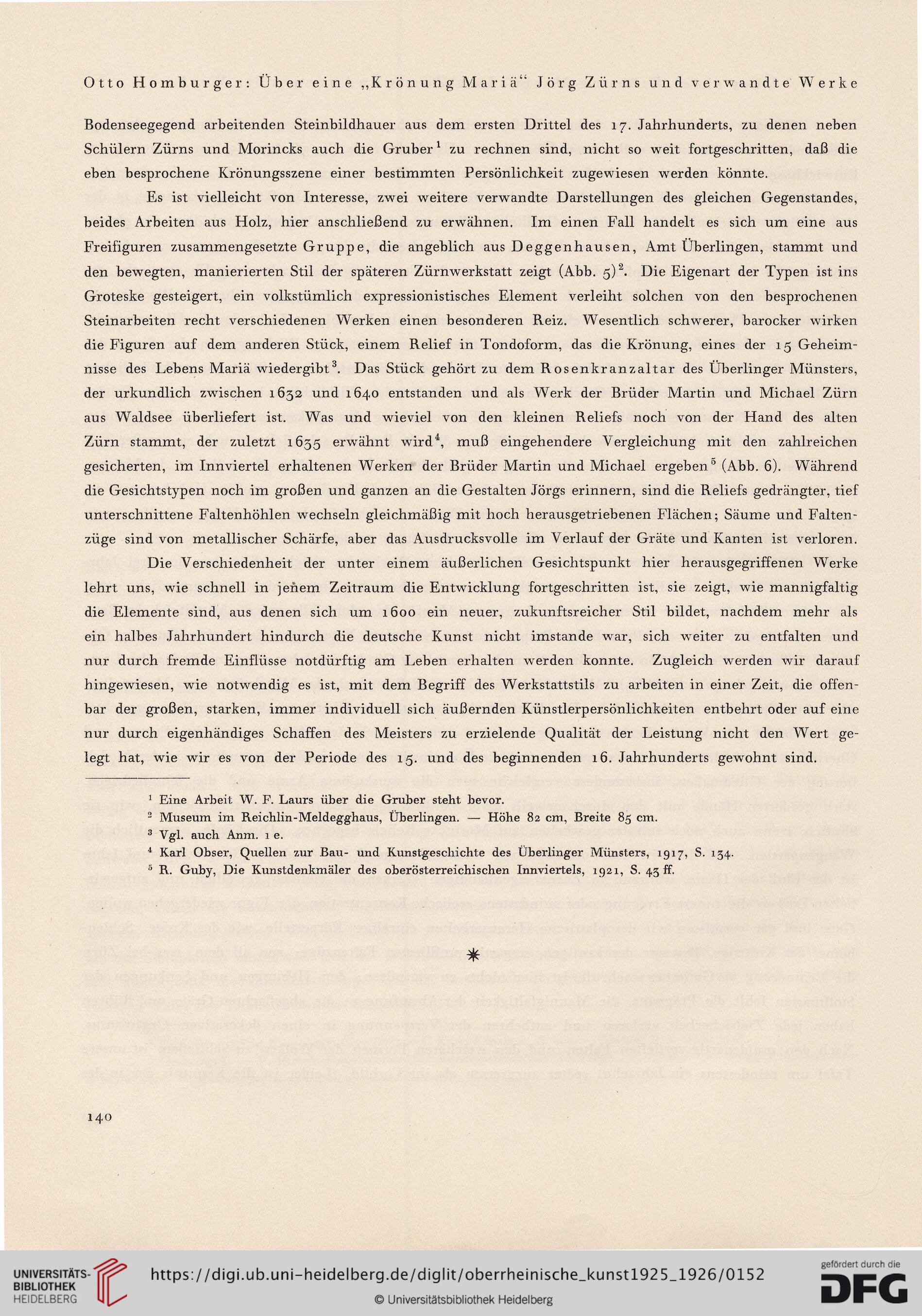Otto Homburger: Uber eine „Krönung Mariä“ Jörg Zürns und verwandte Werke
Bodenseegegend arbeitenden Steinbildhauer aus dem ersten Drittel des 17. Jahrhunderts, zu denen neben
Schülern Zürns und Morincks auch die Gruber1 zu rechnen sind, nicht so weit fortgeschritten, daß die
eben besprochene Krönungsszene einer bestimmten Persönlichkeit zugewiesen werden könnte.
Es ist vielleicht von Interesse, zwei weitere verwandte Darstellungen des gleichen Gegenstandes,
beides Arbeiten aus Holz, hier anschließend zu erwähnen. Im einen Fall handelt es sich um eine aus
Freifiguren zusammengesetzte Gruppe, die angeblich aus Deggenhausen, Amt Überlingen, stammt und
den bewegten, manierierten Stil der späteren Zürnwerkstatt zeigt (Abb. g)2. Die Eigenart der Typen ist ins
Groteske gesteigert, ein volkstümlich expressionistisches Element verleiht solchen von den besprochenen
Steinarbeiten recht verschiedenen Werken einen besonderen Reiz. Wesentlich schwerer, barocker wirken
die Figuren auf dem anderen Stück, einem Relief in Tondoform, das die Krönung, eines der 15 Geheim-
nisse des Lebens Mariä wiedergibt3. Das Stück gehört zu dem Rosenkranzaltar des Überlinger Münsters,
der urkundlich zwischen 1652 und 1640 entstanden und als Werk der Brüder Martin und Michael Zürn
aus Waldsee überliefert ist. Was und wieviel von den kleinen Reliefs noch von der Hand des alten
Zürn stammt, der zuletzt 1635 erwähnt wird4 5, muß eingehendere Vergleichung mit den zahlreichen
gesicherten, im Innviertel erhaltenen Werken der Brüder Martin und Michael ergeben0 (Abb. 6). Während
die Gesichtstypen noch im großen und ganzen an die Gestalten Jörgs erinnern, sind die Reliefs gedrängter, tief
unterschnittene Faltenhöhlen wechseln gleichmäßig mit hoch herausgetriebenen Flächen; Säume und Falten-
züge sind von metallischer Schärfe, aber das Ausdrucksvolle im Verlauf der Gräte und Kanten ist verloren.
Die Verschiedenheit der unter einem äußerlichen Gesichtspunkt hier herausgegriffenen Werke
lehrt uns, wie schnell in jenem Zeitraum die Entwicklung fortgeschritten ist, sie zeigt, wie mannigfaltig
die Elemente sind, aus denen sich um 1600 ein neuer, zukunftsreicher Stil bildet, nachdem mehr als
ein halbes Jahrhundert hindurch die deutsche Kunst nicht imstande war, sich weiter zu entfalten und
nur durch fremde Einflüsse notdürftig am Leben erhalten werden konnte. Zugleich werden wir darauf
hingewiesen, wie notwendig es ist, mit dem Begriff des Werkstattstils zu arbeiten in einer Zeit, die offen-
bar der großen, starken, immer individuell sich äußernden Künstlerpersönlichkeiten entbehrt oder auf eine
nur durch eigenhändiges Schaffen des Meisters zu erzielende Qualität der Leistung nicht den Wert ge-
legt hat, wie wir es von der Periode des 15. und des beginnenden 16. Jahrhunderts gew-ohnt sind.
1 Eine Arbeit W. F. Laurs über die Gruber steht bevor.
2 Museum im Reichlin-Meldegghaus, Überlingen. — Höhe 82 cm, Breite 85 cm.
3 Vgl. auch Anm. 1 e.
4 Karl Obser, Quellen zur Bau- und Kunstgeschichte des Überlinger Münsters, 1917, S. 154.
5 R. Guby, Die Kunstdenkmäler des oberösterreichischen Innviertels, 1921, S. 43 ff.
*
140
Bodenseegegend arbeitenden Steinbildhauer aus dem ersten Drittel des 17. Jahrhunderts, zu denen neben
Schülern Zürns und Morincks auch die Gruber1 zu rechnen sind, nicht so weit fortgeschritten, daß die
eben besprochene Krönungsszene einer bestimmten Persönlichkeit zugewiesen werden könnte.
Es ist vielleicht von Interesse, zwei weitere verwandte Darstellungen des gleichen Gegenstandes,
beides Arbeiten aus Holz, hier anschließend zu erwähnen. Im einen Fall handelt es sich um eine aus
Freifiguren zusammengesetzte Gruppe, die angeblich aus Deggenhausen, Amt Überlingen, stammt und
den bewegten, manierierten Stil der späteren Zürnwerkstatt zeigt (Abb. g)2. Die Eigenart der Typen ist ins
Groteske gesteigert, ein volkstümlich expressionistisches Element verleiht solchen von den besprochenen
Steinarbeiten recht verschiedenen Werken einen besonderen Reiz. Wesentlich schwerer, barocker wirken
die Figuren auf dem anderen Stück, einem Relief in Tondoform, das die Krönung, eines der 15 Geheim-
nisse des Lebens Mariä wiedergibt3. Das Stück gehört zu dem Rosenkranzaltar des Überlinger Münsters,
der urkundlich zwischen 1652 und 1640 entstanden und als Werk der Brüder Martin und Michael Zürn
aus Waldsee überliefert ist. Was und wieviel von den kleinen Reliefs noch von der Hand des alten
Zürn stammt, der zuletzt 1635 erwähnt wird4 5, muß eingehendere Vergleichung mit den zahlreichen
gesicherten, im Innviertel erhaltenen Werken der Brüder Martin und Michael ergeben0 (Abb. 6). Während
die Gesichtstypen noch im großen und ganzen an die Gestalten Jörgs erinnern, sind die Reliefs gedrängter, tief
unterschnittene Faltenhöhlen wechseln gleichmäßig mit hoch herausgetriebenen Flächen; Säume und Falten-
züge sind von metallischer Schärfe, aber das Ausdrucksvolle im Verlauf der Gräte und Kanten ist verloren.
Die Verschiedenheit der unter einem äußerlichen Gesichtspunkt hier herausgegriffenen Werke
lehrt uns, wie schnell in jenem Zeitraum die Entwicklung fortgeschritten ist, sie zeigt, wie mannigfaltig
die Elemente sind, aus denen sich um 1600 ein neuer, zukunftsreicher Stil bildet, nachdem mehr als
ein halbes Jahrhundert hindurch die deutsche Kunst nicht imstande war, sich weiter zu entfalten und
nur durch fremde Einflüsse notdürftig am Leben erhalten werden konnte. Zugleich werden wir darauf
hingewiesen, wie notwendig es ist, mit dem Begriff des Werkstattstils zu arbeiten in einer Zeit, die offen-
bar der großen, starken, immer individuell sich äußernden Künstlerpersönlichkeiten entbehrt oder auf eine
nur durch eigenhändiges Schaffen des Meisters zu erzielende Qualität der Leistung nicht den Wert ge-
legt hat, wie wir es von der Periode des 15. und des beginnenden 16. Jahrhunderts gew-ohnt sind.
1 Eine Arbeit W. F. Laurs über die Gruber steht bevor.
2 Museum im Reichlin-Meldegghaus, Überlingen. — Höhe 82 cm, Breite 85 cm.
3 Vgl. auch Anm. 1 e.
4 Karl Obser, Quellen zur Bau- und Kunstgeschichte des Überlinger Münsters, 1917, S. 154.
5 R. Guby, Die Kunstdenkmäler des oberösterreichischen Innviertels, 1921, S. 43 ff.
*
140