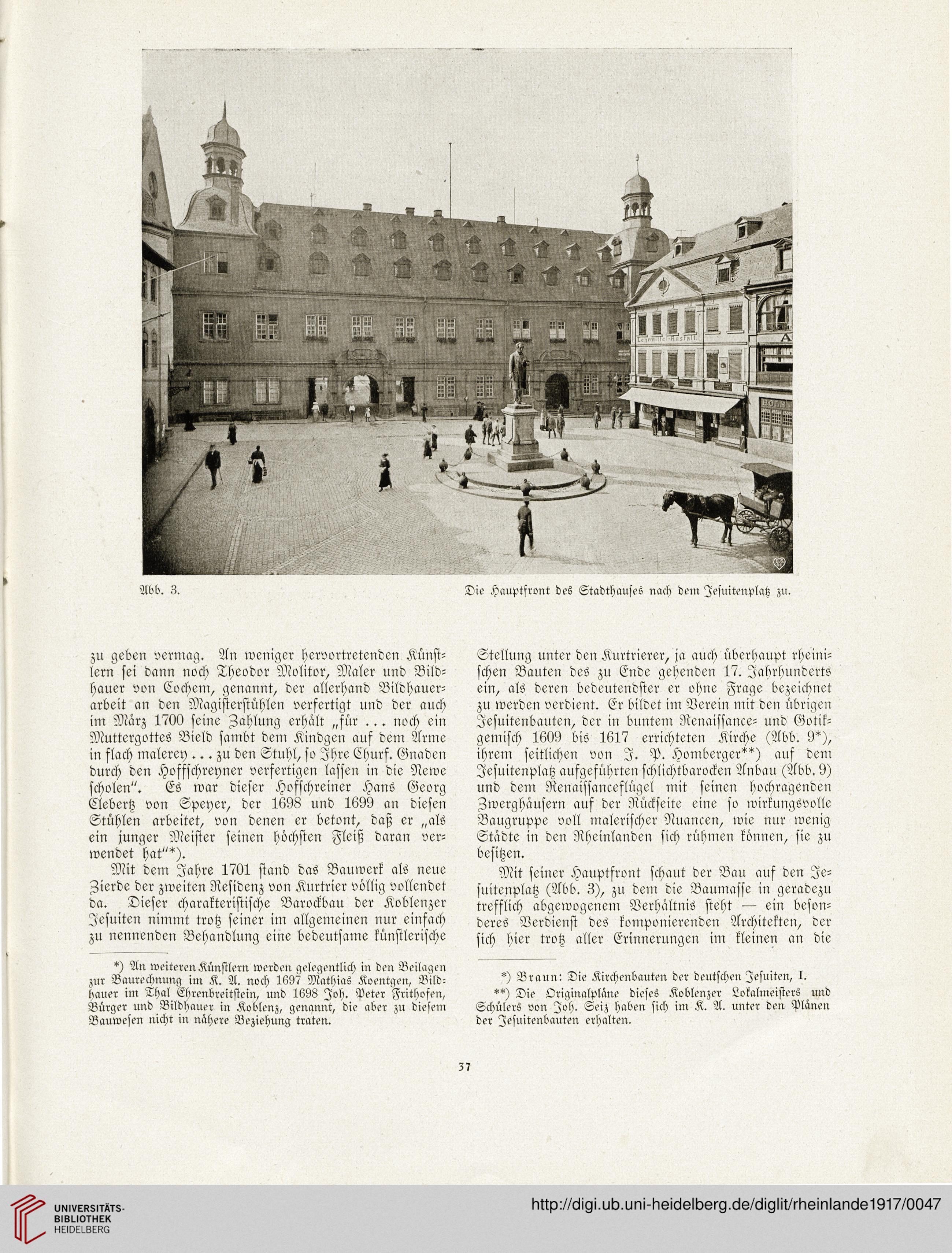Abb. 3.
Die Hauptfront des Stadthauses nach dem Jesuitenplah zu.
zu geben verniag. An weniger hervortretenden Künst-
lern sei dann noch Theodor Molitor, Maler und Bild-
hauer von Cocheni, genannt, der allerhand Bildhauer-
arbeit an den Magisterstühlen verfertigt und der auch
ini März 1700 seine Iahlung erhalt „für ... noch ein
Muttergottes Bield sambt dem Kindgen auf dem Arme
in flach malerey ... zu den Stuhl, so Jhre Churf. Gnadcn
durch den Hoffschreyner verfertigen lassen in die Newe
scholen". Es war dieser Hofschreiner Hans Georg
Clebertz von Speyer, der 1698 und 1699 an diesen
Stühlen arbeitet, von denen er betont, daß er „als
ein junger Meister seinen höchsten Fleiß daran ver-
wendet hat"*).
Mit dem Jahre 1701 stand das Bauwerk als neue
Aierde der zweiten Residenz von Kurtrier völlig vollendet
da. Dieser charakteristische Barockbau der Koblenzer
Jesuiten nimmt trotz seiner im allgemeinen nur einfach
zu nennenden Behandlung eine bedeutsame künstlerische
*) An weiterenKünstlern werden gclcgentlich in den Beilagen
zur Baurechnung im K. A. noch 1697 Mathias Koentgen, Bild-
hauer im Thal Ehrenbreitstein, und 1698 Joh. Peter Frithofen,
Bürger und Bildhauer in Koblenz, genannt, die aber zu diesem
Bauwesen nicht in nähere Beziehung traten.
Stellung unter den Kurtrierer, ja auch überhaupt rheini-
schen Bauten des zu Ende gehenden 17. JahrhundertS
ein, als deren bedeutendster er ohne Frage bezeichnet
zu werden verdient. Er bildet im Verein mit den übrigen
Jesuitenbauten, der in buntem Renaissance- und Gotik-
gemisch 1609 bis 1617 errichteten Kirche (Abb. 9*),
ihrem seitlichen von I. P. Homberger**) auf deni
Jesuitenplatz aufgeführten schlichtbarocken Anbau (Abb. 9)
und deni Renaissanceflügel mit seinen hochragenden
Zwerghäusern auf der Rückseite eine so wirkungsvolle
Baugruppe voll malerischer Nuancen, wic nur wenig
Städte in den Rheinlanden sich rühmen können, sie zu
besitzen.
Mit seiner Hauptfront schaut der Bau auf dcn Ie-
suitenplatz (Abb. 3), zu dem die Baumasse in geradezu
tresflich abgewogenem Verhältnis steht — ein beson-
deres Verdienst des komponierenden Architekten, der
sich hier trotz aller Erinnerungen im kleinen an die
*) Braun: Die Kirchenbauten der deutschen Iesuiten, I.
**) Die Originalpläne dieses Koblenzer Lokalmeisters und
Schülers von Joh. Seiz haben sich im K. A. unter den Plänen
der Jesuitenbauten erhalten.
Z7
Die Hauptfront des Stadthauses nach dem Jesuitenplah zu.
zu geben verniag. An weniger hervortretenden Künst-
lern sei dann noch Theodor Molitor, Maler und Bild-
hauer von Cocheni, genannt, der allerhand Bildhauer-
arbeit an den Magisterstühlen verfertigt und der auch
ini März 1700 seine Iahlung erhalt „für ... noch ein
Muttergottes Bield sambt dem Kindgen auf dem Arme
in flach malerey ... zu den Stuhl, so Jhre Churf. Gnadcn
durch den Hoffschreyner verfertigen lassen in die Newe
scholen". Es war dieser Hofschreiner Hans Georg
Clebertz von Speyer, der 1698 und 1699 an diesen
Stühlen arbeitet, von denen er betont, daß er „als
ein junger Meister seinen höchsten Fleiß daran ver-
wendet hat"*).
Mit dem Jahre 1701 stand das Bauwerk als neue
Aierde der zweiten Residenz von Kurtrier völlig vollendet
da. Dieser charakteristische Barockbau der Koblenzer
Jesuiten nimmt trotz seiner im allgemeinen nur einfach
zu nennenden Behandlung eine bedeutsame künstlerische
*) An weiterenKünstlern werden gclcgentlich in den Beilagen
zur Baurechnung im K. A. noch 1697 Mathias Koentgen, Bild-
hauer im Thal Ehrenbreitstein, und 1698 Joh. Peter Frithofen,
Bürger und Bildhauer in Koblenz, genannt, die aber zu diesem
Bauwesen nicht in nähere Beziehung traten.
Stellung unter den Kurtrierer, ja auch überhaupt rheini-
schen Bauten des zu Ende gehenden 17. JahrhundertS
ein, als deren bedeutendster er ohne Frage bezeichnet
zu werden verdient. Er bildet im Verein mit den übrigen
Jesuitenbauten, der in buntem Renaissance- und Gotik-
gemisch 1609 bis 1617 errichteten Kirche (Abb. 9*),
ihrem seitlichen von I. P. Homberger**) auf deni
Jesuitenplatz aufgeführten schlichtbarocken Anbau (Abb. 9)
und deni Renaissanceflügel mit seinen hochragenden
Zwerghäusern auf der Rückseite eine so wirkungsvolle
Baugruppe voll malerischer Nuancen, wic nur wenig
Städte in den Rheinlanden sich rühmen können, sie zu
besitzen.
Mit seiner Hauptfront schaut der Bau auf dcn Ie-
suitenplatz (Abb. 3), zu dem die Baumasse in geradezu
tresflich abgewogenem Verhältnis steht — ein beson-
deres Verdienst des komponierenden Architekten, der
sich hier trotz aller Erinnerungen im kleinen an die
*) Braun: Die Kirchenbauten der deutschen Iesuiten, I.
**) Die Originalpläne dieses Koblenzer Lokalmeisters und
Schülers von Joh. Seiz haben sich im K. A. unter den Plänen
der Jesuitenbauten erhalten.
Z7