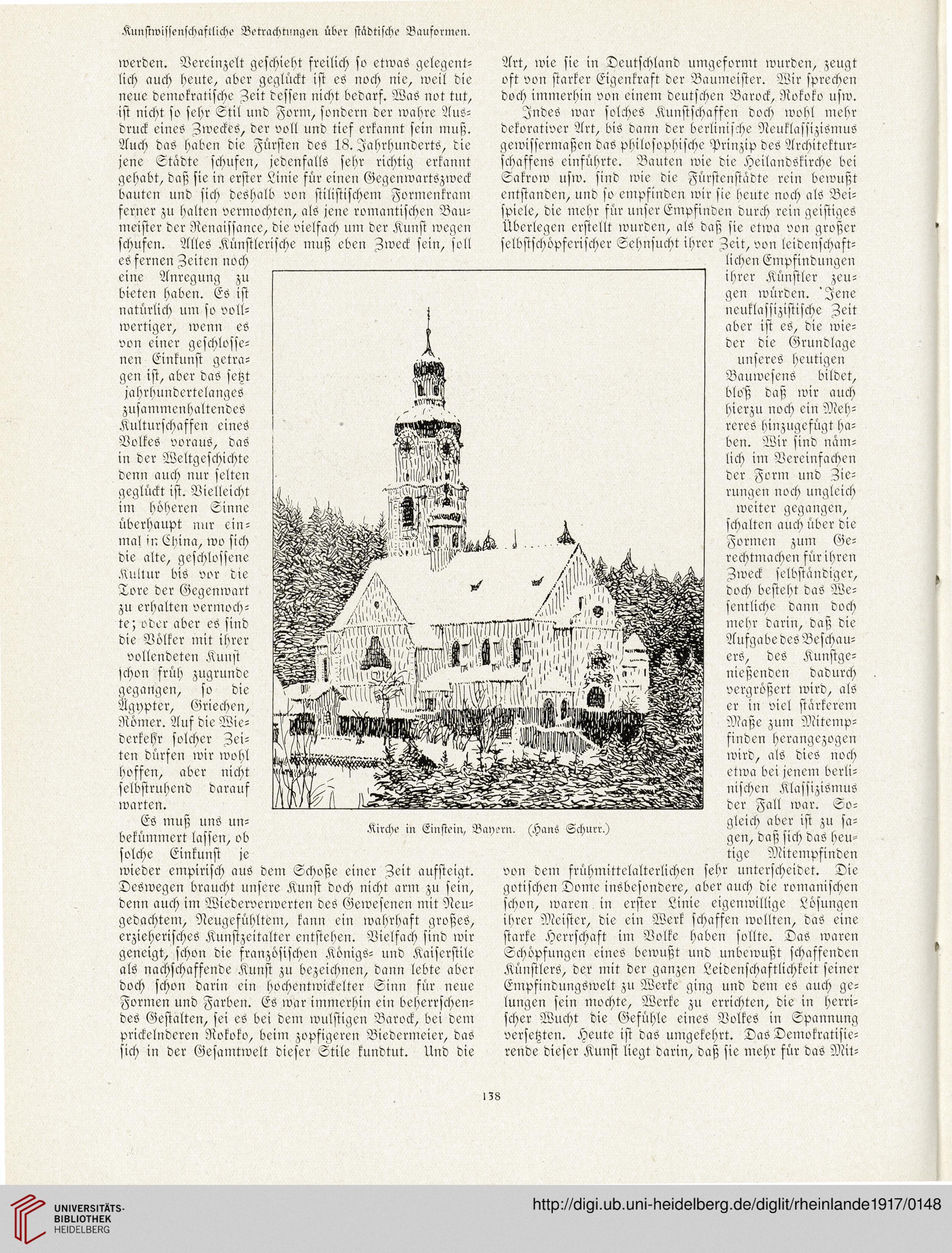Kunstwissenschaftllche Betrnchtungen über städtische Bauformen.
werden. Vereinzelt geschieht freilich so etwas gelegent-
lich auch heute, aber geglückt ist es noch nie, weil die
neue demokratische Aeit dessen nicht bedarf. Was not tut,
ist nicht so sehr Stil und Form, sondern der wahre Aus-
druck eines Aweckes, der voll und tief erkannt sein muß.
Auch das haben die Fürsten des 18. Jahrhunderts, die
jene Stadte schufen, jcdenfalls sehr richtig erkannt
gehabt, daß sie in erster Linie für einen Gegenwartszweck
bauten und sich deshalb von stilistischem Formenkranr
ferner zu halten vermochten, als jene romantischen Bau-
meister der Renaissance, die vielfach um der Kunst wegen
schufen. Alles Künstlerische muß eben Aweck sein, soll
es fernen Aeiten noch
eine Anregung zu
bieten haben. Es ist
natürlich um so voll-
wertiger, wenn es
von einer geschlosse-
nen Einkunst getra-
gen ist, aber das setzt
jahrhundertelanges
zusammenhaltendes
Kulturschafsen eines
Volkes voraus, das
in der Weltgeschichte
denn auch nur selten
geglückt ist. Vielleicht
im höheren Sinne
überhaupt nur cin-
mal in Ehina, wo sich
die alte, geschlossene
Kultur bis vor dre
Tore der Gegenwart
zu erhalten vermoch-
te; oder aber es sind
die Völker mit ihrer
vollendeten Kunst
schon früh zugrunde
gegangen, so die
Agypter, Griechen,
Römer. Auf die Wie-
derkehr solcher Aei-
ten dürfen wir wohl
hoffen, aber nicht
selbstruhend darauf
warten.
Es muß uns un-
bekümmert lassen, ob
solche Einkunst je
wieder empirisch aus dem Schoße einer Aeit aufsteigt.
Deswegen braucht unsere Kunst doch nicht arm zu sein,
denn auch im Wiederverwerten des Gewesenen mit Neu-
gedachtem, Neugefühltem, kann ein wahrhaft großes,
erzieherisches Kunstzeitalter entstehen. Vielfach sind wir
geneigt, schon die französischen Königs- und Kaiserstile
als nachschaffende Kunst zu bezeichnen, dann lebte aber
doch schon darin ein hochentwickelter Sinn für neue
Formen und Farben. Es war immerhin ein beherrschen-
des Gestalten, sei es bei dem wulstigen Barock, bei dem
prickelnderen Rokoko, beim zopfigeren Biedermeier, das
sich in der Gesamtwelt dieser Stile kundtut. Und die
>Z8
Art, wie sie in Deutschland umgeformt wurden, zeugt
ost von starker Eigenkraft der Baumeister. Wir sprechen
doch immerhin von einem deutschen Barock, Rokoko usw.
Jndes war solches Kunstschaffen doch wohl mehr
dekorativer Art, bis dann der berlinische Neuklassizismus
gewissermaßen das philosophische Prinzip des Architektur-
schaffens einführte. Bauten wie die Heilandskirche bei
Sakrow usw. sind wie die Fürstenstädte rein bewußt
entstanden, und so empfinden wir sie heute noch als Bei-
spiele, die mehr für unser Empfinden durch rein geistiges
Überlegen erstellt wurden, als daß sie etwa von großer
selbstschöpferischer Sehnsucht ihrer Zeit, von leidenschaft-
lichen Enipfindungen
ihrer Künstler zeu-
gen würden. 'Jene
neuklassizistische Ieit
aber ist es, die wie-
der die Grundlage
unseres heutigen
Bauivesens bildet,
bloß daß wir auch
hierzu noch ein Meh-
reres hinzugefügt ha-
ben. Wir sind nam-
lich im Vereinfachen
der Form und Zie-
rungen noch ungleich
weiter gegangen,
schalten auch über die
Formen zum Ge-
rechtmachen fürihren
Zweck selbstandiger,
doch besteht das We-
sentliche dann doch
mehr darin, daß die
AufgabedesBeschau-
ers, des Kunstge-
nießenden dadurch
vergrößert wird, als
er in viel stärkerem
Maße zum Mitemp-
finden herangezogen
wird, als dies noch
etwa bei jenem berli-
nischen Klassizismus
der Fall war. So-
gleich aber ist zu sa-
gen, daß sich das heu-
tige Mitempfinden
von dem frühmittelalterlichen sehr unterscheidet. Die
gotischen Dome insbesondere, aber auch die romanischen
schon, waren in erster Linie eigenwillige Lösungen
ihrer Mcister, die ein Werk schasfen wollten, das eine
starke Herrschaft im Volke haben sollte. Das waren
Schöpfungen eines bewußt und unbewußt schaffenden
Künstlers, der mit der ganzen Leidenschaftlichkeit seiner
Empfindungswelt zu Werke ging und dem es auch ge-
lungen sein mochte, Werke zu errichten, die in herri-
scher Wucht die Gefühle eines Volkes in Spannung
versetzten. Heute ist das umgekehrt. Das Demokratisie-
rende dieser Kunst liegt darin, daß sie mehr für das Mit-
Kirche in Einstein, Bayern. (Hans Schurr.)
werden. Vereinzelt geschieht freilich so etwas gelegent-
lich auch heute, aber geglückt ist es noch nie, weil die
neue demokratische Aeit dessen nicht bedarf. Was not tut,
ist nicht so sehr Stil und Form, sondern der wahre Aus-
druck eines Aweckes, der voll und tief erkannt sein muß.
Auch das haben die Fürsten des 18. Jahrhunderts, die
jene Stadte schufen, jcdenfalls sehr richtig erkannt
gehabt, daß sie in erster Linie für einen Gegenwartszweck
bauten und sich deshalb von stilistischem Formenkranr
ferner zu halten vermochten, als jene romantischen Bau-
meister der Renaissance, die vielfach um der Kunst wegen
schufen. Alles Künstlerische muß eben Aweck sein, soll
es fernen Aeiten noch
eine Anregung zu
bieten haben. Es ist
natürlich um so voll-
wertiger, wenn es
von einer geschlosse-
nen Einkunst getra-
gen ist, aber das setzt
jahrhundertelanges
zusammenhaltendes
Kulturschafsen eines
Volkes voraus, das
in der Weltgeschichte
denn auch nur selten
geglückt ist. Vielleicht
im höheren Sinne
überhaupt nur cin-
mal in Ehina, wo sich
die alte, geschlossene
Kultur bis vor dre
Tore der Gegenwart
zu erhalten vermoch-
te; oder aber es sind
die Völker mit ihrer
vollendeten Kunst
schon früh zugrunde
gegangen, so die
Agypter, Griechen,
Römer. Auf die Wie-
derkehr solcher Aei-
ten dürfen wir wohl
hoffen, aber nicht
selbstruhend darauf
warten.
Es muß uns un-
bekümmert lassen, ob
solche Einkunst je
wieder empirisch aus dem Schoße einer Aeit aufsteigt.
Deswegen braucht unsere Kunst doch nicht arm zu sein,
denn auch im Wiederverwerten des Gewesenen mit Neu-
gedachtem, Neugefühltem, kann ein wahrhaft großes,
erzieherisches Kunstzeitalter entstehen. Vielfach sind wir
geneigt, schon die französischen Königs- und Kaiserstile
als nachschaffende Kunst zu bezeichnen, dann lebte aber
doch schon darin ein hochentwickelter Sinn für neue
Formen und Farben. Es war immerhin ein beherrschen-
des Gestalten, sei es bei dem wulstigen Barock, bei dem
prickelnderen Rokoko, beim zopfigeren Biedermeier, das
sich in der Gesamtwelt dieser Stile kundtut. Und die
>Z8
Art, wie sie in Deutschland umgeformt wurden, zeugt
ost von starker Eigenkraft der Baumeister. Wir sprechen
doch immerhin von einem deutschen Barock, Rokoko usw.
Jndes war solches Kunstschaffen doch wohl mehr
dekorativer Art, bis dann der berlinische Neuklassizismus
gewissermaßen das philosophische Prinzip des Architektur-
schaffens einführte. Bauten wie die Heilandskirche bei
Sakrow usw. sind wie die Fürstenstädte rein bewußt
entstanden, und so empfinden wir sie heute noch als Bei-
spiele, die mehr für unser Empfinden durch rein geistiges
Überlegen erstellt wurden, als daß sie etwa von großer
selbstschöpferischer Sehnsucht ihrer Zeit, von leidenschaft-
lichen Enipfindungen
ihrer Künstler zeu-
gen würden. 'Jene
neuklassizistische Ieit
aber ist es, die wie-
der die Grundlage
unseres heutigen
Bauivesens bildet,
bloß daß wir auch
hierzu noch ein Meh-
reres hinzugefügt ha-
ben. Wir sind nam-
lich im Vereinfachen
der Form und Zie-
rungen noch ungleich
weiter gegangen,
schalten auch über die
Formen zum Ge-
rechtmachen fürihren
Zweck selbstandiger,
doch besteht das We-
sentliche dann doch
mehr darin, daß die
AufgabedesBeschau-
ers, des Kunstge-
nießenden dadurch
vergrößert wird, als
er in viel stärkerem
Maße zum Mitemp-
finden herangezogen
wird, als dies noch
etwa bei jenem berli-
nischen Klassizismus
der Fall war. So-
gleich aber ist zu sa-
gen, daß sich das heu-
tige Mitempfinden
von dem frühmittelalterlichen sehr unterscheidet. Die
gotischen Dome insbesondere, aber auch die romanischen
schon, waren in erster Linie eigenwillige Lösungen
ihrer Mcister, die ein Werk schasfen wollten, das eine
starke Herrschaft im Volke haben sollte. Das waren
Schöpfungen eines bewußt und unbewußt schaffenden
Künstlers, der mit der ganzen Leidenschaftlichkeit seiner
Empfindungswelt zu Werke ging und dem es auch ge-
lungen sein mochte, Werke zu errichten, die in herri-
scher Wucht die Gefühle eines Volkes in Spannung
versetzten. Heute ist das umgekehrt. Das Demokratisie-
rende dieser Kunst liegt darin, daß sie mehr für das Mit-
Kirche in Einstein, Bayern. (Hans Schurr.)