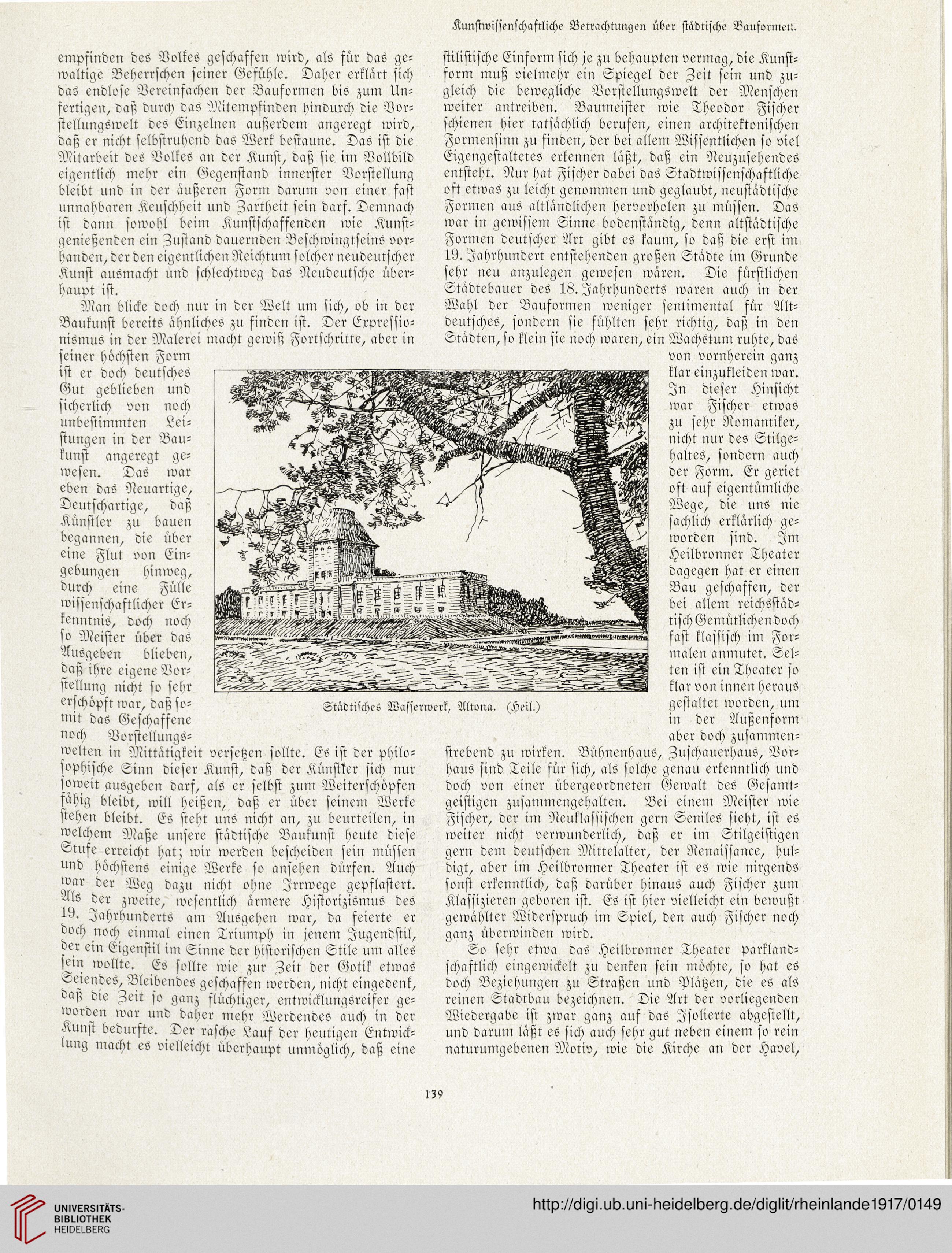Kunstwissenschaftliche Betrachtungen über städtische Bauformen.
empfinden des Volkes geschaffen wird, als für das ge-
waltige Beherrschen seiner Gefühle. Daher erklärt sich
das endlose Vereinfachen der Bauformen bis zum Un-
fertigen, daß durch das Mitempfinden hindurch die Vor-
stellungswelt des Einzclnen außerdem angeregt wirch
daß er nicht selbstruhend das Werk bestaune. Das ist die
Mitarbeit des Volkes an der Kunst, daß sie im Vollbild
eigentlich mehr ein Gegenstand innerster Vorstellung
bleibt und in der außeren Form darum von einer fast
unnahbaren Keuschheit und Aartheit sein darf. Demnach
ist dann sowohl beim Kunstschaffenden wie Kunst-
genießenden ein Austand dauernden Beschwingtseins vor-
handcn, der den eigentlichen Reichtum solcher neudeutscher
Kunst ausmacht und schlechtweg das Neudeutsche über-
haupt ist.
Man blicke doch nur in der Welt um sich, ob in der
Baukunst bereits ahnliches zu finden ist. Der Erpressio-
nismus in der Malerei macht gewiß Fortschritte, aber in
seiner höchsten Form
ist er doch deutsches
Gut geblieben und
sicherlich von noch
unbestimmten Lei-
stungen in der Bau-
kunst angeregt ge-
wesen. Das war
eben das Neuartige,
Deutschartige, daß
Künstler zu bauen
begannen, die über
eine Flut von Ein-
gebungen hinweg,
durch eine Fülle
wissenschaftlicher Er-
kenntnis, doch noch
so Meister über das
Ausgeben blieben,
daß ihre eigene Vor-
stellung nicht so sehr
erschöpft war, daß so-
nnt das Geschaffene
noch Vorstellungs-
welten in Mittatigkeit versetzen sollte. Es ist der philo-
svphische Sinn dieser Kunst, daß der Künstler sich nur
soweit ausgeben darf, als er selbst zuni Weiterschöpfen
fähig bleibt, will heißen, daß er über seinem Werke
stehen bleibt. Es steht uns nicht a», zu beurteilen, in
welchem Maße unsere städtische Baukunst heute diese
^tufe erreicht hat; wir werden bescheiden sein müsscn
und höchstens einige Werke so ansehen dürfen. Auch
war der Weg dazu nicht ohne Jrrwege gepflastert.
Als der zweite, wesentlich ärmere Historizismus des
19. Jahrhunderts am Ausgehen war, da feierte er
doch noch einmal einen Triumph in jenem Jugendstil,
der ein Eigensiil im Sinne der historischen Stile um alles
sein wollte. Es sollte wie zur Aeit der Gotik etwas
Deiendes, Bleibendes geschaffen werden, nicht eingedenk,
daß die Aeit so ganz flüchtiger, entwicklungsreifer ge-
worden war und daher mehr Werdendes auch in der
Kunst bedurfte. Der rasche Lauf der heutigen Entwick-
ung macht es vielleicht überhaupt unmöglich, daß eine
stilistische Einform sich je zu behaupten vermag, die Kunst-
form muß vielmehr ein Spiegel der -Zeit sein und zu-
gleich die bewegliche Vorstellungswelt der Menschen
weiter antreiben. Baumeister wie Theodor Fischer
schienen hier tatsächlich berufen, einen architektonischen
Formensinn zu finden, der bei allem Wissentlichen so viel
Eigengestaltetes erkennen läßt, daß ein Neuzusehendes
entsteht. Nur hat Fischer dabei das Stadtwissenschaftliche
oft etwas zu leicht genommen und geglaubt, neustädtische
Formen aus altländlichen hervorholen zu müssen. Das
war in gewisseni Sinne bodenständig, denn altstädtische
Fornien deutscher Art gibt es kaum, so daß die erst ini
19. Jahrhundert entstehenden großen Städte im Grunde
sehr neu anzulegen gewesen wären. Die fürstlichen
Städtebauer des 18. Jahrhunderts waren auch in der
Wahl der Bauformen weniger sentimental für Alt-
deutsches, sondern sie sühlten sehr richtig, daß in den
Städten, so klein sie noch waren, ein Wachstum ruhte, das
von vornherein ganz
klar einzukleiden war.
Jn dieser Hinsicht
war Fischer etwas
zu sehr Roniantiker,
nicht nur des Stilge-
haltes, sondern auch
der Form. Er geriet
oft auf eigentümliche
Wege, die uns nie
sachlich erklärlich ge-
ivorden sind. Jm
Heilbronner Theater
dagegen hat er einen
Bau geschaffen, der
bei alleni reichsstäd-
tisch Geinütlichen doch
fast klassisch im For-
malen anmutet. Sel-
ten ist ein Theater so
klar von innen heraus
gestaltet worden, um
in der Außenform
aber doch zusammen-
strebend zu wirken. Bühnenhaus, Auschauerhaus, Vor-
haus sind Teile für sich, als solche genau erkenntlich und
doch von einer übergeordncten Gewalt des Gesamt-
geistigen zusammengehalten. Bei einem Meister wie
Fischer, der im Neuklassischen gern Seniles sieht, ist es
wciter nicht verwunderlich, daß er im Stilgeistigen
gern dem deutschen Mittelalter, der Renaissance, hul-
digt, aber im Heilbronner Theater ist es wie nirgends
sonst erkenntlich, daß darüber hinaus auch Fischer zum
Klassizieren geboren ist. Es ist hier vielleicht ein bewußt
gewahlter Widerspruch im Spiel, den auch Fischer noch
ganz überwinden wird.
So sehr etiva das Heilbronner Theater parkland-
schaftlich eingewickelt zu denken sein möchte, so hat es
doch Beziehungen zu Straßen und Plätzen, die es als
reinen Stadtbau bezeichnen. Die Art der vorliegenden
Wiedergabe ist zwar ganz auf das Jsolierte abgestellt,
und daruni läßt es sich auch sehr gut neben einem so rein
naturumgebenen Motiv, wie die Kirche an der Havel,
Städtisches Wasscrwerk, Altona. (Heil.)
empfinden des Volkes geschaffen wird, als für das ge-
waltige Beherrschen seiner Gefühle. Daher erklärt sich
das endlose Vereinfachen der Bauformen bis zum Un-
fertigen, daß durch das Mitempfinden hindurch die Vor-
stellungswelt des Einzclnen außerdem angeregt wirch
daß er nicht selbstruhend das Werk bestaune. Das ist die
Mitarbeit des Volkes an der Kunst, daß sie im Vollbild
eigentlich mehr ein Gegenstand innerster Vorstellung
bleibt und in der außeren Form darum von einer fast
unnahbaren Keuschheit und Aartheit sein darf. Demnach
ist dann sowohl beim Kunstschaffenden wie Kunst-
genießenden ein Austand dauernden Beschwingtseins vor-
handcn, der den eigentlichen Reichtum solcher neudeutscher
Kunst ausmacht und schlechtweg das Neudeutsche über-
haupt ist.
Man blicke doch nur in der Welt um sich, ob in der
Baukunst bereits ahnliches zu finden ist. Der Erpressio-
nismus in der Malerei macht gewiß Fortschritte, aber in
seiner höchsten Form
ist er doch deutsches
Gut geblieben und
sicherlich von noch
unbestimmten Lei-
stungen in der Bau-
kunst angeregt ge-
wesen. Das war
eben das Neuartige,
Deutschartige, daß
Künstler zu bauen
begannen, die über
eine Flut von Ein-
gebungen hinweg,
durch eine Fülle
wissenschaftlicher Er-
kenntnis, doch noch
so Meister über das
Ausgeben blieben,
daß ihre eigene Vor-
stellung nicht so sehr
erschöpft war, daß so-
nnt das Geschaffene
noch Vorstellungs-
welten in Mittatigkeit versetzen sollte. Es ist der philo-
svphische Sinn dieser Kunst, daß der Künstler sich nur
soweit ausgeben darf, als er selbst zuni Weiterschöpfen
fähig bleibt, will heißen, daß er über seinem Werke
stehen bleibt. Es steht uns nicht a», zu beurteilen, in
welchem Maße unsere städtische Baukunst heute diese
^tufe erreicht hat; wir werden bescheiden sein müsscn
und höchstens einige Werke so ansehen dürfen. Auch
war der Weg dazu nicht ohne Jrrwege gepflastert.
Als der zweite, wesentlich ärmere Historizismus des
19. Jahrhunderts am Ausgehen war, da feierte er
doch noch einmal einen Triumph in jenem Jugendstil,
der ein Eigensiil im Sinne der historischen Stile um alles
sein wollte. Es sollte wie zur Aeit der Gotik etwas
Deiendes, Bleibendes geschaffen werden, nicht eingedenk,
daß die Aeit so ganz flüchtiger, entwicklungsreifer ge-
worden war und daher mehr Werdendes auch in der
Kunst bedurfte. Der rasche Lauf der heutigen Entwick-
ung macht es vielleicht überhaupt unmöglich, daß eine
stilistische Einform sich je zu behaupten vermag, die Kunst-
form muß vielmehr ein Spiegel der -Zeit sein und zu-
gleich die bewegliche Vorstellungswelt der Menschen
weiter antreiben. Baumeister wie Theodor Fischer
schienen hier tatsächlich berufen, einen architektonischen
Formensinn zu finden, der bei allem Wissentlichen so viel
Eigengestaltetes erkennen läßt, daß ein Neuzusehendes
entsteht. Nur hat Fischer dabei das Stadtwissenschaftliche
oft etwas zu leicht genommen und geglaubt, neustädtische
Formen aus altländlichen hervorholen zu müssen. Das
war in gewisseni Sinne bodenständig, denn altstädtische
Fornien deutscher Art gibt es kaum, so daß die erst ini
19. Jahrhundert entstehenden großen Städte im Grunde
sehr neu anzulegen gewesen wären. Die fürstlichen
Städtebauer des 18. Jahrhunderts waren auch in der
Wahl der Bauformen weniger sentimental für Alt-
deutsches, sondern sie sühlten sehr richtig, daß in den
Städten, so klein sie noch waren, ein Wachstum ruhte, das
von vornherein ganz
klar einzukleiden war.
Jn dieser Hinsicht
war Fischer etwas
zu sehr Roniantiker,
nicht nur des Stilge-
haltes, sondern auch
der Form. Er geriet
oft auf eigentümliche
Wege, die uns nie
sachlich erklärlich ge-
ivorden sind. Jm
Heilbronner Theater
dagegen hat er einen
Bau geschaffen, der
bei alleni reichsstäd-
tisch Geinütlichen doch
fast klassisch im For-
malen anmutet. Sel-
ten ist ein Theater so
klar von innen heraus
gestaltet worden, um
in der Außenform
aber doch zusammen-
strebend zu wirken. Bühnenhaus, Auschauerhaus, Vor-
haus sind Teile für sich, als solche genau erkenntlich und
doch von einer übergeordncten Gewalt des Gesamt-
geistigen zusammengehalten. Bei einem Meister wie
Fischer, der im Neuklassischen gern Seniles sieht, ist es
wciter nicht verwunderlich, daß er im Stilgeistigen
gern dem deutschen Mittelalter, der Renaissance, hul-
digt, aber im Heilbronner Theater ist es wie nirgends
sonst erkenntlich, daß darüber hinaus auch Fischer zum
Klassizieren geboren ist. Es ist hier vielleicht ein bewußt
gewahlter Widerspruch im Spiel, den auch Fischer noch
ganz überwinden wird.
So sehr etiva das Heilbronner Theater parkland-
schaftlich eingewickelt zu denken sein möchte, so hat es
doch Beziehungen zu Straßen und Plätzen, die es als
reinen Stadtbau bezeichnen. Die Art der vorliegenden
Wiedergabe ist zwar ganz auf das Jsolierte abgestellt,
und daruni läßt es sich auch sehr gut neben einem so rein
naturumgebenen Motiv, wie die Kirche an der Havel,
Städtisches Wasscrwerk, Altona. (Heil.)