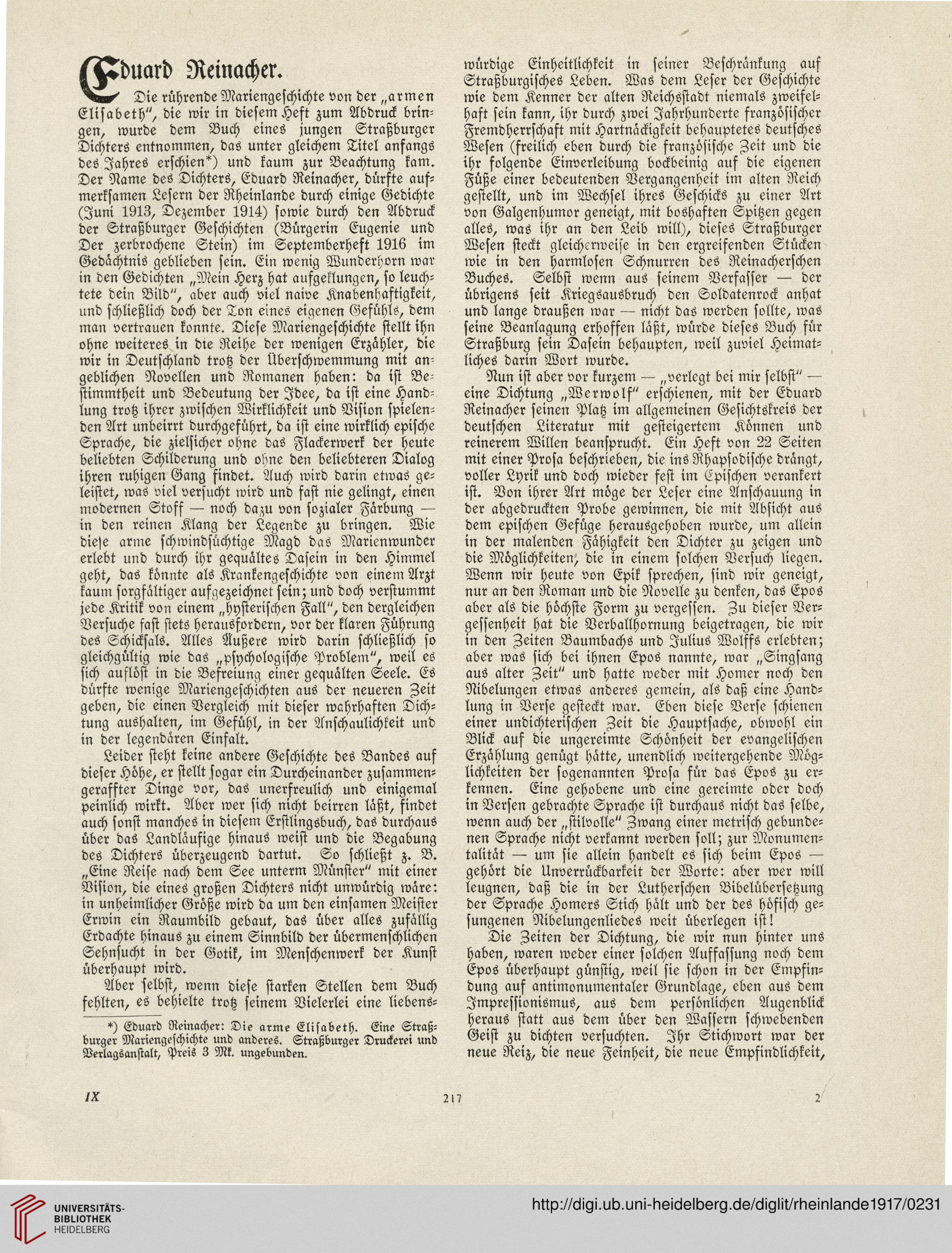duard Reinacher.
Die rührende Mariengeschichte von der „armen
Elisabeth", die wir in diesem Heft zum Abdruck brin-
gen, wurde dem Buch eines jungen Straßburger
Dichters entnommen, das unter gleichem Titel anfangs
des Jahres erschien^) und kaum zur Beachtung kam.
Der Name des Dichters, Eduard Reinacher, dürfte auf-
merksamen Lesern der Rheinlande durch einige Gedichte
(Juni 1913, Dezember 1914) sowie durch den Abdruck
der Straßburger Geschichten (Bürgerin Eugenie und
Der zerbrochene Stein) im Septemberheft 1916 im
Gedächtnis geblieben sein. Ein wenig Wunderhorn war
in den Gedichten „Mein Herz hat aufgeklungen, so leuch-
tete dein Bild", aber auch viel naive Knabenhaftigkeit,
und schließlich doch der Ton eines eigenen Gefühls, dem
man vertrauen konnte. Diese Mariengeschichte stellt ihn
ohne weiteres in dle Reihe der wenigen Erzähler, die
wir in Deutschland trotz der Uberschwemmung mit an-
geblichen Novellen und Romanen haben: da ist Be-
stimmtheit und Bedeutung der Jdee, da ist eine Hand-
lung trotz ihrer zwischen Wirklichkeit und Vision spielen-
den Art unbeirrt durchgeführt, da ist eine wirklich epische
Sprache, die zielsicher ohne das Flackerwerk der heute
beliebten Schilderung und ohne den beliebteren Dialog
ihren ruhigen Gang findet. Äuch wird darin etwas ge-
leistet, was viel versucht wird und fast nie gelingt, einen
modernen Stoff — noch dazu von sozialer Färbung —
in den reinen Klang der Legende zu bringen. Wie
diese arme schwindsüchtige Magd das Marienwunder
erlebt und durch ihr gequältes Dasein in den Himmel
geht, das könnte als Krankengeschichte von einem Arzt
kaum sorgfältiger aufgezeichnet sein; und doch verstummt
jede Kritik von einem „hysterischen Fall", den dergleichen
Versuche fast stets herausfordern, vor der klaren Führung
des Schicksals. Alles Außere wird darin schließlich so
gleichgültig wie das „psychologische Problem", weil es
sich auflöst in die Befreiung einer gequälten Seele. Es
dürfte wenige Mariengeschichten aus der neueren Zeit
geben, die einen Vergleich mit dieser wahrhaften Dich-
tung aushalten, im Gefühl, in der Anschaulichkeit und
in der legendären Einfalt.
Leider steht keine andere Geschichte des Bandes auf
dieser Höhe, er stellt sogar ein Durcheinander zusammen-
geraffter Dinge vor, das unerfreulich und einigemal
peinlich wirkt. Aber wer sich nicht beirren läßt, findet
auch sonst manches in diesem Erstlingsbuch, das durchaus
über das Landläufige hinaus weist und die Begabung
des Dichters überzeugend dartut. So schließt z. B.
„Eine Reise nach dem See unterm Münster" mit einer
Vision, die eines großen Dichters nicht unwürdig wäre:
in unheimlicher Größe wird da um den einsamen Meister
Erwin ein Raumbild gebaut, das über alles zufällig
Erdachte hinaus zu einem Sinnbild der übermenschlichen
Sehnsucht in der Gotik, im Menschenwerk der Kunst
überhaupt wird.
Aber selbst, wenn diese starken Stellen dem Buch
fehlten, es behielte trotz seinem Vielerlei eine liebens-
*) Eduard Reinacher: Die arme Clisabeth. Eine Straß-
burger Mariengeschichte und anderes. Straßburger Druckerei und
Verlagsanstalt, Preis 3 Mk. ungebunden.
würdige Einheitlichkeit in seiner Beschränkung auf
Straßburgisches Leben. Was dem Leser der Geschichte
wie dem Kenner der alten Reichsstadt niemals zweifel-
haft sein kann, ihr durch zwei Jahrhunderte französischer
Fremdherrschaft mit Hartnäckigkeit behauptetes deutsches
Wesen (freilich eben durch die französische Zeit und die
ihr folgende Einverleibung bockbeinig auf die eigenen
Füße einer bedeutenden Vergangenheit im alten Reich
gestellt, und im Wechsel ihres Geschicks zu einer Art
von Galgenhumor geneigt, mit boshaften Spitzen gegen
alles, was ihr an den Leib will), dieses Straßburger
Wesen steckt gleichcrweise in den ergreifenden Stücken
wie in den harmlosen Schnurren des Reinacherschen
Buches. Selbst wenn aus seinem Verfasser — der
übrigens seit Kriegsausbruch den Soldatenrock anhat
und lange draußen war — nicht das werden sollte, was
seine Beanlagung erhoffen läßt, würde dieses Buch für
Straßburg sein Dasein behaupten, weil zuviel Heimat-
liches darin Wort wurde.
Nun ist aber vor kurzem — „verlegt bei mir selbst" —
eine Dichtung „Werwolf" erschienen, mit der Eduard
Reinacher seinen Platz im allgemeinen Gesichtskreis der
deutschen Literatur mit gesteigertem Können und
reinerem Willen beansprucht. Ein Heft von 22 Seiten
mit einer Prosa beschrieben, die ins Rhapsodische drängt,
voller Lyrik und doch wieder fest im Epischen verankert
ist. Von ihrer Art möge der Leser eine Anschauung in
der abgedruckten Probe gewinnen, die mit Absicht aus
dem epischen Gefüge herausgehoben wurde, um allein
in der malenden Fähigkeit den Dichter zu zeigen und
die Möglichkeiten, die in einem solchen Versuch liegen.
Wenn wir heute von Epik sprechen, sind wir geneigt,
nur an den Roman und die Novelle zu denken, das Epos
aber als die höchste Form zu vergessen. Au dieser Ver-
gessenheit hat die Verballhornung beigetragen, die wir
in den Zeiten Baumbachs und Julius Wolffs erlebten;
aber was sich bei ihnen Epos nannte, war „Singsang
aus alter Ieit" und hatte weder mit Homer noch den
Nibelungen etwas anderes gemein, als daß eine Hand-
lung in Verse gesteckt war. Eben diese Verse schienen
einer undichterischen Aeit die Hauptsache, obwohl ein
Blick auf die ungereimte Schönheit der evangelischen
Erzählung genügt hätte, unendlich weitergehende Mog-
lichkeiten der sogenannten Prosa für das Epos zu er-
kennen. Eine gehobene und eine gereimte oder doch
in Versen gebrachte Sprache ist durchaus nicht das selbe,
wenn auch der „stilvolle" Zwang einer metrisch gebunde-
nen Sprache nicht verkannt werden soll; zur Monumen-
talität — um sie allein handelt es sich beim Epos —
gehört die Unverrückbarkeit der Worte: aber wer will
leugnen, daß die in der Lutherschen Bibelübersetzung
der Sprache Homers Stich hält und der des höfisch ge-
sungenen Nibelungenliedes weit überlegen ist!
Die Aeiten der Dichtung, die wir nun hinter uns
haben, waren weder einer solchen Auffassung noch dem
Epos überhaupt günstig, weil sie schon in der Empfin-
dung auf antimonumentaler Grundlage, eben aus dem
Jmpressionismus, aus dem persönlichen Augenblick
heraus statt aus dem über den Wassern schwebenden
Geist zu dichten versuchten. Jhr Stichwort war der
neue Reiz, die neue Feinheit, die neue Empfindlichkeit,
/X
217
2'
Die rührende Mariengeschichte von der „armen
Elisabeth", die wir in diesem Heft zum Abdruck brin-
gen, wurde dem Buch eines jungen Straßburger
Dichters entnommen, das unter gleichem Titel anfangs
des Jahres erschien^) und kaum zur Beachtung kam.
Der Name des Dichters, Eduard Reinacher, dürfte auf-
merksamen Lesern der Rheinlande durch einige Gedichte
(Juni 1913, Dezember 1914) sowie durch den Abdruck
der Straßburger Geschichten (Bürgerin Eugenie und
Der zerbrochene Stein) im Septemberheft 1916 im
Gedächtnis geblieben sein. Ein wenig Wunderhorn war
in den Gedichten „Mein Herz hat aufgeklungen, so leuch-
tete dein Bild", aber auch viel naive Knabenhaftigkeit,
und schließlich doch der Ton eines eigenen Gefühls, dem
man vertrauen konnte. Diese Mariengeschichte stellt ihn
ohne weiteres in dle Reihe der wenigen Erzähler, die
wir in Deutschland trotz der Uberschwemmung mit an-
geblichen Novellen und Romanen haben: da ist Be-
stimmtheit und Bedeutung der Jdee, da ist eine Hand-
lung trotz ihrer zwischen Wirklichkeit und Vision spielen-
den Art unbeirrt durchgeführt, da ist eine wirklich epische
Sprache, die zielsicher ohne das Flackerwerk der heute
beliebten Schilderung und ohne den beliebteren Dialog
ihren ruhigen Gang findet. Äuch wird darin etwas ge-
leistet, was viel versucht wird und fast nie gelingt, einen
modernen Stoff — noch dazu von sozialer Färbung —
in den reinen Klang der Legende zu bringen. Wie
diese arme schwindsüchtige Magd das Marienwunder
erlebt und durch ihr gequältes Dasein in den Himmel
geht, das könnte als Krankengeschichte von einem Arzt
kaum sorgfältiger aufgezeichnet sein; und doch verstummt
jede Kritik von einem „hysterischen Fall", den dergleichen
Versuche fast stets herausfordern, vor der klaren Führung
des Schicksals. Alles Außere wird darin schließlich so
gleichgültig wie das „psychologische Problem", weil es
sich auflöst in die Befreiung einer gequälten Seele. Es
dürfte wenige Mariengeschichten aus der neueren Zeit
geben, die einen Vergleich mit dieser wahrhaften Dich-
tung aushalten, im Gefühl, in der Anschaulichkeit und
in der legendären Einfalt.
Leider steht keine andere Geschichte des Bandes auf
dieser Höhe, er stellt sogar ein Durcheinander zusammen-
geraffter Dinge vor, das unerfreulich und einigemal
peinlich wirkt. Aber wer sich nicht beirren läßt, findet
auch sonst manches in diesem Erstlingsbuch, das durchaus
über das Landläufige hinaus weist und die Begabung
des Dichters überzeugend dartut. So schließt z. B.
„Eine Reise nach dem See unterm Münster" mit einer
Vision, die eines großen Dichters nicht unwürdig wäre:
in unheimlicher Größe wird da um den einsamen Meister
Erwin ein Raumbild gebaut, das über alles zufällig
Erdachte hinaus zu einem Sinnbild der übermenschlichen
Sehnsucht in der Gotik, im Menschenwerk der Kunst
überhaupt wird.
Aber selbst, wenn diese starken Stellen dem Buch
fehlten, es behielte trotz seinem Vielerlei eine liebens-
*) Eduard Reinacher: Die arme Clisabeth. Eine Straß-
burger Mariengeschichte und anderes. Straßburger Druckerei und
Verlagsanstalt, Preis 3 Mk. ungebunden.
würdige Einheitlichkeit in seiner Beschränkung auf
Straßburgisches Leben. Was dem Leser der Geschichte
wie dem Kenner der alten Reichsstadt niemals zweifel-
haft sein kann, ihr durch zwei Jahrhunderte französischer
Fremdherrschaft mit Hartnäckigkeit behauptetes deutsches
Wesen (freilich eben durch die französische Zeit und die
ihr folgende Einverleibung bockbeinig auf die eigenen
Füße einer bedeutenden Vergangenheit im alten Reich
gestellt, und im Wechsel ihres Geschicks zu einer Art
von Galgenhumor geneigt, mit boshaften Spitzen gegen
alles, was ihr an den Leib will), dieses Straßburger
Wesen steckt gleichcrweise in den ergreifenden Stücken
wie in den harmlosen Schnurren des Reinacherschen
Buches. Selbst wenn aus seinem Verfasser — der
übrigens seit Kriegsausbruch den Soldatenrock anhat
und lange draußen war — nicht das werden sollte, was
seine Beanlagung erhoffen läßt, würde dieses Buch für
Straßburg sein Dasein behaupten, weil zuviel Heimat-
liches darin Wort wurde.
Nun ist aber vor kurzem — „verlegt bei mir selbst" —
eine Dichtung „Werwolf" erschienen, mit der Eduard
Reinacher seinen Platz im allgemeinen Gesichtskreis der
deutschen Literatur mit gesteigertem Können und
reinerem Willen beansprucht. Ein Heft von 22 Seiten
mit einer Prosa beschrieben, die ins Rhapsodische drängt,
voller Lyrik und doch wieder fest im Epischen verankert
ist. Von ihrer Art möge der Leser eine Anschauung in
der abgedruckten Probe gewinnen, die mit Absicht aus
dem epischen Gefüge herausgehoben wurde, um allein
in der malenden Fähigkeit den Dichter zu zeigen und
die Möglichkeiten, die in einem solchen Versuch liegen.
Wenn wir heute von Epik sprechen, sind wir geneigt,
nur an den Roman und die Novelle zu denken, das Epos
aber als die höchste Form zu vergessen. Au dieser Ver-
gessenheit hat die Verballhornung beigetragen, die wir
in den Zeiten Baumbachs und Julius Wolffs erlebten;
aber was sich bei ihnen Epos nannte, war „Singsang
aus alter Ieit" und hatte weder mit Homer noch den
Nibelungen etwas anderes gemein, als daß eine Hand-
lung in Verse gesteckt war. Eben diese Verse schienen
einer undichterischen Aeit die Hauptsache, obwohl ein
Blick auf die ungereimte Schönheit der evangelischen
Erzählung genügt hätte, unendlich weitergehende Mog-
lichkeiten der sogenannten Prosa für das Epos zu er-
kennen. Eine gehobene und eine gereimte oder doch
in Versen gebrachte Sprache ist durchaus nicht das selbe,
wenn auch der „stilvolle" Zwang einer metrisch gebunde-
nen Sprache nicht verkannt werden soll; zur Monumen-
talität — um sie allein handelt es sich beim Epos —
gehört die Unverrückbarkeit der Worte: aber wer will
leugnen, daß die in der Lutherschen Bibelübersetzung
der Sprache Homers Stich hält und der des höfisch ge-
sungenen Nibelungenliedes weit überlegen ist!
Die Aeiten der Dichtung, die wir nun hinter uns
haben, waren weder einer solchen Auffassung noch dem
Epos überhaupt günstig, weil sie schon in der Empfin-
dung auf antimonumentaler Grundlage, eben aus dem
Jmpressionismus, aus dem persönlichen Augenblick
heraus statt aus dem über den Wassern schwebenden
Geist zu dichten versuchten. Jhr Stichwort war der
neue Reiz, die neue Feinheit, die neue Empfindlichkeit,
/X
217
2'