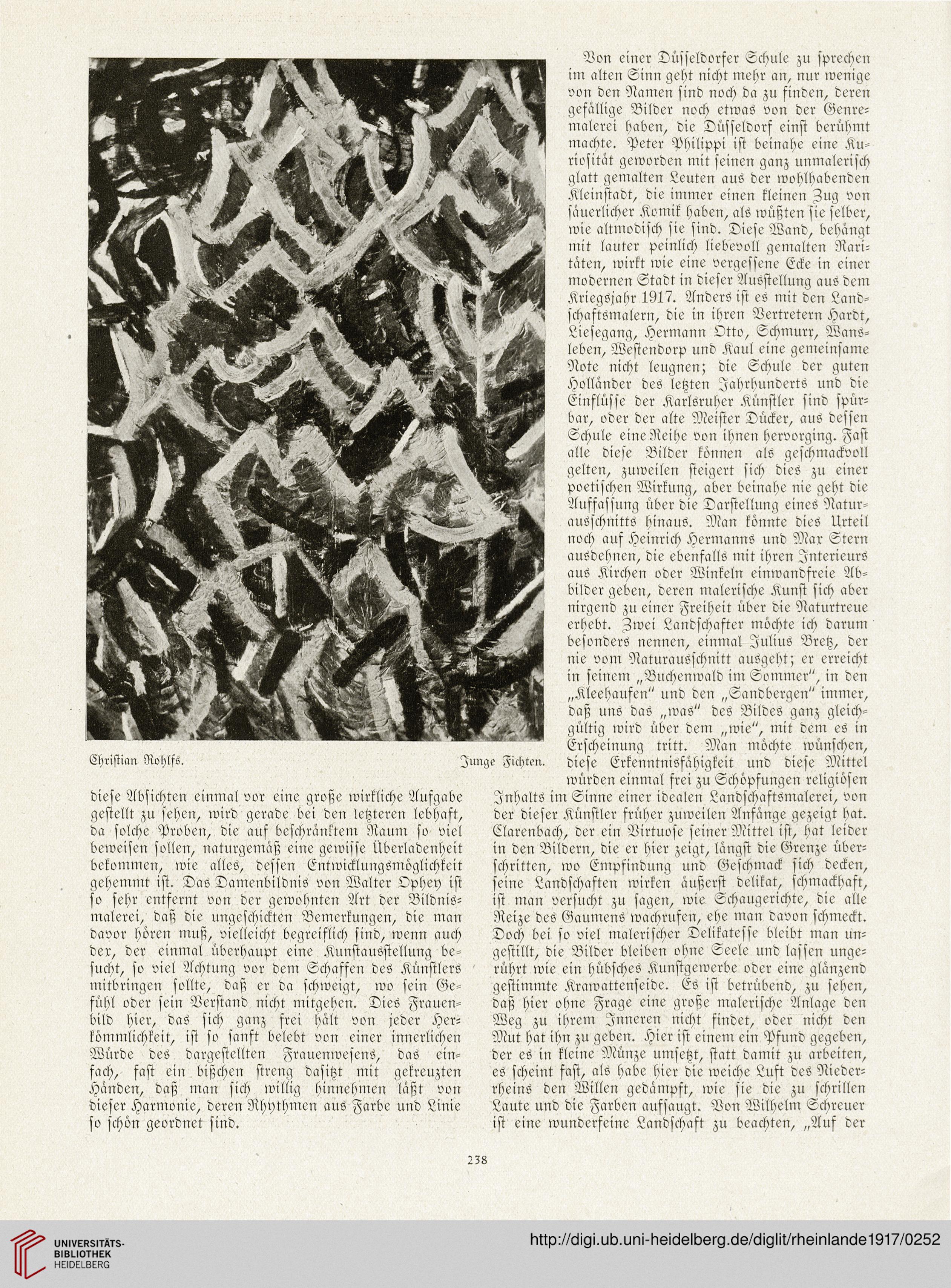Christian Rohlfs. Junge Fichten.
diese Absichten einmal ver eine große wirkliche Aufgabe
gestellt zu sehen, wird gerade bei den letzteren lebhaft,
da solche Proben, die auf beschranktem Raum so viel
beweisen sollen, naturgemaß eine gewisse Überladenheit
bekommen, wie alles, dessen Entwicklungsmöglichkeit
gehemnit ist. Das Damenbildnis von Walter Ophey ist
so sehr entfernt von der gewohnten Art der Bildnis-
malerei, daß die ungeschickten Bemerkungen, die man
davor hören muß, vielleicht begreiflich sind, wenn auch
der, der einmal überhaupt eine Kunstausstellung be-
sucht, so viel Achtung vor dem Schaffen des Künstlers
mitbringen sollte, daß er da schweigt, wo sein Ge-
fühl oder sein Verstand nicht mitgehen. Dies Frauen-
bild hier, das sich ganz frei hält von jeder Her-
kömmlichkeit, ist so sanft belebt von einer innerlichen
Würde des dargestellten Frauenwesens, das ein-
fach, fast ein bißchen streng dasitzt mit gekreuzten
Handen, daß nian sich willig hinnehmen laßt vvn
dieser Harmonie, deren Rhythnien aus Farbe und Linie
so schön geordnet sind.
Von einer Düsseldorfer Schule zu sprechen
im alten Sinn geht nicht mehr an, nur wenige
von den Namen sind noch da zu finden, deren
gefällige Bilder nvch etwas von der Genre-
malerei haben, die Düsseldorf einst berühmt
machte. Peter Philippi ist beinahe eine Ku-
riosität geworden mit seinen ganz unmalerisch
glatt gemalten Leuten aus der wohlhabenden
Kleinstadt, die inimer einen kleinen Aug von
säuerlicher Komik haben, als wüßten sie selber,
wie altmodisch sie sind. Diese Wand, behängt
mit lauter peinlich liebevoll gemalten Rari-
täten, wirkt wie eine vergessene Ecke in einer
modernen Stadt in dieser Ausstellung aus dem
Kriegsjahr 1917. Anders ist es mit den Land-
schaftsmalern, die in ihren Vertretern Hardt,
Liesegang, Hermann Otto, Schmurr, Wans-
leben, Westendorp und Kaul eine genieinsame
Note nicht leugnen; die Schule der guten
Holländer des letzten Jahrhunderts und die
Einflüsse der Karlsruher Künstler sind spür-
bar, oder der alte Meister Dücker, aus dessen
Schule eine Reihe von ihnen hervorging. Fast
alle diese Bilder können als geschmackvoll
gelten, zuweilen steigert sich dies zu einer
poetischen Wirkung, aber beinahe nie geht die
Auffassung über die Darstellung eines Natur-
ausschnitts hinaus. Man könnte dies Urteil
noch auf Heinrich Hernianns und Mar Stern
ausdehnen, die ebenfalls mit ihren Jnterieurs
aus Kirchen oder Winkeln einwandfreie Ab-
bilder geben, deren malerische Kunst sich aber
nirgend zu einer Freiheit über die Naturtreue
erhebt. Awei Landschafter möchte ich darum
besonders nennen, einmal Julius Bretz, der
nie vom Naturausschnitt ausgeht; er erreicht
in seineni „Buchenwald im Sommer", in den
„Kleehaufen" und den „Sandbergen" immer,
daß uns das „was" des Bildes ganz gleich-
gültig wird über dem „wie", mit dem es in
Erscheinung tritt. Man niöchte wünschen,
diese Erkenntnisfähigkeit und diese Mittel
würden einmal frei zu Schöpfungen religiösen
Jnhalts im Sinne einer idealen Landschaftsmalerei, von
der dieser Künstler früher zuweilen Anfänge gezeigt hat.
Clarenbach, der ein Virtuose seiner Mittel ist, hat leider
in den Bildern, die er hier zeigt, langst die Grenze über-
schritten, wo Enipfindung und Geschmack sich decken,
seine Landschaften wirken äußerst delikat, schmackhaft,
ist man versucht zu sagen, wie Schaugerichte, die alle
Reize des Gaumens wachrufen, ehe man davon schmeckt.
Doch bei so viel malerischer Delikatesse bleibt man un-
gestillt, die Bilder bleiben ohne Seele und lassen unge-
rührt wie ein hübsches Kunstgewerbe oder eine glanzend
gestimmte Krawattenseide. Es ist betrübend, zu sehen,
daß hier ohne Frage eine große malerische Anlage den
Weg zu ihrem Jnneren nicht findet, oder nicht den
Mut hat ihn zu geben. Hier ist einem ein Pfund gegeben,
der es in kleine Münze umsetzt, statt damit zu arbeiten,
es scheint fast, als habe hier die weiche Luft des Nieder-
rheins den Willen gedampft, wie sie die zu schrillen
Laute und die Farben aufsaugt. Von Wilhelm Schreuer
ist eine wunderfeine Landschaft zu beachten, „Auf der
2Z8
diese Absichten einmal ver eine große wirkliche Aufgabe
gestellt zu sehen, wird gerade bei den letzteren lebhaft,
da solche Proben, die auf beschranktem Raum so viel
beweisen sollen, naturgemaß eine gewisse Überladenheit
bekommen, wie alles, dessen Entwicklungsmöglichkeit
gehemnit ist. Das Damenbildnis von Walter Ophey ist
so sehr entfernt von der gewohnten Art der Bildnis-
malerei, daß die ungeschickten Bemerkungen, die man
davor hören muß, vielleicht begreiflich sind, wenn auch
der, der einmal überhaupt eine Kunstausstellung be-
sucht, so viel Achtung vor dem Schaffen des Künstlers
mitbringen sollte, daß er da schweigt, wo sein Ge-
fühl oder sein Verstand nicht mitgehen. Dies Frauen-
bild hier, das sich ganz frei hält von jeder Her-
kömmlichkeit, ist so sanft belebt von einer innerlichen
Würde des dargestellten Frauenwesens, das ein-
fach, fast ein bißchen streng dasitzt mit gekreuzten
Handen, daß nian sich willig hinnehmen laßt vvn
dieser Harmonie, deren Rhythnien aus Farbe und Linie
so schön geordnet sind.
Von einer Düsseldorfer Schule zu sprechen
im alten Sinn geht nicht mehr an, nur wenige
von den Namen sind noch da zu finden, deren
gefällige Bilder nvch etwas von der Genre-
malerei haben, die Düsseldorf einst berühmt
machte. Peter Philippi ist beinahe eine Ku-
riosität geworden mit seinen ganz unmalerisch
glatt gemalten Leuten aus der wohlhabenden
Kleinstadt, die inimer einen kleinen Aug von
säuerlicher Komik haben, als wüßten sie selber,
wie altmodisch sie sind. Diese Wand, behängt
mit lauter peinlich liebevoll gemalten Rari-
täten, wirkt wie eine vergessene Ecke in einer
modernen Stadt in dieser Ausstellung aus dem
Kriegsjahr 1917. Anders ist es mit den Land-
schaftsmalern, die in ihren Vertretern Hardt,
Liesegang, Hermann Otto, Schmurr, Wans-
leben, Westendorp und Kaul eine genieinsame
Note nicht leugnen; die Schule der guten
Holländer des letzten Jahrhunderts und die
Einflüsse der Karlsruher Künstler sind spür-
bar, oder der alte Meister Dücker, aus dessen
Schule eine Reihe von ihnen hervorging. Fast
alle diese Bilder können als geschmackvoll
gelten, zuweilen steigert sich dies zu einer
poetischen Wirkung, aber beinahe nie geht die
Auffassung über die Darstellung eines Natur-
ausschnitts hinaus. Man könnte dies Urteil
noch auf Heinrich Hernianns und Mar Stern
ausdehnen, die ebenfalls mit ihren Jnterieurs
aus Kirchen oder Winkeln einwandfreie Ab-
bilder geben, deren malerische Kunst sich aber
nirgend zu einer Freiheit über die Naturtreue
erhebt. Awei Landschafter möchte ich darum
besonders nennen, einmal Julius Bretz, der
nie vom Naturausschnitt ausgeht; er erreicht
in seineni „Buchenwald im Sommer", in den
„Kleehaufen" und den „Sandbergen" immer,
daß uns das „was" des Bildes ganz gleich-
gültig wird über dem „wie", mit dem es in
Erscheinung tritt. Man niöchte wünschen,
diese Erkenntnisfähigkeit und diese Mittel
würden einmal frei zu Schöpfungen religiösen
Jnhalts im Sinne einer idealen Landschaftsmalerei, von
der dieser Künstler früher zuweilen Anfänge gezeigt hat.
Clarenbach, der ein Virtuose seiner Mittel ist, hat leider
in den Bildern, die er hier zeigt, langst die Grenze über-
schritten, wo Enipfindung und Geschmack sich decken,
seine Landschaften wirken äußerst delikat, schmackhaft,
ist man versucht zu sagen, wie Schaugerichte, die alle
Reize des Gaumens wachrufen, ehe man davon schmeckt.
Doch bei so viel malerischer Delikatesse bleibt man un-
gestillt, die Bilder bleiben ohne Seele und lassen unge-
rührt wie ein hübsches Kunstgewerbe oder eine glanzend
gestimmte Krawattenseide. Es ist betrübend, zu sehen,
daß hier ohne Frage eine große malerische Anlage den
Weg zu ihrem Jnneren nicht findet, oder nicht den
Mut hat ihn zu geben. Hier ist einem ein Pfund gegeben,
der es in kleine Münze umsetzt, statt damit zu arbeiten,
es scheint fast, als habe hier die weiche Luft des Nieder-
rheins den Willen gedampft, wie sie die zu schrillen
Laute und die Farben aufsaugt. Von Wilhelm Schreuer
ist eine wunderfeine Landschaft zu beachten, „Auf der
2Z8