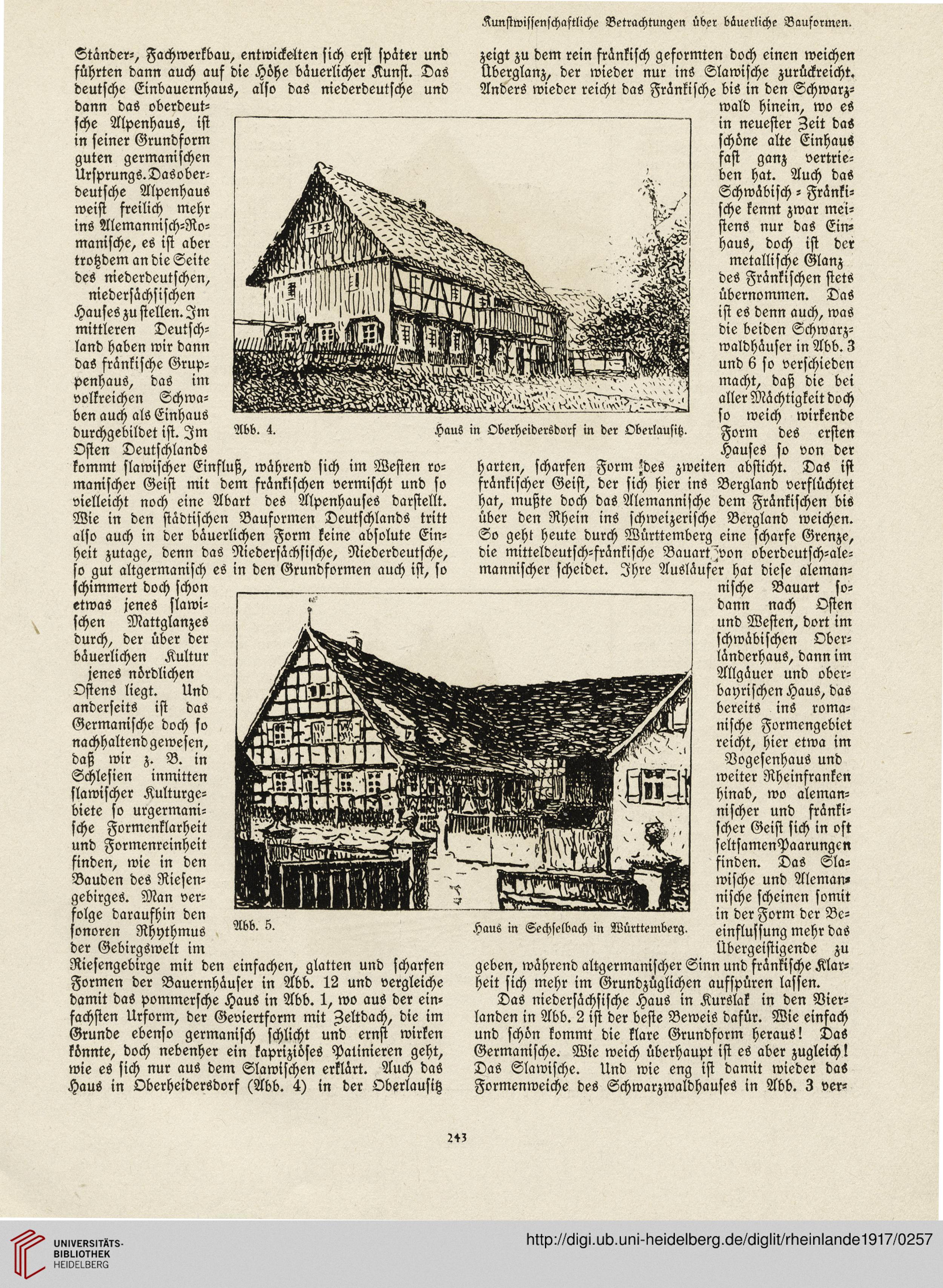Aunstwissenschaftliche Betrachtungen über bäuerliche Bauformen.
Stander-, Fachwerkbau, entwickelten sich erst später und
führten dann auch auf die Höhe bäuerlicher Kunst. Das
deutsche Einbauernhaus, also das niederdeutsche und
dann das oberdeut-
sche Alpenhaus, ist
in seiner Grundform
guten germanischen
Ursprungs.Dasober-
deutsche Alpenhaus
weist freilich mehr
ins Alemannisch-Ro-
manische, es ist aber
trotzdem andieSeite
des niederdeutschen,
niedersächsischen
Hauses zustellen.Jm
mittleren Deutsch-
land haben wir dann
daS fränkische Grup-
penhaus, das im
volkreichen Schwa-
ben auch als Einhaus
durchgebildet ist. Jm
Osten Deutschlands
kommt slawischer Einfluß, während sich im Westen ro-
manischer Geist mit dem fränkischen vermischt und so
vielleicht noch eine Abart des Alpenhauses darstellt.
Wie in den städtischen Bauformen Deutschlands tritt
also auch in der bäuerlichen Form keine absolute Ein-
heit zutage, denn das Niedersächsische, Niederdeutsche,
so gut altgermanisch es in den Grundformen auch ist, so
schimmert doch schon
etwas jenes slawi-
schen Mattglanzes
durch, der über der
bäuerlichen Kultur
jenes nördlichen
Ostens liegt. Und
anderseits ist das
Germanische doch so
nachhaltendgewesen,
daß wir z. B. in
Schlesien inmitten
slawischer Kulturge-
biete so urgermani-
sche Formenklarheit
und Formenreinheit
finden, wie in den
Bauden des Riesen-
gebirges. Man ver-
folge daraufhin den
sonoren Rhythmus
der Gebirgswelt im
Riesengebirge mit den einfachen, glatten und scharfen
Formen der Bauernhäuser in Abb. 12 und vergleiche
damit das pommersche HauS in Abb. 1, wo auS der ein-
fachsten Urform, der Geviertform mit Aeltdach, die im
Grunde ebenso germanisch schlicht und ernst wirken
könnte, doch nebenher ein kapriziöses Patinieren geht,
wie es sich nur aus dem Slawischen erklärt. Auch das
Haus in Oberheidersdorf (Abb. 4) in der Oberlausitz
zeigt zu dem rein fränkisch geformten doch einen weichen
überglanz, der wieder nur ins Slawische zurückreicht.
Anders wieder reicht das Fränkische bis in den Schwarz-
wald hinein, wo es
in neuester Ieit daS
schöne alte Einhauü
fast ganz vertrie-
ben hat. Auch das
Schwäbisch - Fränki-
sche kennt zwar mei-
stens nur das Ein-
haus, doch ist der
metallische Glanz
des Fränkischen stets
übernommen. Das
ist es denn auch, was
die beiden Schwarz-
waldhäuser in Abb. 3
und 6 so verschieden
macht, daß die bei
allerMächtigkeitdoch
so weich wirkende
Form des ersten
Hauses so von der
harten, scharfen Form?des zweiten absticht. DaS ist
fränkischer Geist, der sich hier ins Bergland verflüchtet
hat, mußte doch das Alemannische dem Fränkischen bis
über den Rhein ins schweizerische Bergland weichen.
So geht heute durch Württemberg eine scharfe Grenze,
die mitteldeutsch-fränkische Bauart won oberdeutsch-ale-
mannischer scheidet. Jhre Ausläufer hat diese aleman-
nische Bauart so-
dann nach Osten
und Westen, dort im
schwäbischen Ober-
länderhaus, dann im
Allgäuer und ober-
bayrischenHaus, das
bereits ins roma-
nische Formengebiet
reicht, hier etwa im
Vogesenhaus und
weiter Rheinfranken
hinab, wo aleman-
nischer und fränki-
scher Geist sich in ost
seltsamenPaarungcn
finden. Das Sla-
wische und Aleman«
nische scheinen somit
in der Form der Be-
einflussung mehrdas
Ubergeistigende zu
geben, während altgermanischer Sinn und fränkische Klar-
heit sich mehr im Grundzüglichen aufspüren lassen.
Das niedersächsische Haus in Kurslak in den Vier-
landen in Abb. 2 ist der beste Beweis dafür. Wie einfach
und schön kommt die klare Grundform heraus! DaS
Germanische. Wie weich überhaupt ist es aber zugleich l
Das Slawische. Und wie eng ist damit wieder daü
Formenweiche des Schwarzwaldhauses in Abb. 3 ver-
Abb. 4.
Haus in Oberheidersdorf in der Oberlausih.
Abb. 5. Haus in Sechselbach in Württemberg.
Stander-, Fachwerkbau, entwickelten sich erst später und
führten dann auch auf die Höhe bäuerlicher Kunst. Das
deutsche Einbauernhaus, also das niederdeutsche und
dann das oberdeut-
sche Alpenhaus, ist
in seiner Grundform
guten germanischen
Ursprungs.Dasober-
deutsche Alpenhaus
weist freilich mehr
ins Alemannisch-Ro-
manische, es ist aber
trotzdem andieSeite
des niederdeutschen,
niedersächsischen
Hauses zustellen.Jm
mittleren Deutsch-
land haben wir dann
daS fränkische Grup-
penhaus, das im
volkreichen Schwa-
ben auch als Einhaus
durchgebildet ist. Jm
Osten Deutschlands
kommt slawischer Einfluß, während sich im Westen ro-
manischer Geist mit dem fränkischen vermischt und so
vielleicht noch eine Abart des Alpenhauses darstellt.
Wie in den städtischen Bauformen Deutschlands tritt
also auch in der bäuerlichen Form keine absolute Ein-
heit zutage, denn das Niedersächsische, Niederdeutsche,
so gut altgermanisch es in den Grundformen auch ist, so
schimmert doch schon
etwas jenes slawi-
schen Mattglanzes
durch, der über der
bäuerlichen Kultur
jenes nördlichen
Ostens liegt. Und
anderseits ist das
Germanische doch so
nachhaltendgewesen,
daß wir z. B. in
Schlesien inmitten
slawischer Kulturge-
biete so urgermani-
sche Formenklarheit
und Formenreinheit
finden, wie in den
Bauden des Riesen-
gebirges. Man ver-
folge daraufhin den
sonoren Rhythmus
der Gebirgswelt im
Riesengebirge mit den einfachen, glatten und scharfen
Formen der Bauernhäuser in Abb. 12 und vergleiche
damit das pommersche HauS in Abb. 1, wo auS der ein-
fachsten Urform, der Geviertform mit Aeltdach, die im
Grunde ebenso germanisch schlicht und ernst wirken
könnte, doch nebenher ein kapriziöses Patinieren geht,
wie es sich nur aus dem Slawischen erklärt. Auch das
Haus in Oberheidersdorf (Abb. 4) in der Oberlausitz
zeigt zu dem rein fränkisch geformten doch einen weichen
überglanz, der wieder nur ins Slawische zurückreicht.
Anders wieder reicht das Fränkische bis in den Schwarz-
wald hinein, wo es
in neuester Ieit daS
schöne alte Einhauü
fast ganz vertrie-
ben hat. Auch das
Schwäbisch - Fränki-
sche kennt zwar mei-
stens nur das Ein-
haus, doch ist der
metallische Glanz
des Fränkischen stets
übernommen. Das
ist es denn auch, was
die beiden Schwarz-
waldhäuser in Abb. 3
und 6 so verschieden
macht, daß die bei
allerMächtigkeitdoch
so weich wirkende
Form des ersten
Hauses so von der
harten, scharfen Form?des zweiten absticht. DaS ist
fränkischer Geist, der sich hier ins Bergland verflüchtet
hat, mußte doch das Alemannische dem Fränkischen bis
über den Rhein ins schweizerische Bergland weichen.
So geht heute durch Württemberg eine scharfe Grenze,
die mitteldeutsch-fränkische Bauart won oberdeutsch-ale-
mannischer scheidet. Jhre Ausläufer hat diese aleman-
nische Bauart so-
dann nach Osten
und Westen, dort im
schwäbischen Ober-
länderhaus, dann im
Allgäuer und ober-
bayrischenHaus, das
bereits ins roma-
nische Formengebiet
reicht, hier etwa im
Vogesenhaus und
weiter Rheinfranken
hinab, wo aleman-
nischer und fränki-
scher Geist sich in ost
seltsamenPaarungcn
finden. Das Sla-
wische und Aleman«
nische scheinen somit
in der Form der Be-
einflussung mehrdas
Ubergeistigende zu
geben, während altgermanischer Sinn und fränkische Klar-
heit sich mehr im Grundzüglichen aufspüren lassen.
Das niedersächsische Haus in Kurslak in den Vier-
landen in Abb. 2 ist der beste Beweis dafür. Wie einfach
und schön kommt die klare Grundform heraus! DaS
Germanische. Wie weich überhaupt ist es aber zugleich l
Das Slawische. Und wie eng ist damit wieder daü
Formenweiche des Schwarzwaldhauses in Abb. 3 ver-
Abb. 4.
Haus in Oberheidersdorf in der Oberlausih.
Abb. 5. Haus in Sechselbach in Württemberg.