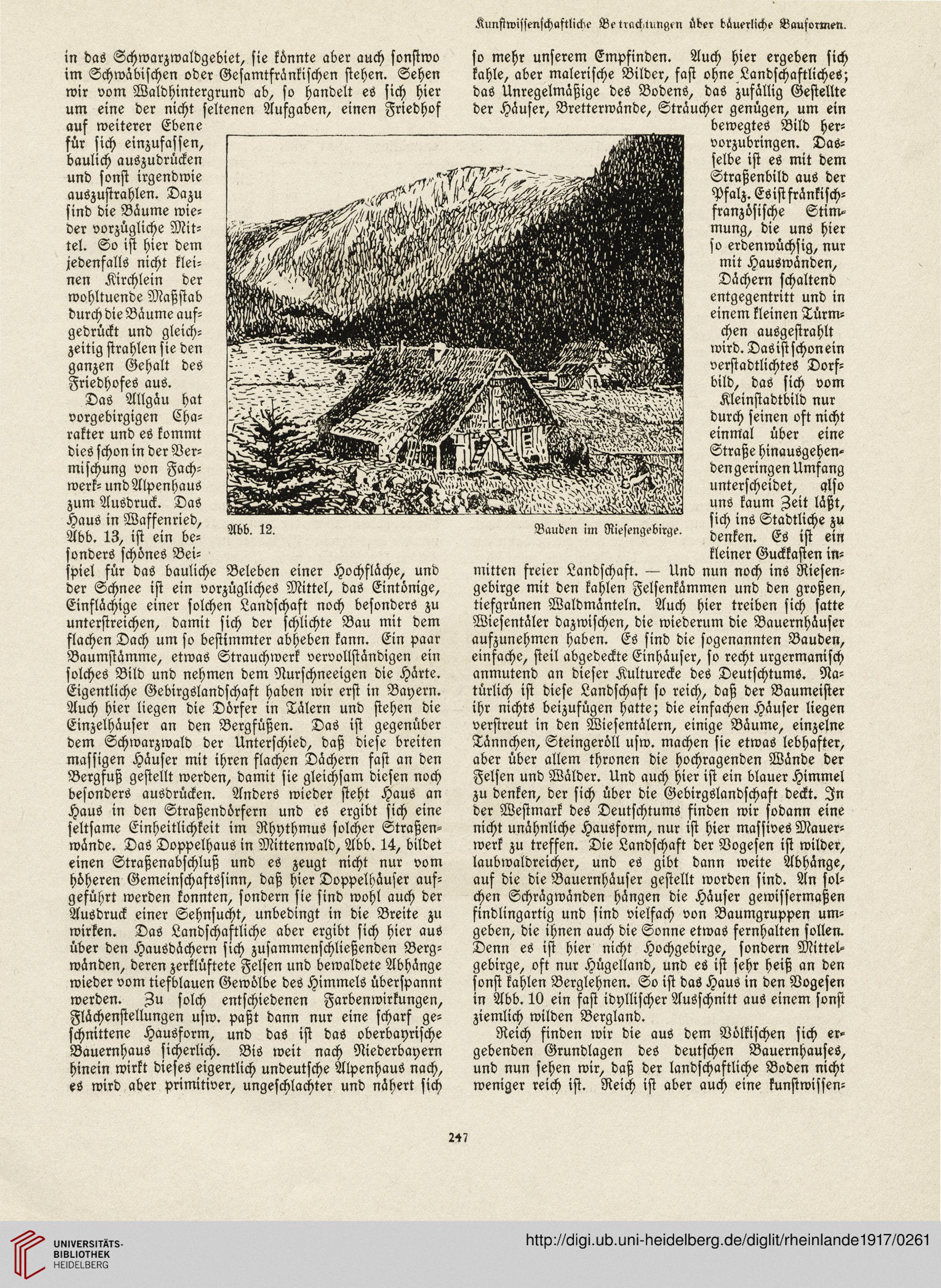in das Schwarzwaldgebiet, sie könnte aber auch sonstwo
im Schwäbischen oder Gesamtfränkischen stehen. Sehen
wir vom Waldhintergrund ab, so handelt es sich hier
um eine der nicht seltenen Aufgaben, einen Friedhof
auf weiterer Ebene
für sich einzusassen,
baulich auszudrücken
und sonst irgendwie
auszustrahlen. Dazu
sind die Bäume wie-
der vorzügliche Mit-
tel. So ist hier dem
jedenfalls nicht klei-
nen Kirchlein der
wohltuende Maßstab
durchdieBäumeauf-
gedrückt und gleich-
zeitig strahlen sie den
ganzen Gehalt des
Friedhofes aus.
Das Allgäu hat
vorgebirgigen Cha-
rakter und es kommt
dies schoninderVer-
mischung von Fach-
werk- undAlpenhaus
zum Ausdruck. Das
Hauö in Waffenried,
Abb. 13, ist ein be-
sonders schönes Bei-
spiel für das bauliche Beleben einer Hochfläche, und
der Schnee ist ein vorzügliches Mittel, das Eintönige,
Einflächige einer solchen Landschaft noch besonders zu
unterstreichen, damit sich der schlichte Bau mit dem
flachen Dach um so bestimmter abheben kann. Ein paar
Baumstämme, etwas Strauchwerk vervollständigen ein
solches Bild und nehmen dem Nurschneeigen die Härte.
Eigentliche Gebirgslandschaft haben wir erst in Bayern.
Auch hier liegen die Dörfer in Tälern und stehen die
Einzelhäuser an den Bergfüßen. Das ist gegenüber
dem Schwarzwald der Unterschied, daß diese breiten
massigen Häuser mit ihren flachen Dächern fast an den
Bergfuß gestellt werden, damit sie gleichsam diesen noch
besonders ausdrücken. Anders wieder steht Haus an
Haus in den Straßendörfern und es ergibt sich eine
seltsame Einheitlichkeit im Rhythmus solcher Straßen-
wände. Das Doppelhaus in Mittenwald, Abb. 14, bildet
einen Straßenabschluß und es zeugt nicht nur vom
höheren Gemeinschaftssinn, daß hier Doppelhäuser auf-
geführt werden konnten, sondern sie sind wohl auch der
Ausdruck einer Sehnsucht, unbedingt in die Breite zu
wirken. Das Landschaftliche aber ergibt sich hier aus
über den Hausdächern sich zusammenschließenden Berg-
wänden, deren zerklüftete Felsen und bewaldete Abhänge
wieder vom tiefblauen Gewölbe des Himmels überspannt
werden. Zu solch entschiedenen Farbenwirkungen,
Flächenstellungen usw. paßt dann nur eine scharf ge-
schnittene Hausform, und das ist das oberbayrische
Bauernhaus sicherlich. Bis weit nach Niederbayern
hinein wirkt dieses eigentlich undeutsche Alpenhaus nach,
es wird aber primitiver, ungeschlachter und nähert sich
Kunstwissenschaftlicbe Betrncklungen über bäuerliche Bausonnen.
so mehr unserem Empfinden. Auch hier ergeben sich
kahle, aber malerische Bilder, fast ohne Landschaftliches;
das Unregelmäßige des Bodens, das zufällig Gestellte
der Häuser, Bretterwände, Sträucher genügen, um ein
bewegteS Bild her-
vorzubringen. Das-
selbe ist es mit dem
Straßenbild aus der
Pfalz. Esistfränkisch-
französische Stim-
mung, die uns hier
so erdenwüchsig, nur
mit Hauswänden,
Dächern schaltend
entgegentritt und in
einem kleinen Türm-
chen ausgestrahlt
wird. Dasistschonein
verstadtlichteö Dorf-
bild, das sich vom
Kleinstadtbild nur
durch seinen oft nicht
einmal über eine
Straße hinausgehen-
dengeringenUmfang
unterscheidet, also
uns kaum Ieit läßt,
sich ins Stadtliche zu
denken. Es ist ein
kleiner Guckkasten in-
nritten freier Landschaft. — Und nun noch ins Riesen-
gebirge mit den kahlen Felsenkämmen und den großen,
tiefgrünen Waldmänteln. Auch hier treiben sich satte
Wiesentäler dazwischen, die wiederum die Bauernhäuser
aufzunehmen haben. Es sind die sogenannten Bauden,
einfache, steil abgedeckte Einhäuser, so recht urgermanisch
anmutend an dieser Kulturecke des Deutschtums. Na-
türlich ist diese Landschaft so reich, daß der Baumeister
ihr nichts beizufügen hatte; die einfachen Häuser liegen
verstreut in den Wiesentälern, einige Bäume, einzelne
Tännchen, Steingeröll usw. machen sie etwas lebhafter,
aber über allem thronen die hochragenden Wände der
Felsen und Wälder. Und auch hier ist ein blauer Himmel
zu denken, der sich über die Gebirgslandschaft deckt. Jn
der Westmark des Deutschtums finden wir sodann eine
nicht unähnliche Hausform, nur ist hier massives Mauer-
werk zu treffen. Die Landschaft der Vogesen ist wilder,
laubwaldreicher, und es gibt dann weite Abhänge,
auf die die Bauernhäuser gestellt worden sind. An sol-
chen Schrägwänden hängen die Häuser gewissermaßen
findlingartig und sind vielfach von Baumgruppen um-
geben, die ihnen auch die Sonne etwas fernhalten sollen.
Denn es ist hier nicht Hochgebirge, sondern Mittel-
gebirge, oft nur Hügelland, und es ist sehr heiß an den
sonst kahlen Berglehnen. So ist das Haus in den Vogesen
in Abb. 10 ein fast idyllischer Ausschnitt aus einem sonst
ziemlich wilden Bergland.
Reich finden wir die aus dem Völkischen sich er-
gebenden Grundlagen des deutschen Bauernhauses,
und nun sehen wir, daß der landschaftliche Boden nicht
weniger reich ist. Reich ist aber auch eine kunstwissen-
Abb. 18. Bauden im Riesengebirge.
247
im Schwäbischen oder Gesamtfränkischen stehen. Sehen
wir vom Waldhintergrund ab, so handelt es sich hier
um eine der nicht seltenen Aufgaben, einen Friedhof
auf weiterer Ebene
für sich einzusassen,
baulich auszudrücken
und sonst irgendwie
auszustrahlen. Dazu
sind die Bäume wie-
der vorzügliche Mit-
tel. So ist hier dem
jedenfalls nicht klei-
nen Kirchlein der
wohltuende Maßstab
durchdieBäumeauf-
gedrückt und gleich-
zeitig strahlen sie den
ganzen Gehalt des
Friedhofes aus.
Das Allgäu hat
vorgebirgigen Cha-
rakter und es kommt
dies schoninderVer-
mischung von Fach-
werk- undAlpenhaus
zum Ausdruck. Das
Hauö in Waffenried,
Abb. 13, ist ein be-
sonders schönes Bei-
spiel für das bauliche Beleben einer Hochfläche, und
der Schnee ist ein vorzügliches Mittel, das Eintönige,
Einflächige einer solchen Landschaft noch besonders zu
unterstreichen, damit sich der schlichte Bau mit dem
flachen Dach um so bestimmter abheben kann. Ein paar
Baumstämme, etwas Strauchwerk vervollständigen ein
solches Bild und nehmen dem Nurschneeigen die Härte.
Eigentliche Gebirgslandschaft haben wir erst in Bayern.
Auch hier liegen die Dörfer in Tälern und stehen die
Einzelhäuser an den Bergfüßen. Das ist gegenüber
dem Schwarzwald der Unterschied, daß diese breiten
massigen Häuser mit ihren flachen Dächern fast an den
Bergfuß gestellt werden, damit sie gleichsam diesen noch
besonders ausdrücken. Anders wieder steht Haus an
Haus in den Straßendörfern und es ergibt sich eine
seltsame Einheitlichkeit im Rhythmus solcher Straßen-
wände. Das Doppelhaus in Mittenwald, Abb. 14, bildet
einen Straßenabschluß und es zeugt nicht nur vom
höheren Gemeinschaftssinn, daß hier Doppelhäuser auf-
geführt werden konnten, sondern sie sind wohl auch der
Ausdruck einer Sehnsucht, unbedingt in die Breite zu
wirken. Das Landschaftliche aber ergibt sich hier aus
über den Hausdächern sich zusammenschließenden Berg-
wänden, deren zerklüftete Felsen und bewaldete Abhänge
wieder vom tiefblauen Gewölbe des Himmels überspannt
werden. Zu solch entschiedenen Farbenwirkungen,
Flächenstellungen usw. paßt dann nur eine scharf ge-
schnittene Hausform, und das ist das oberbayrische
Bauernhaus sicherlich. Bis weit nach Niederbayern
hinein wirkt dieses eigentlich undeutsche Alpenhaus nach,
es wird aber primitiver, ungeschlachter und nähert sich
Kunstwissenschaftlicbe Betrncklungen über bäuerliche Bausonnen.
so mehr unserem Empfinden. Auch hier ergeben sich
kahle, aber malerische Bilder, fast ohne Landschaftliches;
das Unregelmäßige des Bodens, das zufällig Gestellte
der Häuser, Bretterwände, Sträucher genügen, um ein
bewegteS Bild her-
vorzubringen. Das-
selbe ist es mit dem
Straßenbild aus der
Pfalz. Esistfränkisch-
französische Stim-
mung, die uns hier
so erdenwüchsig, nur
mit Hauswänden,
Dächern schaltend
entgegentritt und in
einem kleinen Türm-
chen ausgestrahlt
wird. Dasistschonein
verstadtlichteö Dorf-
bild, das sich vom
Kleinstadtbild nur
durch seinen oft nicht
einmal über eine
Straße hinausgehen-
dengeringenUmfang
unterscheidet, also
uns kaum Ieit läßt,
sich ins Stadtliche zu
denken. Es ist ein
kleiner Guckkasten in-
nritten freier Landschaft. — Und nun noch ins Riesen-
gebirge mit den kahlen Felsenkämmen und den großen,
tiefgrünen Waldmänteln. Auch hier treiben sich satte
Wiesentäler dazwischen, die wiederum die Bauernhäuser
aufzunehmen haben. Es sind die sogenannten Bauden,
einfache, steil abgedeckte Einhäuser, so recht urgermanisch
anmutend an dieser Kulturecke des Deutschtums. Na-
türlich ist diese Landschaft so reich, daß der Baumeister
ihr nichts beizufügen hatte; die einfachen Häuser liegen
verstreut in den Wiesentälern, einige Bäume, einzelne
Tännchen, Steingeröll usw. machen sie etwas lebhafter,
aber über allem thronen die hochragenden Wände der
Felsen und Wälder. Und auch hier ist ein blauer Himmel
zu denken, der sich über die Gebirgslandschaft deckt. Jn
der Westmark des Deutschtums finden wir sodann eine
nicht unähnliche Hausform, nur ist hier massives Mauer-
werk zu treffen. Die Landschaft der Vogesen ist wilder,
laubwaldreicher, und es gibt dann weite Abhänge,
auf die die Bauernhäuser gestellt worden sind. An sol-
chen Schrägwänden hängen die Häuser gewissermaßen
findlingartig und sind vielfach von Baumgruppen um-
geben, die ihnen auch die Sonne etwas fernhalten sollen.
Denn es ist hier nicht Hochgebirge, sondern Mittel-
gebirge, oft nur Hügelland, und es ist sehr heiß an den
sonst kahlen Berglehnen. So ist das Haus in den Vogesen
in Abb. 10 ein fast idyllischer Ausschnitt aus einem sonst
ziemlich wilden Bergland.
Reich finden wir die aus dem Völkischen sich er-
gebenden Grundlagen des deutschen Bauernhauses,
und nun sehen wir, daß der landschaftliche Boden nicht
weniger reich ist. Reich ist aber auch eine kunstwissen-
Abb. 18. Bauden im Riesengebirge.
247