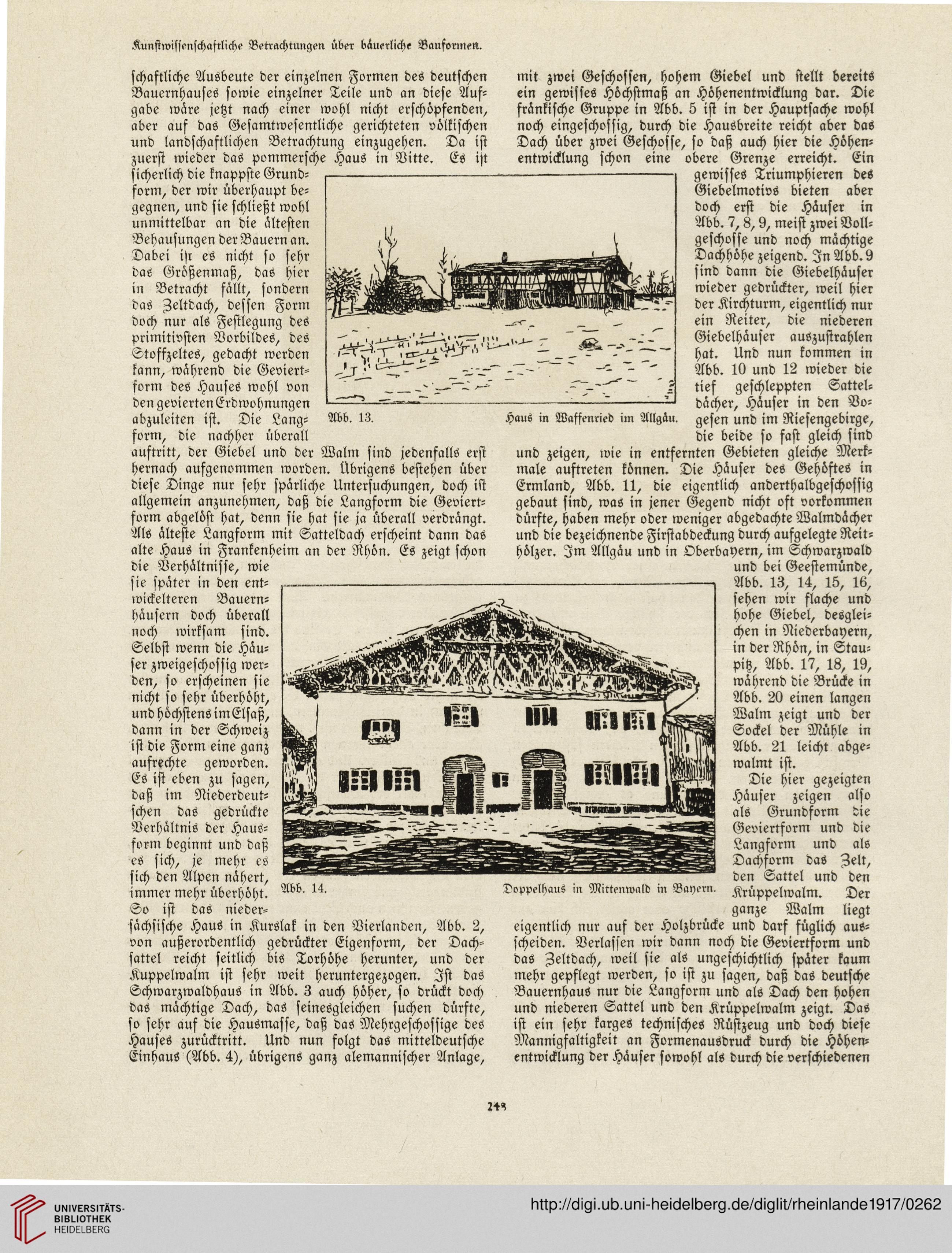Kmifiivisi'enschaftlich? Betrachtungen über bäuerliche Bauformen.
schastliche Ausbeute der einzelnen Formen des deutschen
Bauernhauses sowie einzelner Teile und an diese Aus-
gabe lväre jetzt nach einer wohl nicht erschöpfenden,
aber auf das Gesamtwesentliche gerichteten völkischen
und landschaftlichen Betrachtung einzugehen. Da ist
zuerst wieder das pommersche Haus in Vitte. Es ijt
sicherlich die knappste Grund-
form, der wir überhaupt be-
gegnen, und sie schließt wohl
unmittelbar an die ältesten
Behausungen der Bauern an.
Dabei ist es nicht so sehr
das Größenmaß, das hier
in Betracht fällt, sondern
das Ieltdach, dessen Form
doch nur als Festlegung des
primitivsten Vorbildes, des
Stoffzeltes, gedacht werden
kann, während die Geviert-
form deö Hauses wohl von
den gevierten Erdwvhnungen
abzuleiten ist. Die Lang-
form, die nachher überall
auftritt, der Giebel und der Walm sind jedenfalls erst
hernach aufgenommen worden. ltbrigens bestehen über
diese Dinge nur sehr spärliche Untersuchungen, doch iü
allgemein anzunehmen, daß die Langform die Geviert-
form abgelöft hat, denn sie hat sie ja überall verdrängt.
Als älteste Langform mit Satteldach erscheint dann das
alte Haus in Frankenheim an der Rhön. Es zeigt schon
die Verhältnisse, wie
sie später in den ent-
wickelteren Bauern-
häusern doch überall
noch wirksam sind.
Selbst wenn die Häu-
ser zweigeschossig wer-
den, so erscheinen sie
nicht so sehr überhöht,
und höchstens imElsaß,
dann in der Schweiz
ist die Form eine ganz
aufrechte geworden.
Es ist eben zu sagen,
daß im Niederdeut-
schen das gedrückte
Verhältnis der Haus-
form beginnt und daß
eö sich, je mehr es
sich den Alpen nähert,
immer mehr überhöht.
So ist das nieder-
sächsische Haus in Kurstak in den Vierlanden, Abb. 2,
von außerordentlich gedrückter Eigenform, der Dach-
sattel reicht seitlich bis Torhöhe herunter, und der
Kuppelwalm ist sehr weit heruntergezogen. Jst das
Schwarzwaldhaus in Abb. 3 auch höher, so drückt doch
das mächtige Dach, das seinesgleichen suchen dürfte,
so sehr auf die Hausmasse, daß das Mehrgeschossige des
Hauses zurücktritt. Und nun folgt das mitteldeutsche
Einhaus (Abb. 4), übrigens ganz alemannischer Anlage,
mit zwei Geschossen, hohem Giebel und stellt bereits
ein gewisses Höchstmaß an Höhenentwicklung dar. Die
fränkische Gruppe in Abb. 5 ist in der Hauptsache wohl
noch eingeschossig, durch die Hausbreite reicht aber das
Dach über zwei Geschosse, so daß auch hier die Höhen-
entwicklung schon eine obere Grenze erreicht. Ein
gewisses Triumphieren des
Giebelmotivs bieten aber
doch erst die Häuser in
Abb. 7,8,9, meist zwei Voll-
geschofse und noch mächtige
Dachhöhe zeigend. Jn Abb.9
sind dann die Giebelhäuser
wieder gedrückter, weil hier
der Kirchturm, eigentlich nur
ein Reiter, die niederen
Giebelhäuser auszustrahlen
hat. Und nun kommen in
Abb. 10 und 12 wieder die
tief geschleppten Sattel-
dächer, Häuser in den Vo-
gesen und im Riesengebirge,
die beide so faft gleich sind
und zeigen, wie in entfernten Gebieten gleiche Merk-
male auftreten können. Die Häuser des Gehöftes in
Ermland, Abb. 11, die eigentlich anderthalbgeschossig
gebaut sind, was in jener Gegend nicht oft vorkommen
dürfte, haben mehr oder weniger abgedachte Walmdächer
und die bezeichnende Firstabdeckung durch aufgelegte Reit-
hölzer. Jm Allgäu und in Oberbayern, im Schwarzwald
und bei Geestemünde,
Abb. 13, 14, 15, 16,
sehen wir flache und
hohe Giebel, desglei-
chen in Niederbayern,
in der Rhön, in Stau-
pitz, Abb. 17, 18, 19,
während die Brücke in
Abb. 20 einen langen
Walm zeigt und der
Sockel der Mühle in
Abb. 21 leicht abge-
walmt ist.
Die hier gezeigten
Häuser zeigen olso
als Grundform Lie
Geviertform und die
Langform und als
Dachform das Ielt,
den Sattel und den
Krüppelwalm. Der
ganze Walm liegt
eigentlich nur auf der Holzbrücke und darf füglich aus-
scheiden. Verlassen wir dann noch die Geviertform und
das Ieltdach, weil sie als ungeschichtlich später kaum
mehr gepflegt werden, so ist zu sagen, daß das deutsche
Bauernhaus nur die Langform und als Dach den hohen
und niederen Sattel und den Krüppelwalm zeigt. DaS
ist ein sehr karges technisches Rüstzeug und doch diese
Mannigfaltigkeit an Formenausdruck durch die Höhen-
entwicklung der Häuser sowohl als durch die verschiedenen
Abb. 13. Haus in Waffenried im Allgäu.
Abb. 14. Doppelhans in Mittenwald in Bayern.
schastliche Ausbeute der einzelnen Formen des deutschen
Bauernhauses sowie einzelner Teile und an diese Aus-
gabe lväre jetzt nach einer wohl nicht erschöpfenden,
aber auf das Gesamtwesentliche gerichteten völkischen
und landschaftlichen Betrachtung einzugehen. Da ist
zuerst wieder das pommersche Haus in Vitte. Es ijt
sicherlich die knappste Grund-
form, der wir überhaupt be-
gegnen, und sie schließt wohl
unmittelbar an die ältesten
Behausungen der Bauern an.
Dabei ist es nicht so sehr
das Größenmaß, das hier
in Betracht fällt, sondern
das Ieltdach, dessen Form
doch nur als Festlegung des
primitivsten Vorbildes, des
Stoffzeltes, gedacht werden
kann, während die Geviert-
form deö Hauses wohl von
den gevierten Erdwvhnungen
abzuleiten ist. Die Lang-
form, die nachher überall
auftritt, der Giebel und der Walm sind jedenfalls erst
hernach aufgenommen worden. ltbrigens bestehen über
diese Dinge nur sehr spärliche Untersuchungen, doch iü
allgemein anzunehmen, daß die Langform die Geviert-
form abgelöft hat, denn sie hat sie ja überall verdrängt.
Als älteste Langform mit Satteldach erscheint dann das
alte Haus in Frankenheim an der Rhön. Es zeigt schon
die Verhältnisse, wie
sie später in den ent-
wickelteren Bauern-
häusern doch überall
noch wirksam sind.
Selbst wenn die Häu-
ser zweigeschossig wer-
den, so erscheinen sie
nicht so sehr überhöht,
und höchstens imElsaß,
dann in der Schweiz
ist die Form eine ganz
aufrechte geworden.
Es ist eben zu sagen,
daß im Niederdeut-
schen das gedrückte
Verhältnis der Haus-
form beginnt und daß
eö sich, je mehr es
sich den Alpen nähert,
immer mehr überhöht.
So ist das nieder-
sächsische Haus in Kurstak in den Vierlanden, Abb. 2,
von außerordentlich gedrückter Eigenform, der Dach-
sattel reicht seitlich bis Torhöhe herunter, und der
Kuppelwalm ist sehr weit heruntergezogen. Jst das
Schwarzwaldhaus in Abb. 3 auch höher, so drückt doch
das mächtige Dach, das seinesgleichen suchen dürfte,
so sehr auf die Hausmasse, daß das Mehrgeschossige des
Hauses zurücktritt. Und nun folgt das mitteldeutsche
Einhaus (Abb. 4), übrigens ganz alemannischer Anlage,
mit zwei Geschossen, hohem Giebel und stellt bereits
ein gewisses Höchstmaß an Höhenentwicklung dar. Die
fränkische Gruppe in Abb. 5 ist in der Hauptsache wohl
noch eingeschossig, durch die Hausbreite reicht aber das
Dach über zwei Geschosse, so daß auch hier die Höhen-
entwicklung schon eine obere Grenze erreicht. Ein
gewisses Triumphieren des
Giebelmotivs bieten aber
doch erst die Häuser in
Abb. 7,8,9, meist zwei Voll-
geschofse und noch mächtige
Dachhöhe zeigend. Jn Abb.9
sind dann die Giebelhäuser
wieder gedrückter, weil hier
der Kirchturm, eigentlich nur
ein Reiter, die niederen
Giebelhäuser auszustrahlen
hat. Und nun kommen in
Abb. 10 und 12 wieder die
tief geschleppten Sattel-
dächer, Häuser in den Vo-
gesen und im Riesengebirge,
die beide so faft gleich sind
und zeigen, wie in entfernten Gebieten gleiche Merk-
male auftreten können. Die Häuser des Gehöftes in
Ermland, Abb. 11, die eigentlich anderthalbgeschossig
gebaut sind, was in jener Gegend nicht oft vorkommen
dürfte, haben mehr oder weniger abgedachte Walmdächer
und die bezeichnende Firstabdeckung durch aufgelegte Reit-
hölzer. Jm Allgäu und in Oberbayern, im Schwarzwald
und bei Geestemünde,
Abb. 13, 14, 15, 16,
sehen wir flache und
hohe Giebel, desglei-
chen in Niederbayern,
in der Rhön, in Stau-
pitz, Abb. 17, 18, 19,
während die Brücke in
Abb. 20 einen langen
Walm zeigt und der
Sockel der Mühle in
Abb. 21 leicht abge-
walmt ist.
Die hier gezeigten
Häuser zeigen olso
als Grundform Lie
Geviertform und die
Langform und als
Dachform das Ielt,
den Sattel und den
Krüppelwalm. Der
ganze Walm liegt
eigentlich nur auf der Holzbrücke und darf füglich aus-
scheiden. Verlassen wir dann noch die Geviertform und
das Ieltdach, weil sie als ungeschichtlich später kaum
mehr gepflegt werden, so ist zu sagen, daß das deutsche
Bauernhaus nur die Langform und als Dach den hohen
und niederen Sattel und den Krüppelwalm zeigt. DaS
ist ein sehr karges technisches Rüstzeug und doch diese
Mannigfaltigkeit an Formenausdruck durch die Höhen-
entwicklung der Häuser sowohl als durch die verschiedenen
Abb. 13. Haus in Waffenried im Allgäu.
Abb. 14. Doppelhans in Mittenwald in Bayern.