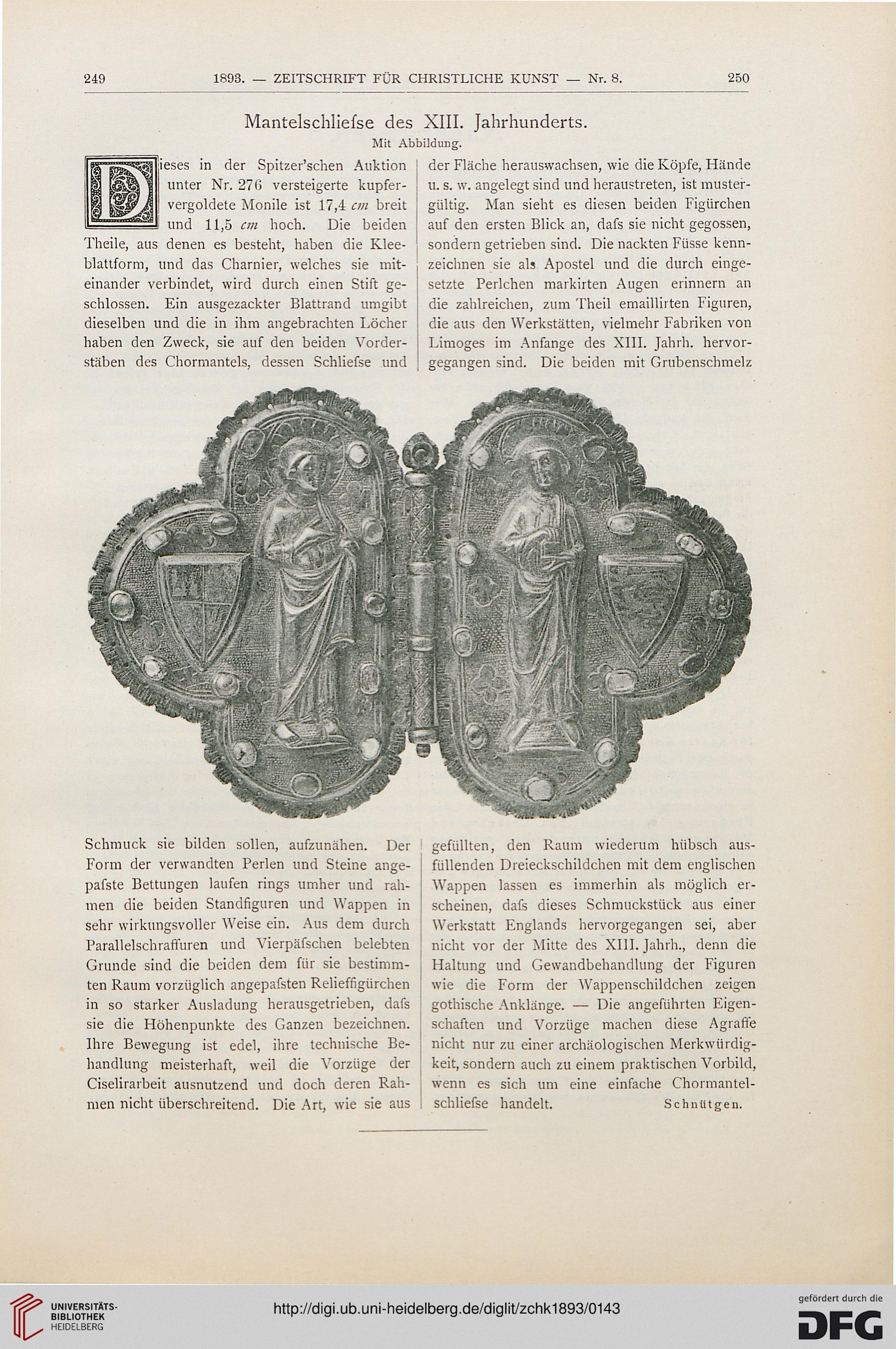249
1S93. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 8.
250
Mantelschliefse des XIII. Jahrhunderts.
Mit Abbildung.
s|T?3>s^i ieses in der Spitzer'schen Auktion
unter Nr. 270 versteigerte kupfer-
vergoldete Monile ist 17,4 cm breit
und 11,5 cm hoch. Die beiden
Theile, aus denen es besteht, haben die Klee-
blattform, und das Charnier, welches sie mit-
einander verbindet, wird durch einen Stift ge-
schlossen. Ein ausgezackter Blattrand umgibt
dieselben und die in ihm angebrachten Löcher
haben den Zweck, sie auf den beiden Vorder-
stäben des Chormantels, dessen Schliefse und
der Fläche herauswachsen, wie die Köpfe, Hände
u. s. w. angelegt sind und heraustreten, ist muster-
gültig. Man sieht es diesen beiden Figürchen
auf den ersten Blick an, dafs sie nicht gegossen,
sondern getrieben sind. Die nackten Füsse kenn-
zeichnen sie als Apostel und die durch einge-
setzte Perlchen markirten Augen erinnern an
die zahlreichen, zum Theil emaillirten Figuren,
die aus den Werkstätten, vielmehr Fabriken von
Limoges im Anfange des XIII. Jahrh. hervor-
gegangen sind. Die beiden mit Grubenschmelz
Schmuck sie bilden sollen, aufzunähen. Der
Form der verwandten Perlen und Steine ange-
pafste Bettungen laufen rings umher und rah-
men die beiden Standfiguren und Wappen in
sehr wirkungsvoller Weise ein. Aus dem durch
Parallelschraffuren und Vierpäfschen belebten
Grunde sind die beiden dem für sie bestimm-
ten Raum vorzüglich angepafsten Relieffigürchen
in so starker Ausladung herausgetrieben, dafs
sie die Höhenpunkte des Ganzen bezeichnen.
Ihre Bewegung ist edel, ihre technische Be-
handlung meisterhaft, weil die Vorzüge der
Ciselirarbeit ausnutzend und doch deren Rah-
men nicht überschreitend. Die Art, wie sie aus
gefüllten, den Raum wiederum hübsch aus-
füllenden Dreieckschildchen mit dem englischen
Wappen lassen es immerhin als möglich er-
scheinen, dafs dieses Schmuckstück aus einer
Werkstatt Englands hervorgegangen sei, aber
nicht vor der Mitte des XIII. Jahrh., denn die
Haltung und Gewandbehandlung der Figuren
wie die Form der Wappenschildchen zeigen
gothische Anklänge. — Die angeführten Eigen-
schaften und Vorzüge machen diese Agraffe
nicht nur zu einer archäologischen Merkwürdig-
keit, sondern auch zu einem praktischen Vorbild,
wenn es sich um eine einfache Chormantel-
schliefse handelt. Schntttgen.
1S93. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 8.
250
Mantelschliefse des XIII. Jahrhunderts.
Mit Abbildung.
s|T?3>s^i ieses in der Spitzer'schen Auktion
unter Nr. 270 versteigerte kupfer-
vergoldete Monile ist 17,4 cm breit
und 11,5 cm hoch. Die beiden
Theile, aus denen es besteht, haben die Klee-
blattform, und das Charnier, welches sie mit-
einander verbindet, wird durch einen Stift ge-
schlossen. Ein ausgezackter Blattrand umgibt
dieselben und die in ihm angebrachten Löcher
haben den Zweck, sie auf den beiden Vorder-
stäben des Chormantels, dessen Schliefse und
der Fläche herauswachsen, wie die Köpfe, Hände
u. s. w. angelegt sind und heraustreten, ist muster-
gültig. Man sieht es diesen beiden Figürchen
auf den ersten Blick an, dafs sie nicht gegossen,
sondern getrieben sind. Die nackten Füsse kenn-
zeichnen sie als Apostel und die durch einge-
setzte Perlchen markirten Augen erinnern an
die zahlreichen, zum Theil emaillirten Figuren,
die aus den Werkstätten, vielmehr Fabriken von
Limoges im Anfange des XIII. Jahrh. hervor-
gegangen sind. Die beiden mit Grubenschmelz
Schmuck sie bilden sollen, aufzunähen. Der
Form der verwandten Perlen und Steine ange-
pafste Bettungen laufen rings umher und rah-
men die beiden Standfiguren und Wappen in
sehr wirkungsvoller Weise ein. Aus dem durch
Parallelschraffuren und Vierpäfschen belebten
Grunde sind die beiden dem für sie bestimm-
ten Raum vorzüglich angepafsten Relieffigürchen
in so starker Ausladung herausgetrieben, dafs
sie die Höhenpunkte des Ganzen bezeichnen.
Ihre Bewegung ist edel, ihre technische Be-
handlung meisterhaft, weil die Vorzüge der
Ciselirarbeit ausnutzend und doch deren Rah-
men nicht überschreitend. Die Art, wie sie aus
gefüllten, den Raum wiederum hübsch aus-
füllenden Dreieckschildchen mit dem englischen
Wappen lassen es immerhin als möglich er-
scheinen, dafs dieses Schmuckstück aus einer
Werkstatt Englands hervorgegangen sei, aber
nicht vor der Mitte des XIII. Jahrh., denn die
Haltung und Gewandbehandlung der Figuren
wie die Form der Wappenschildchen zeigen
gothische Anklänge. — Die angeführten Eigen-
schaften und Vorzüge machen diese Agraffe
nicht nur zu einer archäologischen Merkwürdig-
keit, sondern auch zu einem praktischen Vorbild,
wenn es sich um eine einfache Chormantel-
schliefse handelt. Schntttgen.