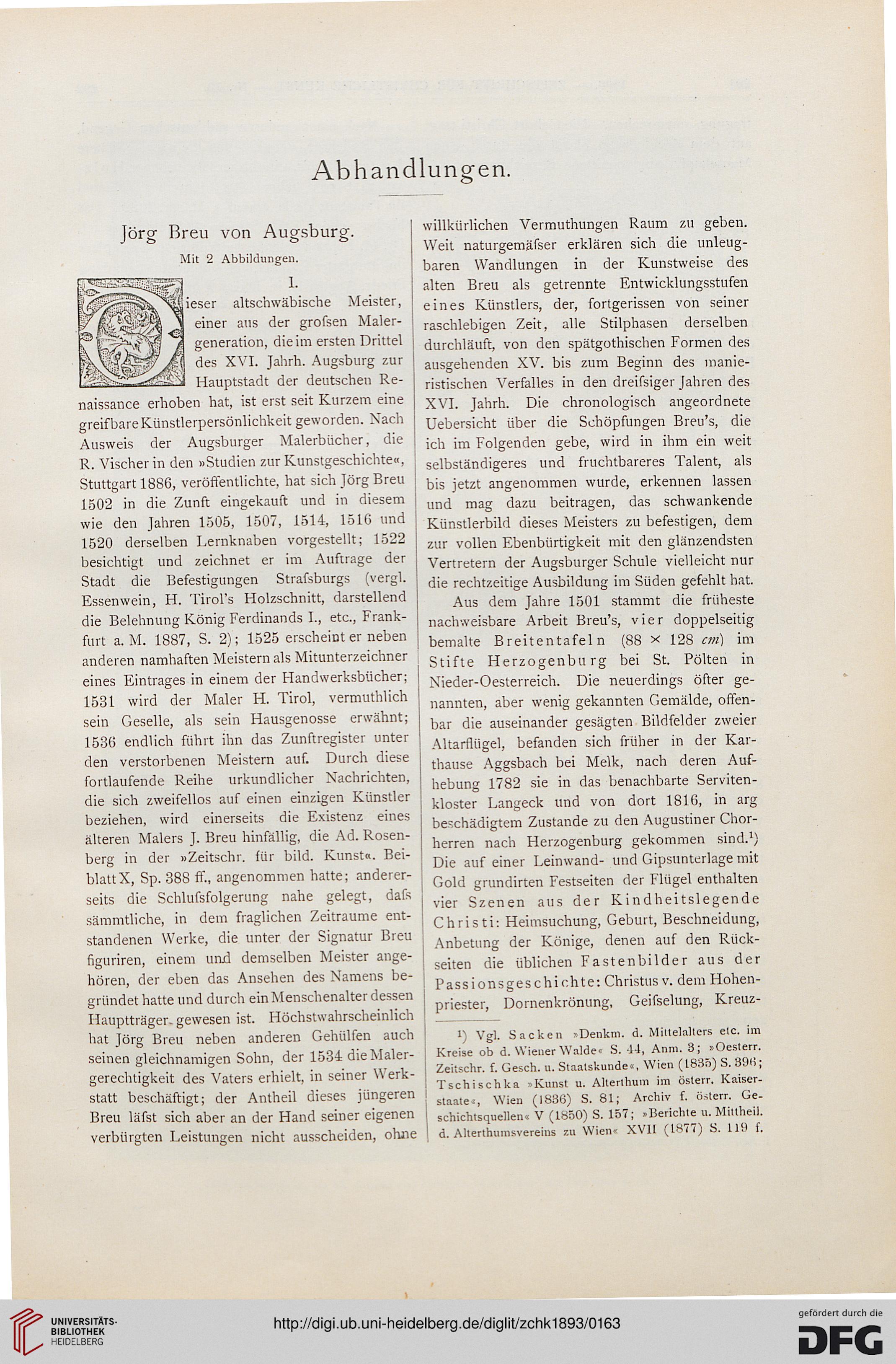Abhandlungen.
Jörg Breu von Augsburg.
Mit 2 Abbildungen.
1.
ieser altschwäbische Meister,
einer aus der grofsen Maler-
generation, die im ersten Drittel
des XVI. Jahrh. Augsburg zur
Hauptstadt der deutschen Re-
naissance erhoben hat, ist erst seit Kurzem eine
greifbare Künstlerpersönlichkeit geworden. Nach
Ausweis der Augsburger Malerbücher, die
R. Vischer in den »Studien zur Kunstgeschichte«,
Stuttgart 1886, veröffentlichte, hat sich Jörg Breu
1502 in die Zunft eingekauft und in diesem
wie den Jahren 1505, 1507, 1514, 15IG und
1520 derselben Lernknaben vorgestellt; 1522
besichtigt und zeichnet er im Auftrage der
Stadt die Befestigungen Strafsburgs (vergl.
Essen wein, H. Tirol's Holzschnitt, darstellend
die Belehnung König Ferdinands I., etc., Frank-
furt a. M. 1887, S. 2); 1525 erscheint er neben
anderen namhaften Meistern als Mitunterzeichner
eines Eintrages in einem der Handwerksbücher;
1531 wird der Maler H. Tirol, vermuthlich
sein Geselle, als sein Hausgenosse erwähnt;
1536 endlich führt ihn das Zunftregister unter
den verstorbenen Meistern auf. Durch diese
fortlaufende Reihe urkundlicher Nachrichten,
die sich zweifellos auf einen einzigen Künstler
beziehen, wird einerseits die Existenz eines
älteren Malers J. Breu hinfällig, die Ad. Rosen-
berg in der »Zeitschr. für bild. Kunst«. Bei-
blatt X, Sp. 388 ff., angenommen hatte; anderer-
seits die Schlufsfolgerung nahe gelegt, dafs
sämmtliche, in dem fraglichen Zeiträume ent-
standenen Werke, die unter der Signatur Breu
figuriren, einem und demselben Meister ange-
hören, der eben das Ansehen des Namens be-
gründet hatte und durch ein Menschenalter dessen
Hauptträger- gewesen ist. Höchstwahrscheinlich
hat Jörg Breu neben anderen Gehülfen auch
seinen gleichnamigen Sohn, der 1534 die Maler-
gerechtigkeit des Vaters erhielt, in seiner Werk-
statt beschäftigt; der Antheil dieses jüngeren
Breu läfst sich aber an der Hand seiner eigenen
verbürgten Leistungen nicht ausscheiden, ohne
willkürlichen Vermuthungen Raum zu geben.
Weit naturgemäfser erklären sich die unleug-
baren Wandlungen in der Kunstweise des
alten Breu als getrennte Entwicklungsstufen
eines Künstlers, der, fortgerissen von seiner
raschlebigen Zeit, alle Stilphasen derselben
durchläuft, von den spätgothischen Formen des
ausgehenden XV. bis zum Beginn des manie-
ristischen Verfalles in den dreifsiger Jahren des
XVI. Jahrh. Die chronologisch angeordnete
Uebersicht über die Schöpfungen Breu's, die
ich im Folgenden gebe, wird in ihm ein weit
selbständigeres und fruchtbareres Talent, als
bis jetzt angenommen wurde, erkennen lassen
und mag dazu beitragen, das schwankende
Künstlerbild dieses Meisters zu befestigen, dem
zur vollen Ebenbürtigkeit mit den glänzendsten
Vertretern der Augsburger Schule vielleicht nur
die rechtzeitige Ausbildung im Süden gefehlt hat.
Aus dem Jahre 1501 stammt die früheste
nachweisbare Arbeit Breu's, vier doppelseitig
bemalte Breitentafeln (88 * 128 cm) im
Stifte Herzogenburg bei St. Polten in
Nieder-Oesterreich. Die neuerdings öfter ge-
nannten, aber wenig gekannten Gemälde, offen-
bar die auseinander gesägten Bildfelder zweier
Altarfiügel, befanden sich früher in der Kar-
thause Aggsbach bei Melk, nach deren Auf-
hebung 1782 sie in das benachbarte Serviten-
kloster Langeck und von dort 1816, in arg
beschädigtem Zustande zu den Augustiner Chor-
herren nach Herzogenburg gekommen sind.1)
Die auf einer Leinwand- und Gipsunterlage mit
Gold grundirten Festseiten der Flügel enthalten
vier Szenen aus der Kindheitslegende
Christi: Heimsuchung, Geburt, Beschneidung,
Anbetung der Könige, denen auf den Rück-
seiten die üblichen Fastenbilder aus der
Passionsgeschichte: Christus v. dem Hohen-
priester, Dornenkrönung, Geifselung, Kreuz-
s) Vgl. Sacken »Denkm. d. Mittelalters eic. im
Kreise ob d. Wiener Walde» S. 44, Anm. 3; »Oesterr.
Zeitschr. f. Gesch. u. Staatskunde«, Wien (1835) S. 39H;
Tschischka »Kunst u. Alterthum im öslerr. Kaiser-
staate.-, Wien (1836) S. 81; Archiv f. österr. Ge-
schichtsquellen« V (1850) S. 157; »Berichte u. Mittheil.
d. Alterthumsvereins zu Wien« XVU (1S77) S. 119 f.
Jörg Breu von Augsburg.
Mit 2 Abbildungen.
1.
ieser altschwäbische Meister,
einer aus der grofsen Maler-
generation, die im ersten Drittel
des XVI. Jahrh. Augsburg zur
Hauptstadt der deutschen Re-
naissance erhoben hat, ist erst seit Kurzem eine
greifbare Künstlerpersönlichkeit geworden. Nach
Ausweis der Augsburger Malerbücher, die
R. Vischer in den »Studien zur Kunstgeschichte«,
Stuttgart 1886, veröffentlichte, hat sich Jörg Breu
1502 in die Zunft eingekauft und in diesem
wie den Jahren 1505, 1507, 1514, 15IG und
1520 derselben Lernknaben vorgestellt; 1522
besichtigt und zeichnet er im Auftrage der
Stadt die Befestigungen Strafsburgs (vergl.
Essen wein, H. Tirol's Holzschnitt, darstellend
die Belehnung König Ferdinands I., etc., Frank-
furt a. M. 1887, S. 2); 1525 erscheint er neben
anderen namhaften Meistern als Mitunterzeichner
eines Eintrages in einem der Handwerksbücher;
1531 wird der Maler H. Tirol, vermuthlich
sein Geselle, als sein Hausgenosse erwähnt;
1536 endlich führt ihn das Zunftregister unter
den verstorbenen Meistern auf. Durch diese
fortlaufende Reihe urkundlicher Nachrichten,
die sich zweifellos auf einen einzigen Künstler
beziehen, wird einerseits die Existenz eines
älteren Malers J. Breu hinfällig, die Ad. Rosen-
berg in der »Zeitschr. für bild. Kunst«. Bei-
blatt X, Sp. 388 ff., angenommen hatte; anderer-
seits die Schlufsfolgerung nahe gelegt, dafs
sämmtliche, in dem fraglichen Zeiträume ent-
standenen Werke, die unter der Signatur Breu
figuriren, einem und demselben Meister ange-
hören, der eben das Ansehen des Namens be-
gründet hatte und durch ein Menschenalter dessen
Hauptträger- gewesen ist. Höchstwahrscheinlich
hat Jörg Breu neben anderen Gehülfen auch
seinen gleichnamigen Sohn, der 1534 die Maler-
gerechtigkeit des Vaters erhielt, in seiner Werk-
statt beschäftigt; der Antheil dieses jüngeren
Breu läfst sich aber an der Hand seiner eigenen
verbürgten Leistungen nicht ausscheiden, ohne
willkürlichen Vermuthungen Raum zu geben.
Weit naturgemäfser erklären sich die unleug-
baren Wandlungen in der Kunstweise des
alten Breu als getrennte Entwicklungsstufen
eines Künstlers, der, fortgerissen von seiner
raschlebigen Zeit, alle Stilphasen derselben
durchläuft, von den spätgothischen Formen des
ausgehenden XV. bis zum Beginn des manie-
ristischen Verfalles in den dreifsiger Jahren des
XVI. Jahrh. Die chronologisch angeordnete
Uebersicht über die Schöpfungen Breu's, die
ich im Folgenden gebe, wird in ihm ein weit
selbständigeres und fruchtbareres Talent, als
bis jetzt angenommen wurde, erkennen lassen
und mag dazu beitragen, das schwankende
Künstlerbild dieses Meisters zu befestigen, dem
zur vollen Ebenbürtigkeit mit den glänzendsten
Vertretern der Augsburger Schule vielleicht nur
die rechtzeitige Ausbildung im Süden gefehlt hat.
Aus dem Jahre 1501 stammt die früheste
nachweisbare Arbeit Breu's, vier doppelseitig
bemalte Breitentafeln (88 * 128 cm) im
Stifte Herzogenburg bei St. Polten in
Nieder-Oesterreich. Die neuerdings öfter ge-
nannten, aber wenig gekannten Gemälde, offen-
bar die auseinander gesägten Bildfelder zweier
Altarfiügel, befanden sich früher in der Kar-
thause Aggsbach bei Melk, nach deren Auf-
hebung 1782 sie in das benachbarte Serviten-
kloster Langeck und von dort 1816, in arg
beschädigtem Zustande zu den Augustiner Chor-
herren nach Herzogenburg gekommen sind.1)
Die auf einer Leinwand- und Gipsunterlage mit
Gold grundirten Festseiten der Flügel enthalten
vier Szenen aus der Kindheitslegende
Christi: Heimsuchung, Geburt, Beschneidung,
Anbetung der Könige, denen auf den Rück-
seiten die üblichen Fastenbilder aus der
Passionsgeschichte: Christus v. dem Hohen-
priester, Dornenkrönung, Geifselung, Kreuz-
s) Vgl. Sacken »Denkm. d. Mittelalters eic. im
Kreise ob d. Wiener Walde» S. 44, Anm. 3; »Oesterr.
Zeitschr. f. Gesch. u. Staatskunde«, Wien (1835) S. 39H;
Tschischka »Kunst u. Alterthum im öslerr. Kaiser-
staate.-, Wien (1836) S. 81; Archiv f. österr. Ge-
schichtsquellen« V (1850) S. 157; »Berichte u. Mittheil.
d. Alterthumsvereins zu Wien« XVU (1S77) S. 119 f.