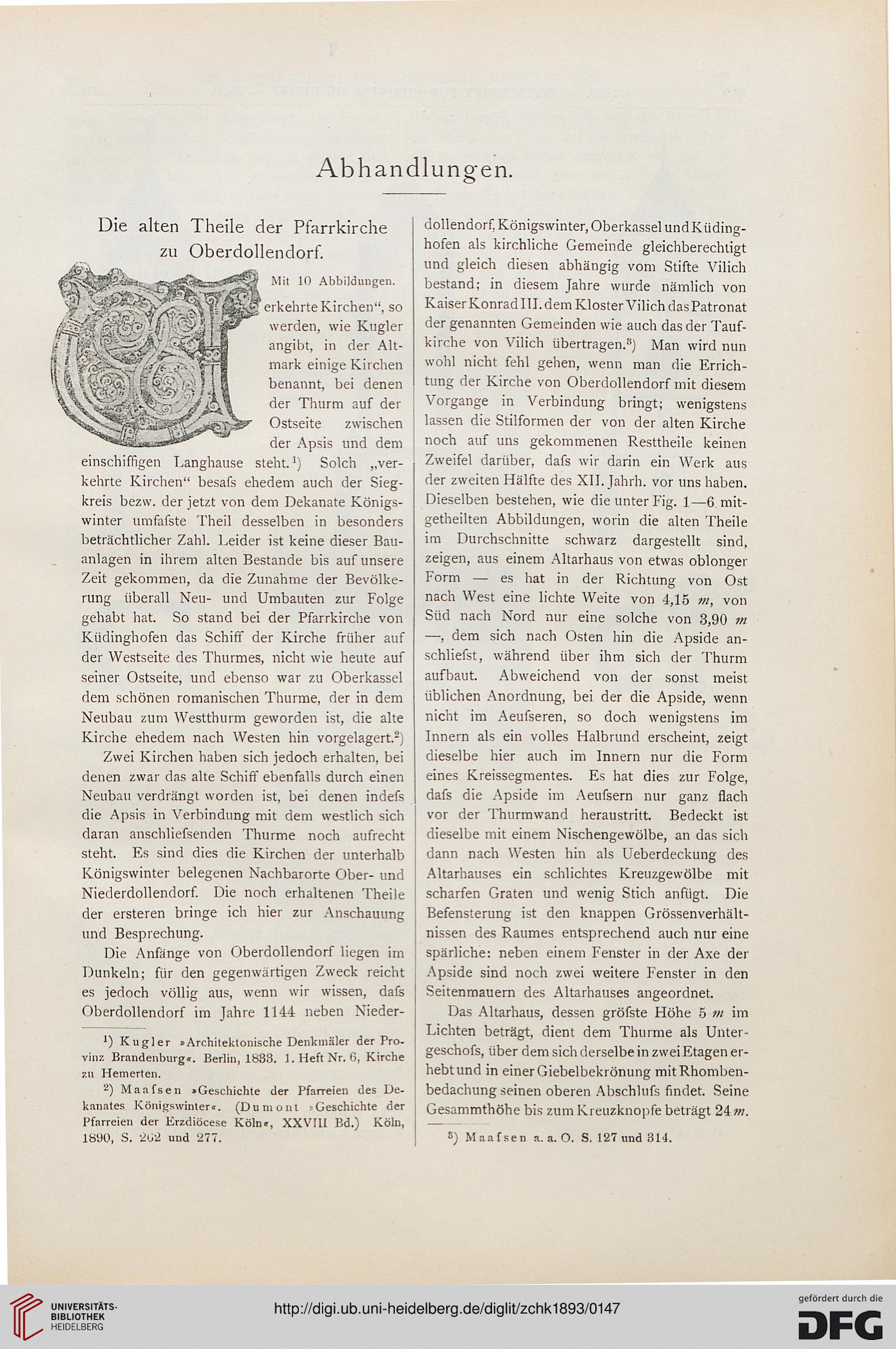Abhandlungen.
Die alten Theile der Pfarrkirche
zu Oberdollendorf.
Mit 10 Abbildungen.
erkehrte Kirchen", so
werden, wie Kugler
angibt, in der Alt-
mark einige Kirchen
benannt, bei denen
der Thurm auf der
Ostseite zwischen
der Apsis und dem
einschiffigen Langhause steht.1) Solch „ver-
kehrte Kirchen" besafs ehedem auch der Sieg-
kreis bezw. der jetzt von dem Dekanate Königs-
winter umfafste Theil desselben in besonders
beträchtlicher Zahl. Leider ist keine dieser Bau-
anlagen in ihrem alten Bestände bis auf unsere
Zeit gekommen, da die Zunahme der Bevölke-
rung überall Neu- und Umbauten zur Folge
gehabt hat. So stand bei der Pfarrkirche von
Küdinghofen das Schiff der Kirche früher auf
der Westseite des Thurmes, nicht wie heute auf
seiner Ostseite, und ebenso war zu Oberkassel
dem schönen romanischen Thurme, der in dem
Neubau zum Westthurm geworden ist, die alte
Kirche ehedem nach Westen hin vorgelagert.2;
Zwei Kirchen haben sich jedoch erhalten, bei
denen zwar das alte Schiff ebenfalls durch einen
Neubau verdrängt worden ist, bei denen indefs
die Apsis in Verbindung mit dem westlich sich
daran anschliefsenden Thurme noch aufrecht
steht. Es sind dies die Kirchen der unterhalb
Königswinter belegenen Nachbarorte Ober- und
Niederdollendorf. Die noch erhaltenen Theile
der ersteren bringe ich hier zur Anschauung
und Besprechung.
Die Anfänge von Oberdollendorf liegen im
Dunkeln; für den gegenwärtigen Zweck reicht
es jedoch völlig aus, wenn wir wissen, dafs
Oberdollendorf im Jahre 1144 neben Nieder-
') Kugler »Architektonische Denkmäler der Pro-
vinz Brandenburg«. Berlin, 1833. I.Heft Nr. 6, Kirche
zu Hemerten.
2) Maafsen »Geschichte der Pfarreien des De-
kanates Königswinter«. (Duniont • Geschichte der
Pfarreien der Erzdiöcese Köln», XXVIII Bd.) Köln,
1890, S. 202 und 277.
dollendorf, Königswinter, Oberkassel undKiiding-
hofen als kirchliche Gemeinde gleichberechtigt
und gleich diesen abhängig vom Stifte Vilich
bestand; in diesem Jahre wurde nämlich von
Kaiser Konrad III. dem Kloster Vilich das Patronat
der genannten Gemeinden wie auch das der Tauf-
kirche von Vilich übertragen.") Man wird nun
wohl nicht fehl gehen, wenn man die Errich-
tung der Kirche von Oberdollendorf mit diesem
Vorgange in Verbindung bringt; wenigstens
lassen die Stilformen der von der alten Kirche
noch auf uns gekommenen Resttheile keinen
Zweifel darüber, dafs wir darin ein Werk aus
der zweiten Hälfte des XII. Jahrh. vor uns haben.
Dieselben bestehen, wie die unter Fig. 1—6 mit-
getheilten Abbildungen, worin die alten Theile
im Durchschnitte schwarz dargestellt sind,
zeigen, aus einem Altarhaus von etwas oblonger
Form — es hat in der Richtung von Ost
nach West eine lichte Weite von 4,15 m, von
Süd nach Nord nur eine solche von 3,90 m
—, dem sich nach Osten hin die Apside an-
schliefst, während über ihm sich der Thurm
aufbaut. Abweichend von der sonst meist
üblichen Anordnung, bei der die Apside, wenn
nicht im Aeufseren, so doch wenigstens im
Innern als ein volles Halbrund erscheint, zeigt
dieselbe hier auch im Innern nur die Form
eines Kreissegmentes. Es hat dies zur Folge,
dafs die Apside im Aeufsern nur ganz flach
vor der Thurmwand heraustritt. Bedeckt ist
dieselbe mit einem Nischengewölbe, an das sich
dann nach Westen hin als Ueberdeckung des
Altarhauses ein schlichtes Kreuzgewölbe mit
scharfen Graten und wenig Stich anfügt. Die
Befensterung ist den knappen Grössenverhält-
nissen des Raumes entsprechend auch nur eine
spärliche: neben einem Fenster in der Axe der
Apside sind noch zwei weitere Fenster in den
Seitenmauern des Altarhauses angeordnet.
Das Altarhaus, dessen gröfste Höhe 5 m im
Lichten beträgt, dient dem Thurme als Unter-
geschofs, über dem sich derselbe in zwei Etagen er-
hebt und in einer Giebelbekrönung mit Rhomben-
bedachung seinen oberen Abschlufs findet. Seine
Gesammthöhe bis zum Kreuzknopfe beträgt 24 m.
S) Maafsen a.a.O. S. 127 und 314.
Die alten Theile der Pfarrkirche
zu Oberdollendorf.
Mit 10 Abbildungen.
erkehrte Kirchen", so
werden, wie Kugler
angibt, in der Alt-
mark einige Kirchen
benannt, bei denen
der Thurm auf der
Ostseite zwischen
der Apsis und dem
einschiffigen Langhause steht.1) Solch „ver-
kehrte Kirchen" besafs ehedem auch der Sieg-
kreis bezw. der jetzt von dem Dekanate Königs-
winter umfafste Theil desselben in besonders
beträchtlicher Zahl. Leider ist keine dieser Bau-
anlagen in ihrem alten Bestände bis auf unsere
Zeit gekommen, da die Zunahme der Bevölke-
rung überall Neu- und Umbauten zur Folge
gehabt hat. So stand bei der Pfarrkirche von
Küdinghofen das Schiff der Kirche früher auf
der Westseite des Thurmes, nicht wie heute auf
seiner Ostseite, und ebenso war zu Oberkassel
dem schönen romanischen Thurme, der in dem
Neubau zum Westthurm geworden ist, die alte
Kirche ehedem nach Westen hin vorgelagert.2;
Zwei Kirchen haben sich jedoch erhalten, bei
denen zwar das alte Schiff ebenfalls durch einen
Neubau verdrängt worden ist, bei denen indefs
die Apsis in Verbindung mit dem westlich sich
daran anschliefsenden Thurme noch aufrecht
steht. Es sind dies die Kirchen der unterhalb
Königswinter belegenen Nachbarorte Ober- und
Niederdollendorf. Die noch erhaltenen Theile
der ersteren bringe ich hier zur Anschauung
und Besprechung.
Die Anfänge von Oberdollendorf liegen im
Dunkeln; für den gegenwärtigen Zweck reicht
es jedoch völlig aus, wenn wir wissen, dafs
Oberdollendorf im Jahre 1144 neben Nieder-
') Kugler »Architektonische Denkmäler der Pro-
vinz Brandenburg«. Berlin, 1833. I.Heft Nr. 6, Kirche
zu Hemerten.
2) Maafsen »Geschichte der Pfarreien des De-
kanates Königswinter«. (Duniont • Geschichte der
Pfarreien der Erzdiöcese Köln», XXVIII Bd.) Köln,
1890, S. 202 und 277.
dollendorf, Königswinter, Oberkassel undKiiding-
hofen als kirchliche Gemeinde gleichberechtigt
und gleich diesen abhängig vom Stifte Vilich
bestand; in diesem Jahre wurde nämlich von
Kaiser Konrad III. dem Kloster Vilich das Patronat
der genannten Gemeinden wie auch das der Tauf-
kirche von Vilich übertragen.") Man wird nun
wohl nicht fehl gehen, wenn man die Errich-
tung der Kirche von Oberdollendorf mit diesem
Vorgange in Verbindung bringt; wenigstens
lassen die Stilformen der von der alten Kirche
noch auf uns gekommenen Resttheile keinen
Zweifel darüber, dafs wir darin ein Werk aus
der zweiten Hälfte des XII. Jahrh. vor uns haben.
Dieselben bestehen, wie die unter Fig. 1—6 mit-
getheilten Abbildungen, worin die alten Theile
im Durchschnitte schwarz dargestellt sind,
zeigen, aus einem Altarhaus von etwas oblonger
Form — es hat in der Richtung von Ost
nach West eine lichte Weite von 4,15 m, von
Süd nach Nord nur eine solche von 3,90 m
—, dem sich nach Osten hin die Apside an-
schliefst, während über ihm sich der Thurm
aufbaut. Abweichend von der sonst meist
üblichen Anordnung, bei der die Apside, wenn
nicht im Aeufseren, so doch wenigstens im
Innern als ein volles Halbrund erscheint, zeigt
dieselbe hier auch im Innern nur die Form
eines Kreissegmentes. Es hat dies zur Folge,
dafs die Apside im Aeufsern nur ganz flach
vor der Thurmwand heraustritt. Bedeckt ist
dieselbe mit einem Nischengewölbe, an das sich
dann nach Westen hin als Ueberdeckung des
Altarhauses ein schlichtes Kreuzgewölbe mit
scharfen Graten und wenig Stich anfügt. Die
Befensterung ist den knappen Grössenverhält-
nissen des Raumes entsprechend auch nur eine
spärliche: neben einem Fenster in der Axe der
Apside sind noch zwei weitere Fenster in den
Seitenmauern des Altarhauses angeordnet.
Das Altarhaus, dessen gröfste Höhe 5 m im
Lichten beträgt, dient dem Thurme als Unter-
geschofs, über dem sich derselbe in zwei Etagen er-
hebt und in einer Giebelbekrönung mit Rhomben-
bedachung seinen oberen Abschlufs findet. Seine
Gesammthöhe bis zum Kreuzknopfe beträgt 24 m.
S) Maafsen a.a.O. S. 127 und 314.