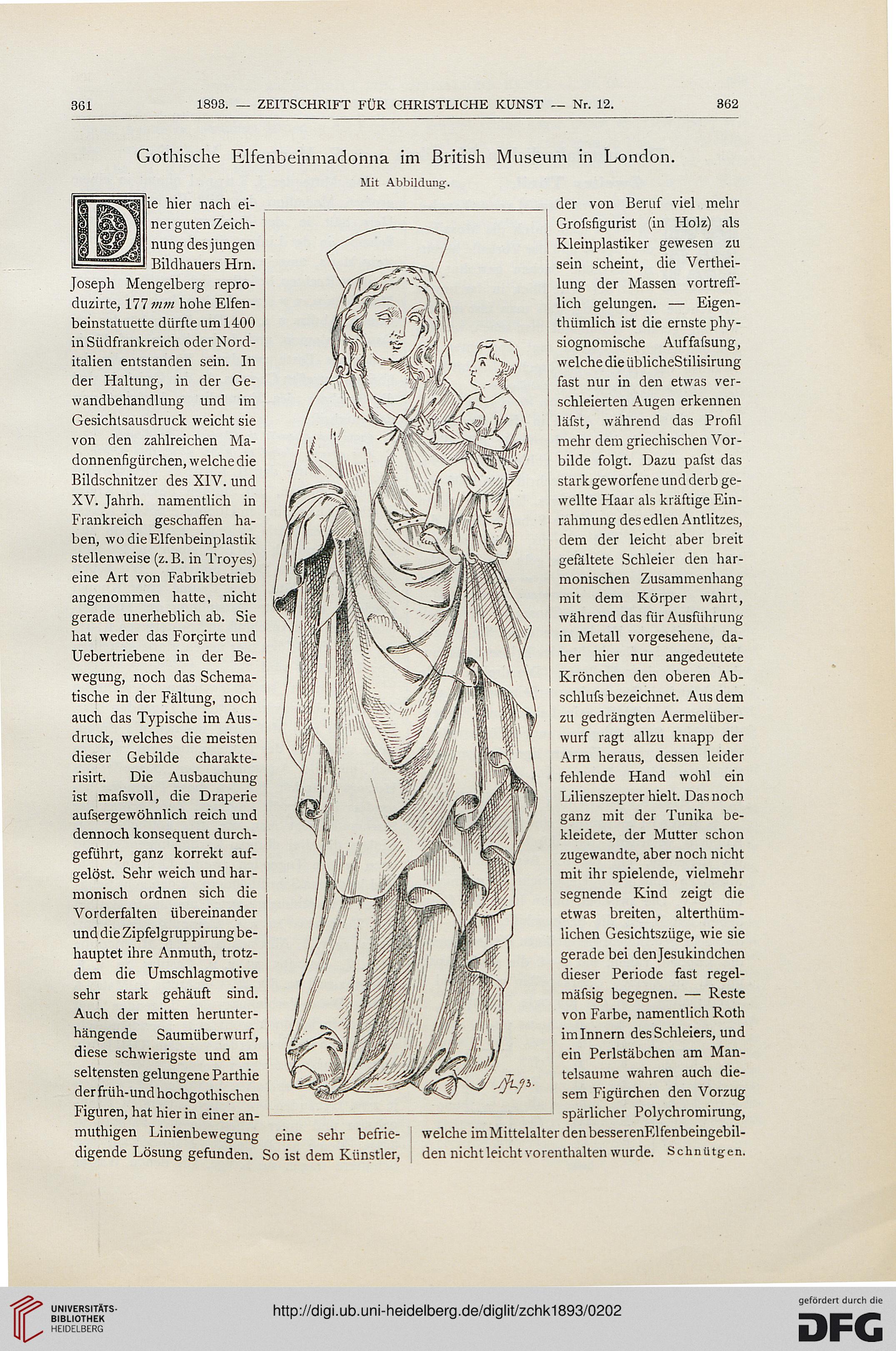361
1893.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 12.
362
Gothische Elfenbeinmadonna im British Museum in London.
Mit Abbildung
ie hier nach ei-
nerguten Zeich-
nung des jungen
Bildhauers Hrn.
Joseph Mengelberg repro-
duzirte, Yllmm hohe Elfen-
beinstatuette dürfte um 1400
in Südfrankreich oder Nord-
italien entstanden sein. In
der Haltung, in der Ge-
wandbehandlung und im
Gesichtsausdruck weicht sie
von den zahlreichen Ma-
donnenfigürchen, welche die
Bildschnitzer des XIV. und
XV. Jahrh. namentlich in
Frankreich geschaffen ha-
ben, woclieElfenbeinplastik
stellenweise (z. B. in Troyes)
eine Art von Fabrikbetrieb
angenommen hatte, nicht
gerade unerheblich ab. Sie
hat weder das Forcirte und
Uebertriebene in der Be-
wegung, noch das Schema-
tische in der Fältung, noch
auch das Typische im Aus-
druck, welches die meisten
dieser Gebilde charakte-
risirt. Die Ausbauchung
ist mafsvoll, die Draperie
aufsergewöhnlich reich und
dennoch konsequent durch-
geführt, ganz korrekt auf-
gelöst. Sehr weich und har-
monisch ordnen sich die
Vorderfalten übereinander
unddieZipfelgruppirungbe-
hauptet ihre Anmuth, trotz-
dem die Umschlagmotive
sehr stark gehäuft sind.
Auch der mitten herunter-
hängende Saumüberwurf,
diese schwierigste und am
seltensten gelungene Parthie
derfrüh-undhochgothischen
Figuren, hat hier in einer an-
muthigen Linienbewegung
digende Lösung gefunden
eine sehr befrie-
So ist dem Künstler,
der von Beruf viel mehr
Grofsfigurist (in Holz) als
Kleinplastiker gewesen zu
sein scheint, die Verthei-
lung der Massen vortreff-
lich gelungen. — Eigen-
thümlich ist die ernste phy-
siognomische Auffafsung,
welche die üblicheStilisirung
fast nur in den etwas ver-
schleierten Augen erkennen
läfst, während das Profil
mehr dem griechischen Vor-
bilde folgt. Dazu pafst das
stark geworfene und derb ge-
wellte Haar als kräftige Ein-
rahmung des edlen Antlitzes,
dem der leicht aber breit
gefaltete Schleier den har-
monischen Zusammenhang
mit dem Körper wahrt,
während das für Ausführung
in Metall vorgesehene, da-
her hier nur angedeutete
Krönchen den oberen Ab-
schlufs bezeichnet. Aus dem
zu gedrängten Aermelüber-
wurf ragt allzu knapp der
Arm heraus, dessen leider
fehlende Hand wohl ein
Lilienszepter hielt. Das noch
ganz mit der Tunika be-
kleidete, der Mutter schon
zugewandte, aber noch nicht
mit ihr spielende, vielmehr
segnende Kind zeigt die
etwas breiten, alterthüm-
lichen Gesichtszüge, wie sie
gerade bei den Jesukindchen
dieser Periode fast regel-
mäfsig begegnen. — Reste
von Farbe, namentlich Roth
im Innern des Schleiers, und
ein Perlstäbchen am Man-
telsaume wahren auch die-
sem Figürchen den Vorzug
spärlicher Polychromirung,
welche imMittelalter den besserenElfenbeingebil-
den nicht leicht vorenthalten wurde. Schnütgen.
1893.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 12.
362
Gothische Elfenbeinmadonna im British Museum in London.
Mit Abbildung
ie hier nach ei-
nerguten Zeich-
nung des jungen
Bildhauers Hrn.
Joseph Mengelberg repro-
duzirte, Yllmm hohe Elfen-
beinstatuette dürfte um 1400
in Südfrankreich oder Nord-
italien entstanden sein. In
der Haltung, in der Ge-
wandbehandlung und im
Gesichtsausdruck weicht sie
von den zahlreichen Ma-
donnenfigürchen, welche die
Bildschnitzer des XIV. und
XV. Jahrh. namentlich in
Frankreich geschaffen ha-
ben, woclieElfenbeinplastik
stellenweise (z. B. in Troyes)
eine Art von Fabrikbetrieb
angenommen hatte, nicht
gerade unerheblich ab. Sie
hat weder das Forcirte und
Uebertriebene in der Be-
wegung, noch das Schema-
tische in der Fältung, noch
auch das Typische im Aus-
druck, welches die meisten
dieser Gebilde charakte-
risirt. Die Ausbauchung
ist mafsvoll, die Draperie
aufsergewöhnlich reich und
dennoch konsequent durch-
geführt, ganz korrekt auf-
gelöst. Sehr weich und har-
monisch ordnen sich die
Vorderfalten übereinander
unddieZipfelgruppirungbe-
hauptet ihre Anmuth, trotz-
dem die Umschlagmotive
sehr stark gehäuft sind.
Auch der mitten herunter-
hängende Saumüberwurf,
diese schwierigste und am
seltensten gelungene Parthie
derfrüh-undhochgothischen
Figuren, hat hier in einer an-
muthigen Linienbewegung
digende Lösung gefunden
eine sehr befrie-
So ist dem Künstler,
der von Beruf viel mehr
Grofsfigurist (in Holz) als
Kleinplastiker gewesen zu
sein scheint, die Verthei-
lung der Massen vortreff-
lich gelungen. — Eigen-
thümlich ist die ernste phy-
siognomische Auffafsung,
welche die üblicheStilisirung
fast nur in den etwas ver-
schleierten Augen erkennen
läfst, während das Profil
mehr dem griechischen Vor-
bilde folgt. Dazu pafst das
stark geworfene und derb ge-
wellte Haar als kräftige Ein-
rahmung des edlen Antlitzes,
dem der leicht aber breit
gefaltete Schleier den har-
monischen Zusammenhang
mit dem Körper wahrt,
während das für Ausführung
in Metall vorgesehene, da-
her hier nur angedeutete
Krönchen den oberen Ab-
schlufs bezeichnet. Aus dem
zu gedrängten Aermelüber-
wurf ragt allzu knapp der
Arm heraus, dessen leider
fehlende Hand wohl ein
Lilienszepter hielt. Das noch
ganz mit der Tunika be-
kleidete, der Mutter schon
zugewandte, aber noch nicht
mit ihr spielende, vielmehr
segnende Kind zeigt die
etwas breiten, alterthüm-
lichen Gesichtszüge, wie sie
gerade bei den Jesukindchen
dieser Periode fast regel-
mäfsig begegnen. — Reste
von Farbe, namentlich Roth
im Innern des Schleiers, und
ein Perlstäbchen am Man-
telsaume wahren auch die-
sem Figürchen den Vorzug
spärlicher Polychromirung,
welche imMittelalter den besserenElfenbeingebil-
den nicht leicht vorenthalten wurde. Schnütgen.