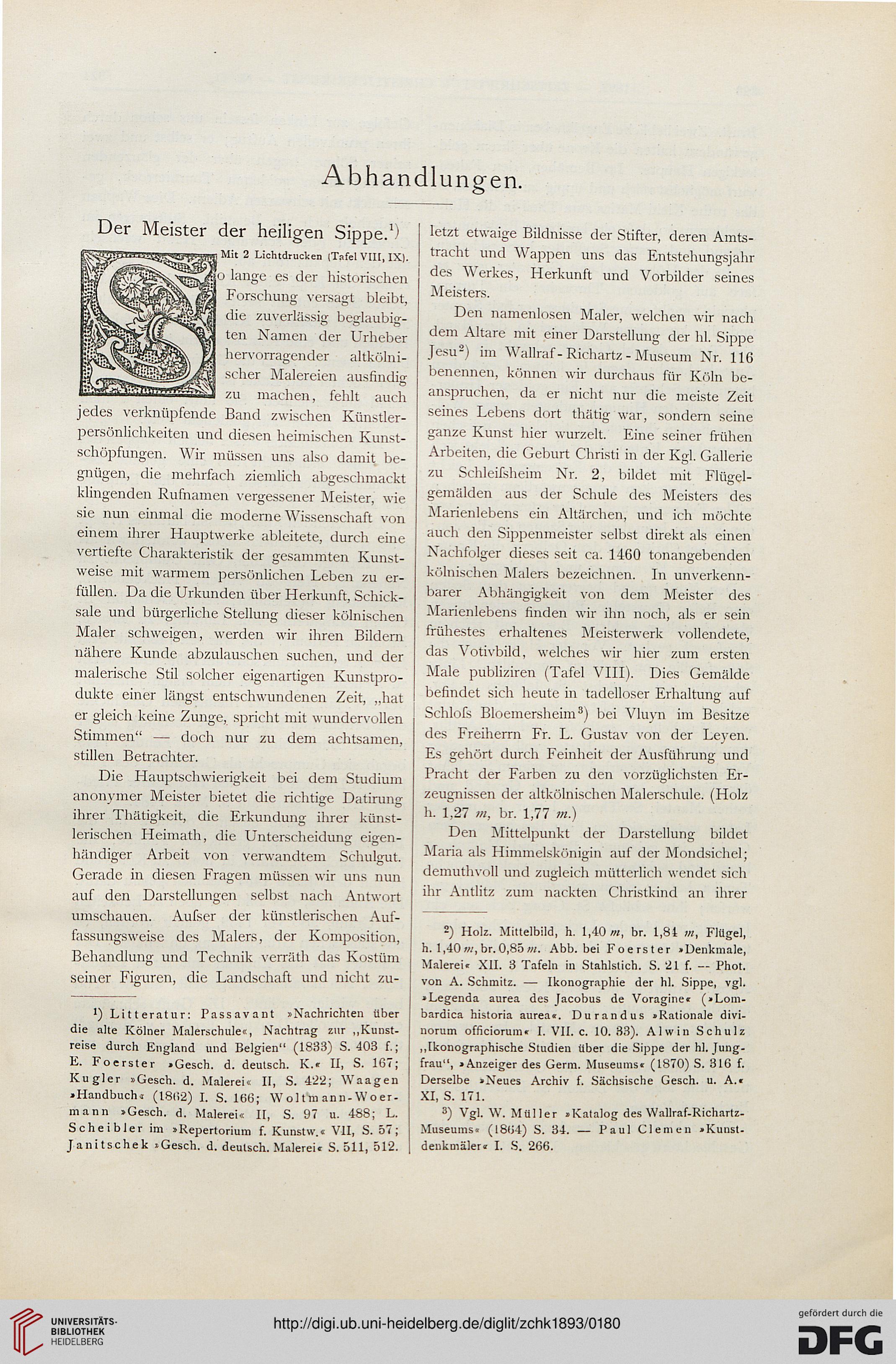Abhandlungen.
Der Meister der heiligen Sippe.1)
^jjMit 2 Lichtdrucken (Tafel VIII, IX).
o lange es der historischen
Forschung versagt bleibt,
H die zuverlässig beglaubig-
ten Namen der Urheber
hervorragender altkölni-
scher Malereien ausfindig:
zu machen, fehlt auch
jedes verknüpfende Band zwischen Künstler-
persönlichkeiten und diesen heimischen Kunst-
schöpfungen. Wir müssen uns also damit be-
gnügen, die mehrfach ziemlich abgeschmackt
klingenden Rufnamen vergessener Meister, wie
sie nun einmal die moderne Wissenschaft von
einem ihrer Hauptwerke ableitete, durch eine
vertiefte Charakteristik der gesammten Kunst-
weise mit warmem persönlichen Leben zu er-
füllen. Da die Urkunden über Herkunft, Schick-
sale und bürgerliche Stellung dieser kölnischen
Maler schweigen, werden wir ihren Bildern
nähere Kunde abzulauschen suchen, und der
malerische Stil solcher eigenartigen Kunstpro-
dukte einer längst entschwundenen Zeit, „hat
er gleich keine Zunge, spricht mit wundervollen
Stimmen" — doch nur zu dem achtsamen,
stillen Betrachter.
Die Hauptschwierigkeit bei dem Studium
anonymer Meister bietet die richtige Datirung
ihrer Thätigkeit, die Erkundung ihrer künst-
lerischen Heimath, die Unterscheidung eigen-
händiger Arbeit von verwandtem Schulgut.
Gerade in diesen Fragen müssen wir uns nun
auf den Darstellungen selbst nach Antwort
umschauen. Aufser der künstlerischen Auf-
fassungsweise des Malers, der Komposition,
Behandlung und Technik verräth das Kostüm
seiner Figuren, die Landschaft und nicht zu-
•) Litteratur: Passavant »Nachrichten über
die alte Kölner Malerschule«, Nachtrag zur „Kunst-
reise durch England und Belgien" (1833) S. 403 f.;
E. Foerster .Gesch. d. deutsch. K.« II, S. 167;
Kugler »Gesch. d. Malerei« II, S. 422; Waagen
«Handbuch* (18(>2) I. S. 166; W ol tm ann-Woer-
mann »Gesch. d. Malerei« II, S. 97 u. 488; L.
Scheibler im »Repertoriuin f. Kunstw.« VII, S. 57;
Janitschek »Gesch. d. deutsch. Malerei« S. 511, 512.
letzt etwaige Bildnisse der Stifter, deren Amts-
tracht und Wappen uns das Entstehungsjahr
des Werkes, Herkunft und Vorbilder seines
Meisters.
Den namenlosen Maler, welchen wir nach
dem Altare mit einer Darstellung der hl. Sippe
Jesu2) im Wallraf- Richartz - Museum Nr. 116
benennen, können wir durchaus für Köln be-
anspruchen, da er nicht nur die meiste Zeit
seines Lebens dort thätig war, sondern seine
ganze Kunst hier wurzelt. Eine seiner frühen
Arbeiten, die Geburt Christi in der Kgl. Gallerie
zu Schleifsheim Nr. 2, bildet mit Flügel-
gemälden aus der Schule des Meisters des
Marienlebens ein Altärchen, und ich möchte
auch den Sippenmeister selbst direkt als einen
Nachfolger dieses seit ca. 1460 tonangebenden
kölnischen Malers bezeichnen. In unverkenn-
barer Abhängigkeit von dem Meister des
Marienlebens finden wir ihn noch, als er sein
frühestes erhaltenes Meisterwerk vollendete,
das Votivbild, welches wir hier zum ersten
Male publiziren (Tafel VIII). Dies Gemälde
befindet sich heute in tadelloser Erhaltung auf
Schlofs Bloemersheim3) bei Vluyn im Besitze
des Freiherrn Fr. L. Gustav von der Leyen.
Es gehört durch Feinheit der Ausführung und
Pracht der Farben zu den vorzüglichsten Er-
zeugnissen der altkölnischen Malerschule. (Holz
h. 1,27 m, br. 1,77 m.)
Den Mittelpunkt der Darstellung bildet
Maria als Himmelskönigin auf der Mondsichel;
demuthvoll und zugleich mütterlich wendet sich
ihr Antlitz zum nackten Christkind an ihrer
") Holz. Mittelbild, h. 1,40/«, br. 1,84 m, Flügel,
h. 1,40«, br. 0,85«. Abb. bei Foerster »Denkmale,
Malerei« XII. 3 Tafeln in Stahlstich. S. 21 f. — Phot.
von A. Schmitz. — Ikonographie der hl. Sippe, vgl.
»Legenda aurea des Jacobus de Voragine« (»Lom-
bardica historia aurea«. Durandus »Rationale divi-
norum officiorum« I. VII. c. 10. 33). Alwin Schulz
,,Ikonographische Studien über die Sippe der hl. Jung-
frau", »Anzeiger des Germ. Museums« (1870) S. 310 f.
Derselbe »Neues Archiv f. Sächsische Gesch. u. A.«
XI, S. 171.
3) Vgl. W. Müller »Katalog des Wallraf-Richartz-
Museums« (I8(j4) S. 34. — Paul Giemen »Kunst-
denkmäler« I. -S. 2G6.
Der Meister der heiligen Sippe.1)
^jjMit 2 Lichtdrucken (Tafel VIII, IX).
o lange es der historischen
Forschung versagt bleibt,
H die zuverlässig beglaubig-
ten Namen der Urheber
hervorragender altkölni-
scher Malereien ausfindig:
zu machen, fehlt auch
jedes verknüpfende Band zwischen Künstler-
persönlichkeiten und diesen heimischen Kunst-
schöpfungen. Wir müssen uns also damit be-
gnügen, die mehrfach ziemlich abgeschmackt
klingenden Rufnamen vergessener Meister, wie
sie nun einmal die moderne Wissenschaft von
einem ihrer Hauptwerke ableitete, durch eine
vertiefte Charakteristik der gesammten Kunst-
weise mit warmem persönlichen Leben zu er-
füllen. Da die Urkunden über Herkunft, Schick-
sale und bürgerliche Stellung dieser kölnischen
Maler schweigen, werden wir ihren Bildern
nähere Kunde abzulauschen suchen, und der
malerische Stil solcher eigenartigen Kunstpro-
dukte einer längst entschwundenen Zeit, „hat
er gleich keine Zunge, spricht mit wundervollen
Stimmen" — doch nur zu dem achtsamen,
stillen Betrachter.
Die Hauptschwierigkeit bei dem Studium
anonymer Meister bietet die richtige Datirung
ihrer Thätigkeit, die Erkundung ihrer künst-
lerischen Heimath, die Unterscheidung eigen-
händiger Arbeit von verwandtem Schulgut.
Gerade in diesen Fragen müssen wir uns nun
auf den Darstellungen selbst nach Antwort
umschauen. Aufser der künstlerischen Auf-
fassungsweise des Malers, der Komposition,
Behandlung und Technik verräth das Kostüm
seiner Figuren, die Landschaft und nicht zu-
•) Litteratur: Passavant »Nachrichten über
die alte Kölner Malerschule«, Nachtrag zur „Kunst-
reise durch England und Belgien" (1833) S. 403 f.;
E. Foerster .Gesch. d. deutsch. K.« II, S. 167;
Kugler »Gesch. d. Malerei« II, S. 422; Waagen
«Handbuch* (18(>2) I. S. 166; W ol tm ann-Woer-
mann »Gesch. d. Malerei« II, S. 97 u. 488; L.
Scheibler im »Repertoriuin f. Kunstw.« VII, S. 57;
Janitschek »Gesch. d. deutsch. Malerei« S. 511, 512.
letzt etwaige Bildnisse der Stifter, deren Amts-
tracht und Wappen uns das Entstehungsjahr
des Werkes, Herkunft und Vorbilder seines
Meisters.
Den namenlosen Maler, welchen wir nach
dem Altare mit einer Darstellung der hl. Sippe
Jesu2) im Wallraf- Richartz - Museum Nr. 116
benennen, können wir durchaus für Köln be-
anspruchen, da er nicht nur die meiste Zeit
seines Lebens dort thätig war, sondern seine
ganze Kunst hier wurzelt. Eine seiner frühen
Arbeiten, die Geburt Christi in der Kgl. Gallerie
zu Schleifsheim Nr. 2, bildet mit Flügel-
gemälden aus der Schule des Meisters des
Marienlebens ein Altärchen, und ich möchte
auch den Sippenmeister selbst direkt als einen
Nachfolger dieses seit ca. 1460 tonangebenden
kölnischen Malers bezeichnen. In unverkenn-
barer Abhängigkeit von dem Meister des
Marienlebens finden wir ihn noch, als er sein
frühestes erhaltenes Meisterwerk vollendete,
das Votivbild, welches wir hier zum ersten
Male publiziren (Tafel VIII). Dies Gemälde
befindet sich heute in tadelloser Erhaltung auf
Schlofs Bloemersheim3) bei Vluyn im Besitze
des Freiherrn Fr. L. Gustav von der Leyen.
Es gehört durch Feinheit der Ausführung und
Pracht der Farben zu den vorzüglichsten Er-
zeugnissen der altkölnischen Malerschule. (Holz
h. 1,27 m, br. 1,77 m.)
Den Mittelpunkt der Darstellung bildet
Maria als Himmelskönigin auf der Mondsichel;
demuthvoll und zugleich mütterlich wendet sich
ihr Antlitz zum nackten Christkind an ihrer
") Holz. Mittelbild, h. 1,40/«, br. 1,84 m, Flügel,
h. 1,40«, br. 0,85«. Abb. bei Foerster »Denkmale,
Malerei« XII. 3 Tafeln in Stahlstich. S. 21 f. — Phot.
von A. Schmitz. — Ikonographie der hl. Sippe, vgl.
»Legenda aurea des Jacobus de Voragine« (»Lom-
bardica historia aurea«. Durandus »Rationale divi-
norum officiorum« I. VII. c. 10. 33). Alwin Schulz
,,Ikonographische Studien über die Sippe der hl. Jung-
frau", »Anzeiger des Germ. Museums« (1870) S. 310 f.
Derselbe »Neues Archiv f. Sächsische Gesch. u. A.«
XI, S. 171.
3) Vgl. W. Müller »Katalog des Wallraf-Richartz-
Museums« (I8(j4) S. 34. — Paul Giemen »Kunst-
denkmäler« I. -S. 2G6.