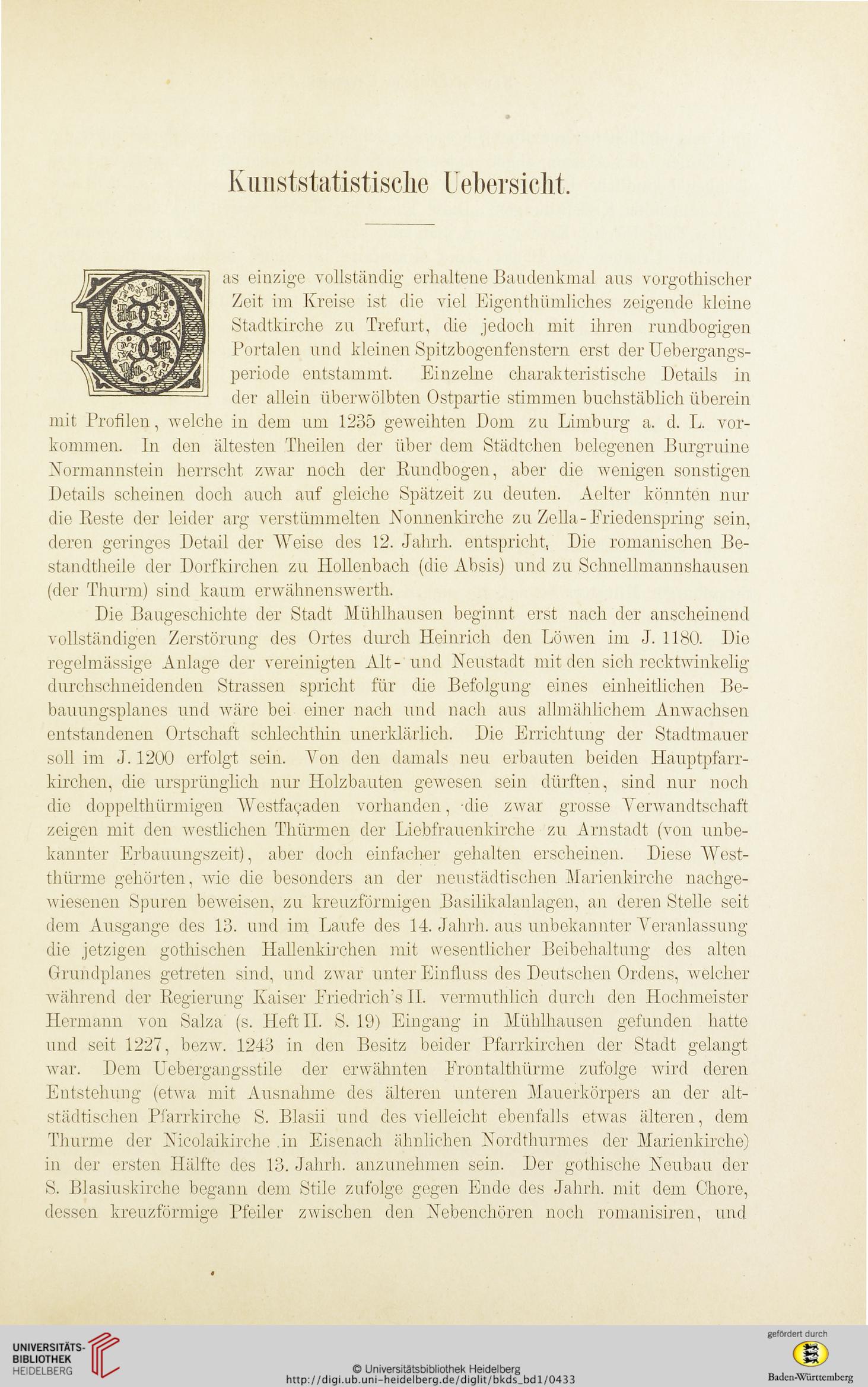Kunststatistisclie Uebersiclit.
as einzige vollständig erhaltene Baudenkmal aus vorgothischer
Zeit im Kreise ist die viel Eigentümliches zeigende kleine
Stadtkirche zu Trefurt, die jedoch mit ihren rundbogigen
Portalen und kleinen Spitzbogenfenstern erst der Uebergangs-
periode entstammt. Einzelne charakteristische Details in
der allein überwölbten Ostpartie stimmen buchstäblich überein
mit Profilen, welche in dem um 1235 geweihten Dom zu Limburg a. d. L. Vor-
kommen. In den ältesten Theilen der über dem Städtchen belegenen Burgruine
Normannstein herrscht zwar noch der Bundbogen, aber die wenigen sonstigen
Details scheinen doch auch auf gleiche Spätzeit zu deuten. Aelter könnten nur
die Reste der leider arg verstümmelten Nonnenkirche zu Zella-Friedenspring sein,
deren geringes Detail der Weise des 12. Jahrh. entspricht, Die romanischen Be-
standtheile der Dorfkirchen zu Hollenbach (die Absis) und zu Schnellmannshausen
(der Thurm) sind kaum erwähnenswerth.
Die Baugeschichte der Stadt Mühlhausen beginnt erst nach der anscheinend
vollständigen Zerstörung des Ortes durch Heinrich den Löwen im J. 1180. Die
regelmässige Anlage der vereinigten Alt- und Neustadt mit den sich recktwinkelig
durchschneidenden Strassen spricht für die Befolgung eines einheitlichen Be-
bauungsplanes und wäre bei einer nach und nach aus allmählichem Anwachsen
entstandenen Ortschaft schlechthin unerklärlich. Die Errichtung der Stadtmauer
soll im J. 1200 erfolgt sein. Ton den damals neu erbauten beiden Hauptpfarr-
kirchen, die ursprünglich nur Holzbauten gewesen sein dürften, sind nur noch
die doppelthürmigen Westfapaclen vorhanden, -die zwar grosse Verwandtschaft
zeigen mit den westlichen Thürmen der Liebfrauenkirche zu Arnstadt (von unbe-
kannter Erbauungszeit), aber doch einfacher gehalten erscheinen. Diese West-
thiirme gehörten, wie die besonders an der neustädtischen Marienkirche nachge-
wiesenen Spuren beweisen, zu kreuzförmigen Basilikalanlagen, an deren Stelle seit
dem Ausgange des 13. und im Laufe des 14. Jahrh. aus unbekannter Veranlassung
die jetzigen gothischen Hallenkirchen mit wesentlicher Beibehaltung des alten
Grundplanes getreten sind, und zwar unter Einfluss des Deutschen Ordens, welcher
während der Regierung Kaiser Friedrich’s II. vermuthlich durch den Hochmeister
Hermann von Salza (s. Heft II. S. 19) Eingang in Mühlhausen gefunden hatte
und seit 1227, bezw. 1243 in den Besitz beider Pfarrkirchen der Stadt gelangt
war. Dem Uebergangsstile der erwähnten Frontalthürme zufolge wird deren
Entstehung (etwa mit Ausnahme des älteren unteren Mauerkörpers an der alt-
städtischen Pfarrkirche S. Blasii und des vielleicht ebenfalls etwas älteren, dem
Thurme der Nicolaikirche .in Eisenach ähnlichen Nordthurmes der Marienkirche)
in der ersten Hälfte des 13. Jahrh. anzunehmen sein. Der gothische Neubau der
S. Blasiuskirche begann dem Stile zufolge gegen Ende des Jahrh. mit dem Chore,
dessen kreuzförmige Pfeiler zwischen den Nebenchören noch romanisiren, und
as einzige vollständig erhaltene Baudenkmal aus vorgothischer
Zeit im Kreise ist die viel Eigentümliches zeigende kleine
Stadtkirche zu Trefurt, die jedoch mit ihren rundbogigen
Portalen und kleinen Spitzbogenfenstern erst der Uebergangs-
periode entstammt. Einzelne charakteristische Details in
der allein überwölbten Ostpartie stimmen buchstäblich überein
mit Profilen, welche in dem um 1235 geweihten Dom zu Limburg a. d. L. Vor-
kommen. In den ältesten Theilen der über dem Städtchen belegenen Burgruine
Normannstein herrscht zwar noch der Bundbogen, aber die wenigen sonstigen
Details scheinen doch auch auf gleiche Spätzeit zu deuten. Aelter könnten nur
die Reste der leider arg verstümmelten Nonnenkirche zu Zella-Friedenspring sein,
deren geringes Detail der Weise des 12. Jahrh. entspricht, Die romanischen Be-
standtheile der Dorfkirchen zu Hollenbach (die Absis) und zu Schnellmannshausen
(der Thurm) sind kaum erwähnenswerth.
Die Baugeschichte der Stadt Mühlhausen beginnt erst nach der anscheinend
vollständigen Zerstörung des Ortes durch Heinrich den Löwen im J. 1180. Die
regelmässige Anlage der vereinigten Alt- und Neustadt mit den sich recktwinkelig
durchschneidenden Strassen spricht für die Befolgung eines einheitlichen Be-
bauungsplanes und wäre bei einer nach und nach aus allmählichem Anwachsen
entstandenen Ortschaft schlechthin unerklärlich. Die Errichtung der Stadtmauer
soll im J. 1200 erfolgt sein. Ton den damals neu erbauten beiden Hauptpfarr-
kirchen, die ursprünglich nur Holzbauten gewesen sein dürften, sind nur noch
die doppelthürmigen Westfapaclen vorhanden, -die zwar grosse Verwandtschaft
zeigen mit den westlichen Thürmen der Liebfrauenkirche zu Arnstadt (von unbe-
kannter Erbauungszeit), aber doch einfacher gehalten erscheinen. Diese West-
thiirme gehörten, wie die besonders an der neustädtischen Marienkirche nachge-
wiesenen Spuren beweisen, zu kreuzförmigen Basilikalanlagen, an deren Stelle seit
dem Ausgange des 13. und im Laufe des 14. Jahrh. aus unbekannter Veranlassung
die jetzigen gothischen Hallenkirchen mit wesentlicher Beibehaltung des alten
Grundplanes getreten sind, und zwar unter Einfluss des Deutschen Ordens, welcher
während der Regierung Kaiser Friedrich’s II. vermuthlich durch den Hochmeister
Hermann von Salza (s. Heft II. S. 19) Eingang in Mühlhausen gefunden hatte
und seit 1227, bezw. 1243 in den Besitz beider Pfarrkirchen der Stadt gelangt
war. Dem Uebergangsstile der erwähnten Frontalthürme zufolge wird deren
Entstehung (etwa mit Ausnahme des älteren unteren Mauerkörpers an der alt-
städtischen Pfarrkirche S. Blasii und des vielleicht ebenfalls etwas älteren, dem
Thurme der Nicolaikirche .in Eisenach ähnlichen Nordthurmes der Marienkirche)
in der ersten Hälfte des 13. Jahrh. anzunehmen sein. Der gothische Neubau der
S. Blasiuskirche begann dem Stile zufolge gegen Ende des Jahrh. mit dem Chore,
dessen kreuzförmige Pfeiler zwischen den Nebenchören noch romanisiren, und