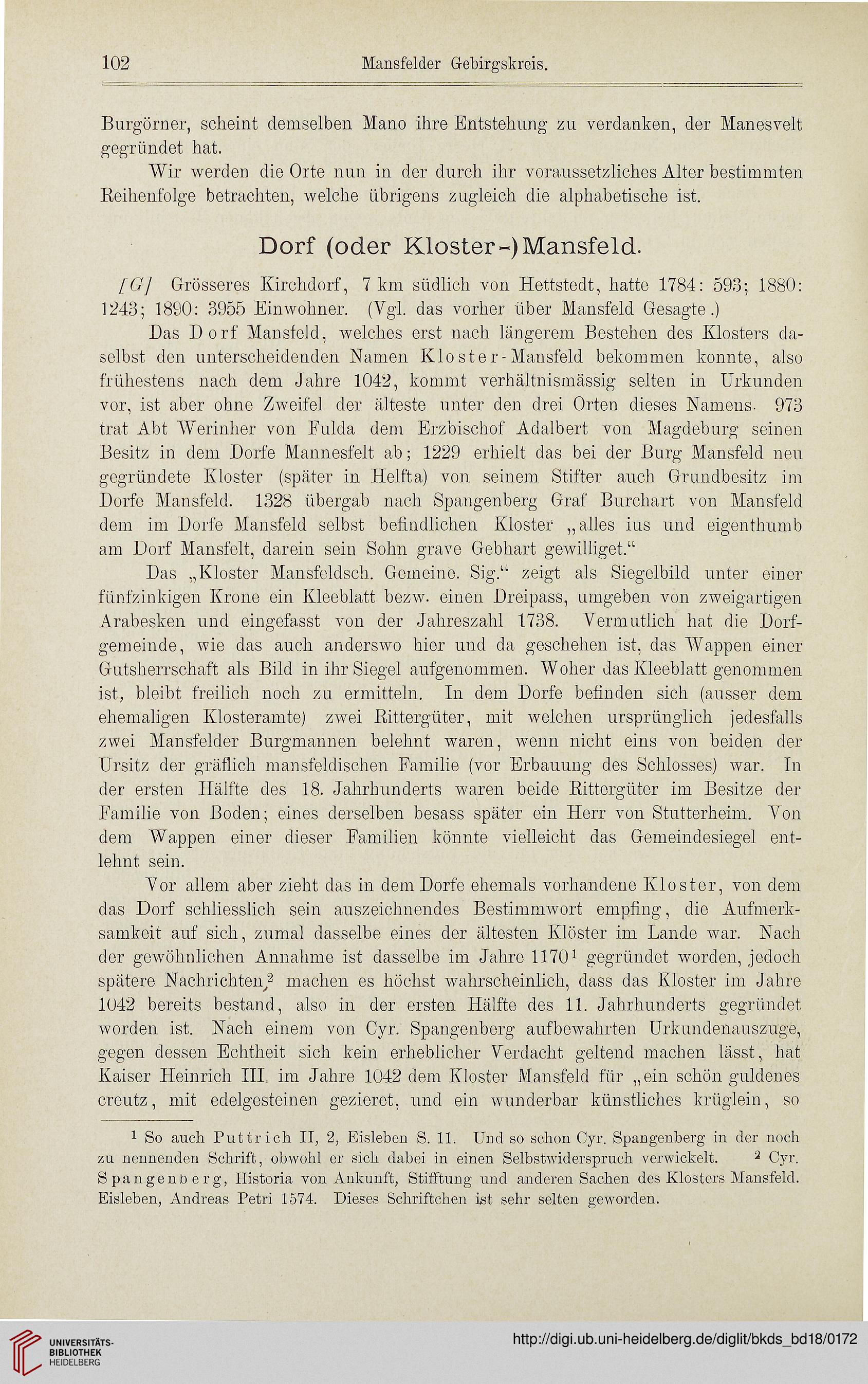102
Mansfelder Gebirgskreis.
Burgörner, scheint demselben Mano ihre Entstehung zu verdanken, der Manesvelt
gegründet hat.
Wir werden die Orte nun in der durch ihr voraussetzliches Alter bestimmten
Reihenfolge betrachten, welche übrigens zugleich die alphabetische ist.
Dorf (oder Kloster-)Mansfeld.
/W/ Grösseres Kirchdorf, 7 km südlich von Hettstedt, hatte 1784: 593; 1880:
1243; 1890: 3955 Einwohner. (Vgl. das vorher über Mansfeld Gesagte.)
Das Dorf Mansfeld, welches erst nach längerem Bestehen des Klosters da-
selbst den unterscheidenden Namen Klo st er-Mansfeld bekommen konnte, also
frühestens nach dem Jahre 1042, kommt verhältnismässig selten in Urkunden
vor, ist aber ohne Zweifel der älteste unter den drei Orten dieses Namens. 973
trat Abt Werinher von Fulda dein Erzbischof Adalbert von Magdeburg seinen
Besitz in dem Dorfe Mannesfelt ab; 1229 erhielt das bei der Bnrg Mansfeld neu
gegründete Kloster (später in Helfta) von seinem Stifter auch Grundbesitz im
Dorfe Mansfeld. 1328 übergab nach Spangenberg Graf Burchart von Mansfeld
dem im Dorfe Mansfeld selbst befindlichen Kloster „alles ius und eigenthumb
am Dorf Mansfelt, darein sein Sohn grave Gebhart gewiliiget."
Das „Kloster Mansfeldsch. Gemeine. SigA zeigt als Siegelbild unter einer
fünfzinkigen Krone ein Kleeblatt bezw. einen Dreipass, umgeben von zweigartigen
Arabesken und eingefasst von der Jahreszahl 1738. Vermutlich hat die Dorf-
gemeinde, wie das auch anderswo hier und da geschehen ist, das Wappen einer
Gutsherrschaft als Bild in ihr Siegel aufgenommen. Woher das Kleeblatt genommen
ist, bleibt freilich noch zu ermitteln. In dem Dorfe befinden sich (ausser dem
ehemaligen Klosteramte) zwei Rittergüter, mit weichen ursprünglich jedesfalis
zwei Mansfelder Burgmannen belehnt waren, wenn nicht eins von beiden der
Ursitz der gräflich mansfeldischen Familie (vor Erbauung des Schlosses) war. In
der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts waren beide Rittergüter im Besitze der
Familie von Boden; eines derselben besass später ein Herr von Stutterheim. Von
dem Wappen einer dieser Familien könnte vielleicht das Gemeindesiegel ent-
lehnt sein.
Vor allem aber zieht das in dem Dorfe ehemals vorhandene Kloster, von dem
das Dorf schliesslich sein auszeichnendes Bestimmwort empfing, die Aufmerk-
samkeit auf sich, zumal dasselbe eines der ältesten Klöster im Lande war. Nach
der gewöhnlichen Annahme ist dasselbe im Jahre 1170t gegründet worden, jedoch
spätere Nachrichten^ machen es höchst wahrscheinlich, dass das Kloster im Jahre
1042 bereits bestand, also in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts gegründet
worden ist. Nach einem von Oyr. Spangenberg aufbewahrten Urkundenauszuge,
gegen dessen Echtheit sich kein erheblicher Verdacht geltend machen lässt, hat
Kaiser Heinrich III. im Jahre 1042 dem Kloster Mansfeld für „ein schön güldenes
creutz, mit edelgesteinen gezieret, und ein wunderbar künstliches krüglein, so
* So auch Puttrich II, 2, Eisleben S. 11. Und so schon Cyr. Spangenberg in der noch
zu nennenden Schrift, obwohl er sich dabei in einen Selbstwiderspruch verwickelt. 2 Oyr,
Spangenberg, Historia von Ankunft, Stifltung und anderen Sachen des Klosters Mansfeld.
Eisleben, Andreas Petri 1574. Dieses Schriftchen ist sehr selten geworden.
Mansfelder Gebirgskreis.
Burgörner, scheint demselben Mano ihre Entstehung zu verdanken, der Manesvelt
gegründet hat.
Wir werden die Orte nun in der durch ihr voraussetzliches Alter bestimmten
Reihenfolge betrachten, welche übrigens zugleich die alphabetische ist.
Dorf (oder Kloster-)Mansfeld.
/W/ Grösseres Kirchdorf, 7 km südlich von Hettstedt, hatte 1784: 593; 1880:
1243; 1890: 3955 Einwohner. (Vgl. das vorher über Mansfeld Gesagte.)
Das Dorf Mansfeld, welches erst nach längerem Bestehen des Klosters da-
selbst den unterscheidenden Namen Klo st er-Mansfeld bekommen konnte, also
frühestens nach dem Jahre 1042, kommt verhältnismässig selten in Urkunden
vor, ist aber ohne Zweifel der älteste unter den drei Orten dieses Namens. 973
trat Abt Werinher von Fulda dein Erzbischof Adalbert von Magdeburg seinen
Besitz in dem Dorfe Mannesfelt ab; 1229 erhielt das bei der Bnrg Mansfeld neu
gegründete Kloster (später in Helfta) von seinem Stifter auch Grundbesitz im
Dorfe Mansfeld. 1328 übergab nach Spangenberg Graf Burchart von Mansfeld
dem im Dorfe Mansfeld selbst befindlichen Kloster „alles ius und eigenthumb
am Dorf Mansfelt, darein sein Sohn grave Gebhart gewiliiget."
Das „Kloster Mansfeldsch. Gemeine. SigA zeigt als Siegelbild unter einer
fünfzinkigen Krone ein Kleeblatt bezw. einen Dreipass, umgeben von zweigartigen
Arabesken und eingefasst von der Jahreszahl 1738. Vermutlich hat die Dorf-
gemeinde, wie das auch anderswo hier und da geschehen ist, das Wappen einer
Gutsherrschaft als Bild in ihr Siegel aufgenommen. Woher das Kleeblatt genommen
ist, bleibt freilich noch zu ermitteln. In dem Dorfe befinden sich (ausser dem
ehemaligen Klosteramte) zwei Rittergüter, mit weichen ursprünglich jedesfalis
zwei Mansfelder Burgmannen belehnt waren, wenn nicht eins von beiden der
Ursitz der gräflich mansfeldischen Familie (vor Erbauung des Schlosses) war. In
der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts waren beide Rittergüter im Besitze der
Familie von Boden; eines derselben besass später ein Herr von Stutterheim. Von
dem Wappen einer dieser Familien könnte vielleicht das Gemeindesiegel ent-
lehnt sein.
Vor allem aber zieht das in dem Dorfe ehemals vorhandene Kloster, von dem
das Dorf schliesslich sein auszeichnendes Bestimmwort empfing, die Aufmerk-
samkeit auf sich, zumal dasselbe eines der ältesten Klöster im Lande war. Nach
der gewöhnlichen Annahme ist dasselbe im Jahre 1170t gegründet worden, jedoch
spätere Nachrichten^ machen es höchst wahrscheinlich, dass das Kloster im Jahre
1042 bereits bestand, also in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts gegründet
worden ist. Nach einem von Oyr. Spangenberg aufbewahrten Urkundenauszuge,
gegen dessen Echtheit sich kein erheblicher Verdacht geltend machen lässt, hat
Kaiser Heinrich III. im Jahre 1042 dem Kloster Mansfeld für „ein schön güldenes
creutz, mit edelgesteinen gezieret, und ein wunderbar künstliches krüglein, so
* So auch Puttrich II, 2, Eisleben S. 11. Und so schon Cyr. Spangenberg in der noch
zu nennenden Schrift, obwohl er sich dabei in einen Selbstwiderspruch verwickelt. 2 Oyr,
Spangenberg, Historia von Ankunft, Stifltung und anderen Sachen des Klosters Mansfeld.
Eisleben, Andreas Petri 1574. Dieses Schriftchen ist sehr selten geworden.