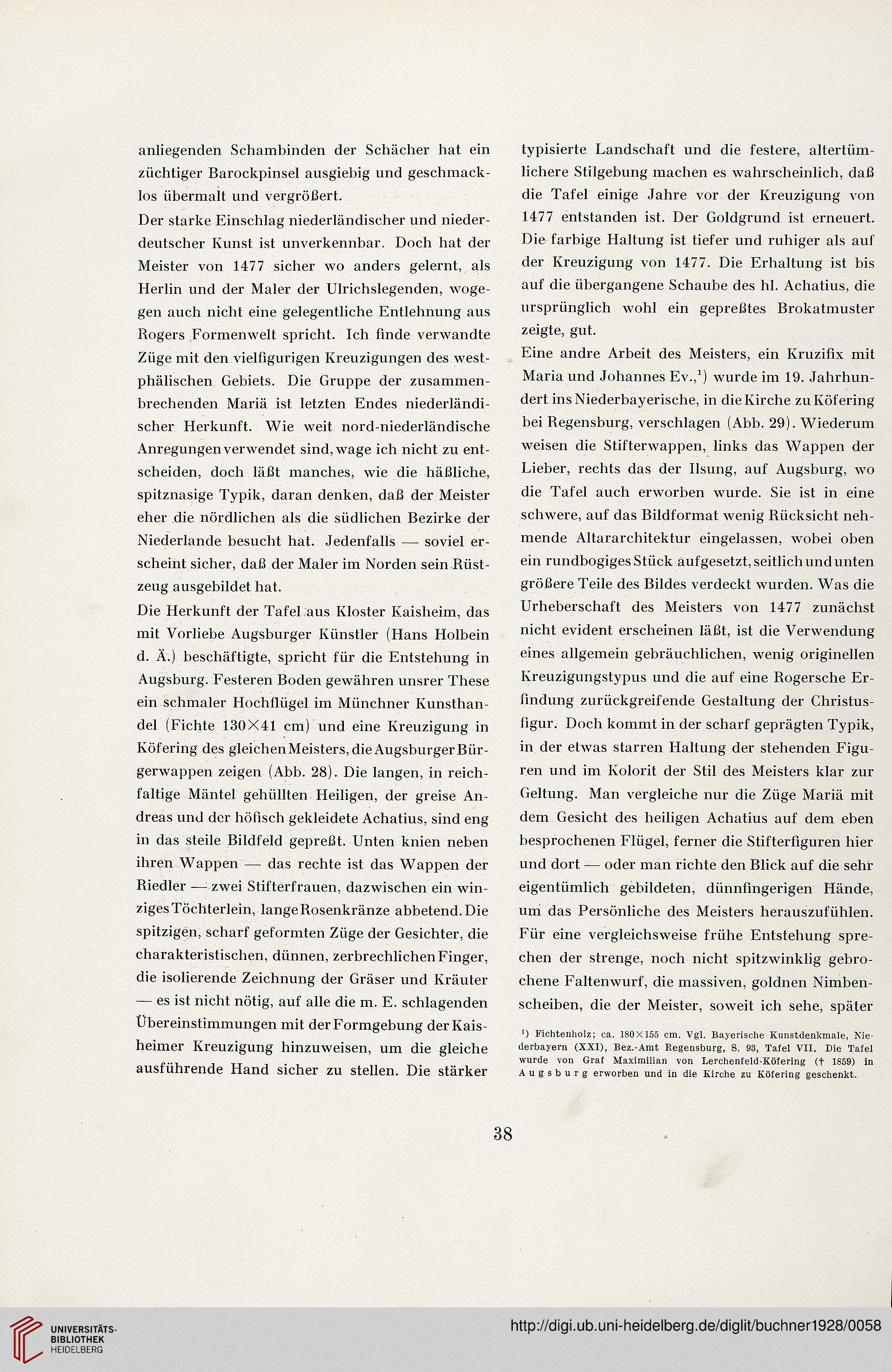anliegenden Schambinden der Schächer hat ein
züchtiger Barockpinsel ausgiebig und geschmack-
los übermalt und vergrößert.
Der starke Einschlag niederländischer und nieder-
deutscher Kunst ist unverkennbar. Doch hat der
Meister von 1477 sicher wo anders gelernt, als
Herlin und der Maler der Ulrichslegenden, woge-
gen auch nicht eine gelegentliche Entlehnung aus
Rogers Formenwelt spricht. Ich linde verwandte
Züge mit den vielügurigen Kreuzigungen des west
phälischen Gebiets. Die Gruppe der zusammen-
hrechenden Mariä ist letzten Endes niederländi-
scher Herkunft. Wie weit nord-niederländische
Anregungen verwendet sind, wage ich nicht zu ent-
scheiden, doch läßt manches, wie die häßliche,
spitznasige Typik, daran denken, daß der Meister
eher die nördlichen als die südlichen Bezirke der
Niederlande besucht hat. Jedenfalls — soviel er-
scheint sicher, daß der Maler im Norden sein Rüst-
zeug ausgebildet hat.
Die Herkunft der Tafel aus Kloster Kaislieim, das
mit Vorliebe Augsburger Künstler (Hans Holhein
d. A.) beschäftigte, spricht für die Entstehung in
Augsburg. Festeren Boden gewähren unsrer These
ein schmaler Hochllügel im Münchner Kunsthan-
del (Fichte 130X41 cm) und eine Kreuzigung in
Kölering des gleichen Meisters, die Augsburger Bür-
gerwappen zeigen (Abb. 28). Die langen, in reich-
faltige Mäntel gehüllten Heiligen, der greise An-
dreas und der höfisch gekleidete Achatius, sind eng
in das steile Bildfeld gepreßt. Unten knien neben
ihren Wappen — das rechte ist das Wappen der
Riedler — zwei Stifterfrauen, dazwischen ein win-
zigesTöchterlein, lange Rosenkränze abbetend. Die
spitzigen, scharf geformten Züge der Gesichter, die
charakteristischen, dünnen, zerbrechlichen Finger,
die isolierende Zeichnung der Gräser und Kräuter
— es ist nicht nötig, auf alle die m. E. schlagenden
Übereinstimmungen mit der Formgebung derKais-
heimer Kreuzigung hinzuweisen, um die gleiche
ausführende Hand sicher zu stellen. Die stärker
typisierte Landschaft und die festere, altertüm-
lichere Slilgehung machen es wahrscheinlich, daß
die Tafel einige Jahre vor der Kreuzigung von
1477 entstanden ist. Der Goldgrund ist erneuert.
Die farbige Haltung ist tiefer und ruhiger als auf
der Kreuzigung von 1477. Die Erhaltung ist bis
auf die übergangene Schaube des hl. Achatius, die
ursprünglich wohl ein gepreßtes Brokatmuster
zeigte, gut.
Eine andre Arbeit des Meisters, ein Kruzifix mit
Maria und Johannes Ev./) wurde im 19. Jahrhun-
dert ins Niederbayerische, in die Kirche zu Kölering
hei Kegenshurg, verschlagen (Ahb. 29). Wiederum
weisen die Stifterwappen, links das Wappen der
Lieber, rechts das der llsung, auf Augsburg, wo
die Tafel auch erworben wurde. Sie ist in eine
schwere, auf das Bildformat wenig Rücksicht lieh
mende Altararchitektur eingelassen, wobei oben
ein rundbogiges Stück aufgesetzt, seitlich und unten
größere Teile des Bildes verdeckt wurden. Was die
Urheberschaft des Meisters von 1477 zunächst
nicht evident erscheinen läßt, ist die Verwendung
eines allgemein gebräuchlichen, wenig originellen
Kreuzigungstypus und die auf eine Rogersche Er-
findung zurückgreifende Gestaltung der Ghristus-
ligur. Doch kommt in der scharf geprägten Typik,
in der etwas starren Haltung der stehenden Figu-
ren und im Kolorit der Stil des Meisters klar zur
Geltung. Man vergleiche nur die Züge Mariä mit
dem Gesicht des heiligen Achatius auf dem eben
besprochenen Flügel, ferner die Stifterhguren hier
und dort — oder man richte den Blick auf die sehr
eigentümlich gebildeten, dünnlingerigen Hände,
um das Persönliche des Meisters herauszufühlen.
Für eine vergleichsweise frühe Entstehung spre-
chen der strenge, noch nicht spitzwinklig gebro-
chene Faltenwurf, die massiven, goldnen Nimben-
scheiben, die der Meister, soweit ich sehe, später
*) Fichtenholz; ca. 180X155 cm. Vgl. Bayerische Kunstdenkmaie, Nie-
derbayern (XXI), Bez.-Amt Regensburg, S. 93, Tafel VII. Die Tafel
wurde von Graf Maximilian von Lerchenfeid-Köfering (f 1859) in
Augsburg erworben und in die Kirche zu Köfering geschenkt.
38
züchtiger Barockpinsel ausgiebig und geschmack-
los übermalt und vergrößert.
Der starke Einschlag niederländischer und nieder-
deutscher Kunst ist unverkennbar. Doch hat der
Meister von 1477 sicher wo anders gelernt, als
Herlin und der Maler der Ulrichslegenden, woge-
gen auch nicht eine gelegentliche Entlehnung aus
Rogers Formenwelt spricht. Ich linde verwandte
Züge mit den vielügurigen Kreuzigungen des west
phälischen Gebiets. Die Gruppe der zusammen-
hrechenden Mariä ist letzten Endes niederländi-
scher Herkunft. Wie weit nord-niederländische
Anregungen verwendet sind, wage ich nicht zu ent-
scheiden, doch läßt manches, wie die häßliche,
spitznasige Typik, daran denken, daß der Meister
eher die nördlichen als die südlichen Bezirke der
Niederlande besucht hat. Jedenfalls — soviel er-
scheint sicher, daß der Maler im Norden sein Rüst-
zeug ausgebildet hat.
Die Herkunft der Tafel aus Kloster Kaislieim, das
mit Vorliebe Augsburger Künstler (Hans Holhein
d. A.) beschäftigte, spricht für die Entstehung in
Augsburg. Festeren Boden gewähren unsrer These
ein schmaler Hochllügel im Münchner Kunsthan-
del (Fichte 130X41 cm) und eine Kreuzigung in
Kölering des gleichen Meisters, die Augsburger Bür-
gerwappen zeigen (Abb. 28). Die langen, in reich-
faltige Mäntel gehüllten Heiligen, der greise An-
dreas und der höfisch gekleidete Achatius, sind eng
in das steile Bildfeld gepreßt. Unten knien neben
ihren Wappen — das rechte ist das Wappen der
Riedler — zwei Stifterfrauen, dazwischen ein win-
zigesTöchterlein, lange Rosenkränze abbetend. Die
spitzigen, scharf geformten Züge der Gesichter, die
charakteristischen, dünnen, zerbrechlichen Finger,
die isolierende Zeichnung der Gräser und Kräuter
— es ist nicht nötig, auf alle die m. E. schlagenden
Übereinstimmungen mit der Formgebung derKais-
heimer Kreuzigung hinzuweisen, um die gleiche
ausführende Hand sicher zu stellen. Die stärker
typisierte Landschaft und die festere, altertüm-
lichere Slilgehung machen es wahrscheinlich, daß
die Tafel einige Jahre vor der Kreuzigung von
1477 entstanden ist. Der Goldgrund ist erneuert.
Die farbige Haltung ist tiefer und ruhiger als auf
der Kreuzigung von 1477. Die Erhaltung ist bis
auf die übergangene Schaube des hl. Achatius, die
ursprünglich wohl ein gepreßtes Brokatmuster
zeigte, gut.
Eine andre Arbeit des Meisters, ein Kruzifix mit
Maria und Johannes Ev./) wurde im 19. Jahrhun-
dert ins Niederbayerische, in die Kirche zu Kölering
hei Kegenshurg, verschlagen (Ahb. 29). Wiederum
weisen die Stifterwappen, links das Wappen der
Lieber, rechts das der llsung, auf Augsburg, wo
die Tafel auch erworben wurde. Sie ist in eine
schwere, auf das Bildformat wenig Rücksicht lieh
mende Altararchitektur eingelassen, wobei oben
ein rundbogiges Stück aufgesetzt, seitlich und unten
größere Teile des Bildes verdeckt wurden. Was die
Urheberschaft des Meisters von 1477 zunächst
nicht evident erscheinen läßt, ist die Verwendung
eines allgemein gebräuchlichen, wenig originellen
Kreuzigungstypus und die auf eine Rogersche Er-
findung zurückgreifende Gestaltung der Ghristus-
ligur. Doch kommt in der scharf geprägten Typik,
in der etwas starren Haltung der stehenden Figu-
ren und im Kolorit der Stil des Meisters klar zur
Geltung. Man vergleiche nur die Züge Mariä mit
dem Gesicht des heiligen Achatius auf dem eben
besprochenen Flügel, ferner die Stifterhguren hier
und dort — oder man richte den Blick auf die sehr
eigentümlich gebildeten, dünnlingerigen Hände,
um das Persönliche des Meisters herauszufühlen.
Für eine vergleichsweise frühe Entstehung spre-
chen der strenge, noch nicht spitzwinklig gebro-
chene Faltenwurf, die massiven, goldnen Nimben-
scheiben, die der Meister, soweit ich sehe, später
*) Fichtenholz; ca. 180X155 cm. Vgl. Bayerische Kunstdenkmaie, Nie-
derbayern (XXI), Bez.-Amt Regensburg, S. 93, Tafel VII. Die Tafel
wurde von Graf Maximilian von Lerchenfeid-Köfering (f 1859) in
Augsburg erworben und in die Kirche zu Köfering geschenkt.
38