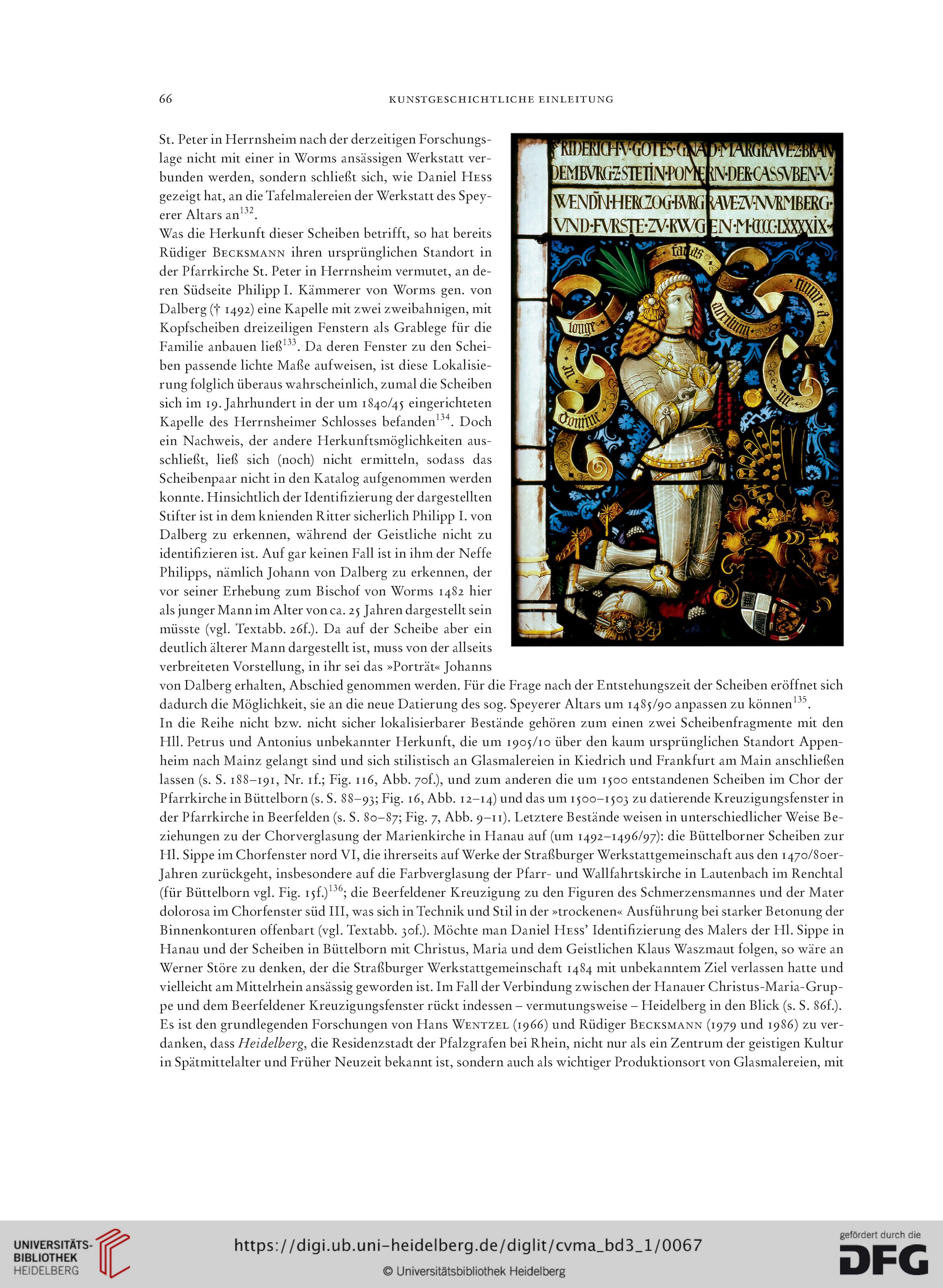66
KUNSTGESCHICHTLICHE EINLEITUNG
St. Peter in Herrnsheim nach der derzeitigen Forschungs-
lage nicht mit einer in Worms ansässigen Werkstatt ver-
bunden werden, sondern schließt sich, wie Daniel Hess
gezeigt hat, an die Tafelmalereien der Werkstatt des Spey-
erer Altars an132.
Was die Herkunft dieser Scheiben betrifft, so hat bereits
Rüdiger Becksmann ihren ursprünglichen Standort in
der Pfarrkirche St. Peter in Herrnsheim vermutet, an de-
ren Südseite Philipp I. Kämmerer von Worms gen. von
Dalberg (f 1492) eine Kapelle mit zwei zweibahnigen, mit
Kopfscheiben dreizeiligen Fenstern als Grablege für die
Familie anbauen ließ133. Da deren Fenster zu den Schei-
ben passende lichte Maße aufweisen, ist diese Lokalisie-
rung folglich überaus wahrscheinlich, zumal die Scheiben
sich im 19. Jahrhundert in der um 1840/45 eingerichteten
Kapelle des Herrnsheimer Schlosses befanden134. Doch
ein Nachweis, der andere Herkunftsmöglichkeiten aus-
schließt, ließ sich (noch) nicht ermitteln, sodass das
Scheibenpaar nicht in den Katalog aufgenommen werden
konnte. Hinsichtlich der Identifizierung der dargestellten
Stifter ist in dem knienden Ritter sicherlich Philipp I. von
Dalberg zu erkennen, während der Geistliche nicht zu
identifizieren ist. Auf gar keinen Fall ist in ihm der Neffe
Philipps, nämlich Johann von Dalberg zu erkennen, der
vor seiner Erhebung zum Bischof von Worms 1482 hier
als junger Mann im Alter von ca. 25 Jahren dargestellt sein
müsste (vgl. Textabb. 26E). Da auf der Scheibe aber ein
deutlich älterer Mann dargestellt ist, muss von der allseits
verbreiteten Vorstellung, in ihr sei das »Porträt« Johanns
von Dalberg erhalten, Abschied genommen werden. Für die Frage nach der Entstehungszeit der Scheiben eröffnet sich
dadurch die Möglichkeit, sie an die neue Datierung des sog. Speyerer Altars um 1485/90 anpassen zu können135.
In die Reihe nicht bzw. nicht sicher lokalisierbarer Bestände gehören zum einen zwei Scheibenfragmente mit den
Hll. Petrus und Antonius unbekannter Herkunft, die um 1905/10 über den kaum ursprünglichen Standort Appen-
heim nach Mainz gelangt sind und sich stilistisch an Glasmalereien in Kiedrich und Frankfurt am Main anschließen
lassen (s. S. 188-191, Nr. if.; Fig. 116, Abb. 70E), und zum anderen die um 1500 entstandenen Scheiben im Chor der
Pfarrkirche in Büttelborn (s. S. 88-93; Fig- Abb. 12-14) und das um 1500-1503 zu datierende Kreuzigungsfenster in
der Pfarrkirche in Beerfelden (s. S. 80-87; Fig- 7, Abb. 9-11). Letztere Bestände weisen in unterschiedlicher Weise Be-
ziehungen zu der Chorverglasung der Marienkirche in Hanau auf (um 1492-1496/97): die Büttelborner Scheiben zur
Hl. Sippe im Chorfenster nord VI, die ihrerseits auf Werke der Straßburger Werkstattgemeinschaft aus den 1470/8 oer-
Jahren zurückgeht, insbesondere auf die Farbverglasung der Pfarr- und Wallfahrtskirche in Lautenbach im Renchtal
(für Büttelborn vgl. Fig. 15E)136; die Beerfeldener Kreuzigung zu den Figuren des Schmerzensmannes und der Mater
dolorosa im Chorfenster süd III, was sich in Technik und Stil in der »trockenen« Ausführung bei starker Betonung der
Binnenkonturen offenbart (vgl. Textabb. 30L). Möchte man Daniel Hess’ Identifizierung des Malers der Hl. Sippe in
Hanau und der Scheiben in Büttelborn mit Christus, Maria und dem Geistlichen Klaus Waszmaut folgen, so wäre an
Werner Störe zu denken, der die Straßburger Werkstattgemeinschaft 1484 mit unbekanntem Ziel verlassen hatte und
vielleicht am Mittelrhein ansässig geworden ist. Im Fall der Verbindung zwischen der Hanauer Christus-Maria-Grup-
pe und dem Beerfeldener Kreuzigungsfenster rückt indessen - vermutungsweise - Heidelberg in den Blick (s. S. 86f.).
Es ist den grundlegenden Forschungen von Hans Wentzel (1966) und Rüdiger Becksmann (1979 und 1986) zu ver-
danken, dass Heidelberg, die Residenzstadt der Pfalzgrafen bei Rhein, nicht nur als ein Zentrum der geistigen Kultur
in Spätmittelalter und Früher Neuzeit bekannt ist, sondern auch als wichtiger Produktionsort von Glasmalereien, mit
KUNSTGESCHICHTLICHE EINLEITUNG
St. Peter in Herrnsheim nach der derzeitigen Forschungs-
lage nicht mit einer in Worms ansässigen Werkstatt ver-
bunden werden, sondern schließt sich, wie Daniel Hess
gezeigt hat, an die Tafelmalereien der Werkstatt des Spey-
erer Altars an132.
Was die Herkunft dieser Scheiben betrifft, so hat bereits
Rüdiger Becksmann ihren ursprünglichen Standort in
der Pfarrkirche St. Peter in Herrnsheim vermutet, an de-
ren Südseite Philipp I. Kämmerer von Worms gen. von
Dalberg (f 1492) eine Kapelle mit zwei zweibahnigen, mit
Kopfscheiben dreizeiligen Fenstern als Grablege für die
Familie anbauen ließ133. Da deren Fenster zu den Schei-
ben passende lichte Maße aufweisen, ist diese Lokalisie-
rung folglich überaus wahrscheinlich, zumal die Scheiben
sich im 19. Jahrhundert in der um 1840/45 eingerichteten
Kapelle des Herrnsheimer Schlosses befanden134. Doch
ein Nachweis, der andere Herkunftsmöglichkeiten aus-
schließt, ließ sich (noch) nicht ermitteln, sodass das
Scheibenpaar nicht in den Katalog aufgenommen werden
konnte. Hinsichtlich der Identifizierung der dargestellten
Stifter ist in dem knienden Ritter sicherlich Philipp I. von
Dalberg zu erkennen, während der Geistliche nicht zu
identifizieren ist. Auf gar keinen Fall ist in ihm der Neffe
Philipps, nämlich Johann von Dalberg zu erkennen, der
vor seiner Erhebung zum Bischof von Worms 1482 hier
als junger Mann im Alter von ca. 25 Jahren dargestellt sein
müsste (vgl. Textabb. 26E). Da auf der Scheibe aber ein
deutlich älterer Mann dargestellt ist, muss von der allseits
verbreiteten Vorstellung, in ihr sei das »Porträt« Johanns
von Dalberg erhalten, Abschied genommen werden. Für die Frage nach der Entstehungszeit der Scheiben eröffnet sich
dadurch die Möglichkeit, sie an die neue Datierung des sog. Speyerer Altars um 1485/90 anpassen zu können135.
In die Reihe nicht bzw. nicht sicher lokalisierbarer Bestände gehören zum einen zwei Scheibenfragmente mit den
Hll. Petrus und Antonius unbekannter Herkunft, die um 1905/10 über den kaum ursprünglichen Standort Appen-
heim nach Mainz gelangt sind und sich stilistisch an Glasmalereien in Kiedrich und Frankfurt am Main anschließen
lassen (s. S. 188-191, Nr. if.; Fig. 116, Abb. 70E), und zum anderen die um 1500 entstandenen Scheiben im Chor der
Pfarrkirche in Büttelborn (s. S. 88-93; Fig- Abb. 12-14) und das um 1500-1503 zu datierende Kreuzigungsfenster in
der Pfarrkirche in Beerfelden (s. S. 80-87; Fig- 7, Abb. 9-11). Letztere Bestände weisen in unterschiedlicher Weise Be-
ziehungen zu der Chorverglasung der Marienkirche in Hanau auf (um 1492-1496/97): die Büttelborner Scheiben zur
Hl. Sippe im Chorfenster nord VI, die ihrerseits auf Werke der Straßburger Werkstattgemeinschaft aus den 1470/8 oer-
Jahren zurückgeht, insbesondere auf die Farbverglasung der Pfarr- und Wallfahrtskirche in Lautenbach im Renchtal
(für Büttelborn vgl. Fig. 15E)136; die Beerfeldener Kreuzigung zu den Figuren des Schmerzensmannes und der Mater
dolorosa im Chorfenster süd III, was sich in Technik und Stil in der »trockenen« Ausführung bei starker Betonung der
Binnenkonturen offenbart (vgl. Textabb. 30L). Möchte man Daniel Hess’ Identifizierung des Malers der Hl. Sippe in
Hanau und der Scheiben in Büttelborn mit Christus, Maria und dem Geistlichen Klaus Waszmaut folgen, so wäre an
Werner Störe zu denken, der die Straßburger Werkstattgemeinschaft 1484 mit unbekanntem Ziel verlassen hatte und
vielleicht am Mittelrhein ansässig geworden ist. Im Fall der Verbindung zwischen der Hanauer Christus-Maria-Grup-
pe und dem Beerfeldener Kreuzigungsfenster rückt indessen - vermutungsweise - Heidelberg in den Blick (s. S. 86f.).
Es ist den grundlegenden Forschungen von Hans Wentzel (1966) und Rüdiger Becksmann (1979 und 1986) zu ver-
danken, dass Heidelberg, die Residenzstadt der Pfalzgrafen bei Rhein, nicht nur als ein Zentrum der geistigen Kultur
in Spätmittelalter und Früher Neuzeit bekannt ist, sondern auch als wichtiger Produktionsort von Glasmalereien, mit