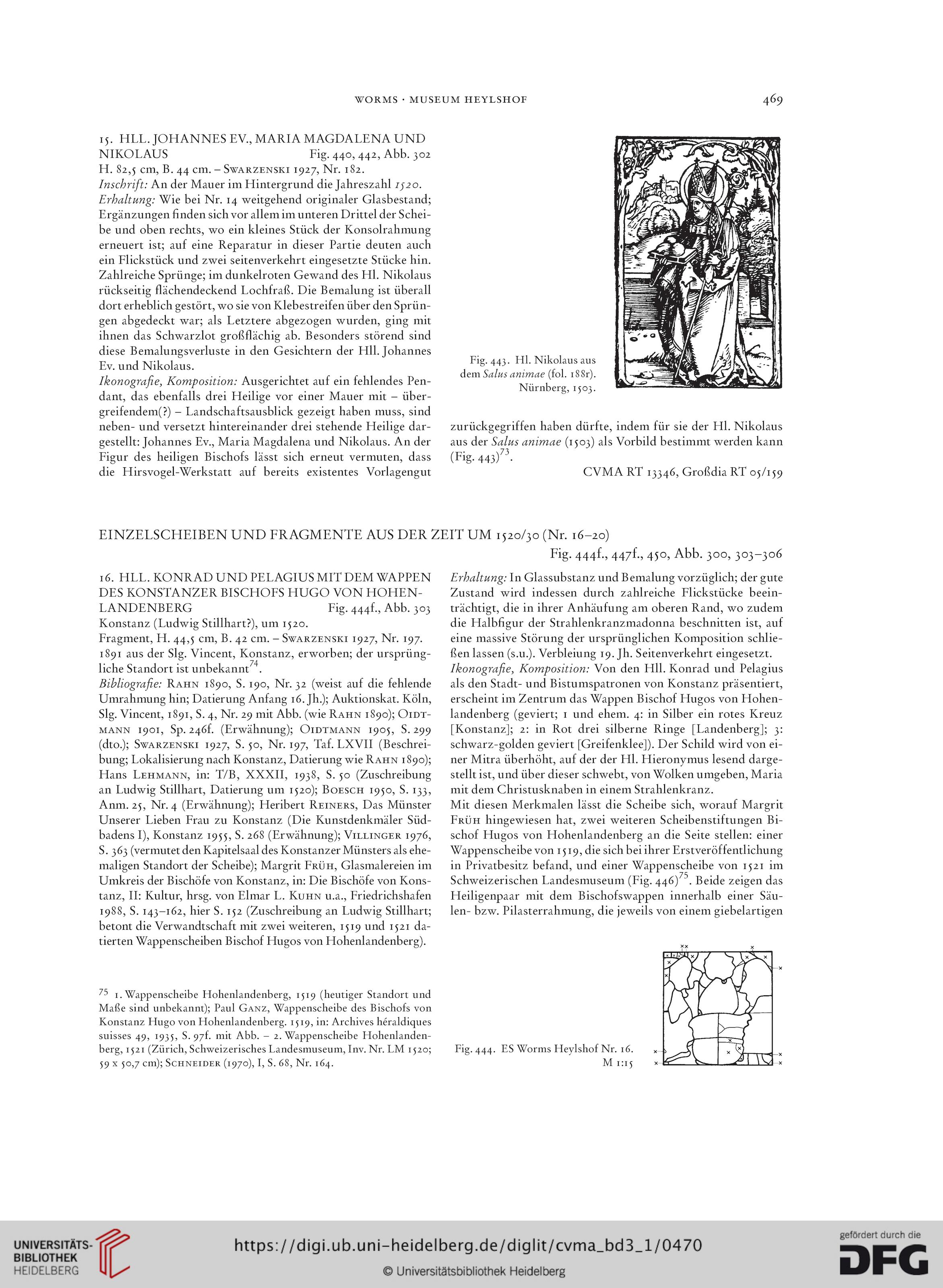WORMS • MUSEUM HEYLSHOF
469
15. HLL. JOHANNES EV., MARIA MAGDALENA UND
NIKOLAUS Fig. 440, 442, Abb. 302
H. 82,5 cm, B. 44 cm. - Swarzenski 1927, Nr. 182.
Inschrift: An der Mauer im Hintergrund die Jahreszahl 7520.
Erhaltung: Wie bei Nr. 14 weitgehend originaler Glasbestand;
Ergänzungen finden sich vor allem im unteren Drittel der Schei-
be und oben rechts, wo ein kleines Stück der Konsolrahmung
erneuert ist; auf eine Reparatur in dieser Partie deuten auch
ein Flickstück und zwei seitenverkehrt eingesetzte Stücke hin.
Zahlreiche Sprünge; im dunkelroten Gewand des Hl. Nikolaus
rückseitig flächendeckend Lochfraß. Die Bemalung ist überall
dort erheblich gestört, wo sie von Klebestreifen über den Sprün-
gen abgedeckt war; als Letztere abgezogen wurden, ging mit
ihnen das Schwarzlot großflächig ab. Besonders störend sind
diese Bemalungsverluste in den Gesichtern der Hll. Johannes
Ev. und Nikolaus.
Ikonografie, Komposition: Ausgerichtet auf ein fehlendes Pen-
dant, das ebenfalls drei Heilige vor einer Mauer mit - über-
greifendem(?) - Landschaftsausblick gezeigt haben muss, sind
neben- und versetzt hintereinander drei stehende Heilige dar-
gestellt: Johannes Ev., Maria Magdalena und Nikolaus. An der
Figur des heiligen Bischofs lässt sich erneut vermuten, dass
die Hirsvogel-Werkstatt auf bereits existentes Vorlagengut
Fig. 443. Hl. Nikolaus aus
dem Salus animae (fol. iS8r).
Nürnberg, 1503.
zurückgegriffen haben dürfte, indem für sie der Hl. Nikolaus
aus der Salus animae (1503) als Vorbild bestimmt werden kann
(Fig- 443)73-
CVMA RT 13346, Großdia RT 05/159
EINZELSCHEIBEN UND FRAGMENTE AUS DER ZEIT UM 1520/30 (Nr. 16-20)
Fig. 444E, 447E, 450, Abb. 300, 303-306
16. HLL. KONRAD UND PELAGIUS MIT DEM WAPPEN
DES KONSTANZER BISCHOFS HUGO VON HOHEN-
LANDENBERG Fig. 444f., Abb. 303
Konstanz (Ludwig Stillhart?), um 1520.
Fragment, H. 44,5 cm, B. 42 cm. - Swarzenski 1927, Nr. 197.
1891 aus der Slg. Vincent, Konstanz, erworben; der ursprüng-
liche Standort ist unbekannt74.
Bibliografie: Rahn 1890, S. 190, Nr. 32 (weist auf die fehlende
Umrahmung hin; Datierung Anfang 16. Jh.); Auktionskat. Köln,
Slg. Vincent, 1891, S. 4, Nr. 29 mit Abb. (wie Rahn 1890); Oidt-
mann 1901, Sp. 246L (Erwähnung); Oidtmann 1905, S. 299
(dto.); Swarzenski 1927, S. 50, Nr. 197, Taf. LXVII (Beschrei-
bung; Lokalisierung nach Konstanz, Datierung wie Rahn 1890);
Hans Lehmann, in: T/B, XXXII, 1938, S. 50 (Zuschreibung
an Ludwig Stillhart, Datierung um 1520); Boesch 1950, S. 133,
Anm. 25, Nr. 4 (Erwähnung); Heribert Reiners, Das Münster
Unserer Lieben Frau zu Konstanz (Die Kunstdenkmäler Süd-
badens I), Konstanz 1955, S. 268 (Erwähnung); Villinger 1976,
S. 363 (vermutet den Kapitelsaal des Konstanzer Münsters als ehe-
maligen Standort der Scheibe); Margrit Früh, Glasmalereien im
Umkreis der Bischöfe von Konstanz, in: Die Bischöfe von Kons-
tanz, II: Kultur, hrsg. von Elmar L. Kuhn u.a., Friedrichshafen
1988, S. 143-162, hier S. 152 (Zuschreibung an Ludwig Stillhart;
betont die Verwandtschaft mit zwei weiteren, 1519 und 1521 da-
tierten Wappenscheiben Bischof Hugos von Hohenlandenberg).
75 1. Wappenscheibe Hohenlandenberg, 1519 (heutiger Standort und
Maße sind unbekannt); Paul Ganz, Wappenscheibe des Bischofs von
Konstanz Hugo von Hohenlandenberg. 1519, in: Archives heraldiques
suisses 49, 1935, S. 97k mit Abb. - 2. Wappenscheibe Hohenlanden-
berg, 1521 (Zürich, Schweizerisches Landesmuseum, Inv. Nr. LM 1520;
59 x 50,7 cm); Schneider (1970), I, S. 68, Nr. 164.
Erhaltung: In Glassubstanz und Bemalung vorzüglich; der gute
Zustand wird indessen durch zahlreiche Flickstücke beein-
trächtigt, die in ihrer Anhäufung am oberen Rand, wo zudem
die Halbfigur der Strahlenkranzmadonna beschnitten ist, auf
eine massive Störung der ursprünglichen Komposition schlie-
ßen lassen (s.u.). Verbleiung 19. Jh. Seitenverkehrt eingesetzt.
Ikonografie, Komposition: Von den Hll. Konrad und Pelagius
als den Stadt- und Bistumspatronen von Konstanz präsentiert,
erscheint im Zentrum das Wappen Bischof Hugos von Hohen-
landenberg (geviert; 1 und ehern. 4: in Silber ein rotes Kreuz
[Konstanz]; 2: in Rot drei silberne Ringe [Landenberg]; 3:
schwarz-golden geviert [Greifenklee]). Der Schild wird von ei-
ner Mitra überhöht, auf der der Hl. Hieronymus lesend darge-
stellt ist, und über dieser schwebt, von Wolken umgeben, Maria
mit dem Christusknaben in einem Strahlenkranz.
Mit diesen Merkmalen lässt die Scheibe sich, worauf Margrit
Früh hingewiesen hat, zwei weiteren Scheibenstiftungen Bi-
schof Hugos von Hohenlandenberg an die Seite stellen: einer
Wappenscheibe von 1519, die sich bei ihrer Erstveröffentlichung
in Privatbesitz befand, und einer Wappenscheibe von 1521 im
Schweizerischen Landesmuseum (Fig. 446)75. Beide zeigen das
Heiligenpaar mit dem Bischofswappen innerhalb einer Säu-
len- bzw. Pilasterrahmung, die jeweils von einem giebelartigen
Fig. 444. ES Worms Heylshof Nr. 16.
M 1:15
469
15. HLL. JOHANNES EV., MARIA MAGDALENA UND
NIKOLAUS Fig. 440, 442, Abb. 302
H. 82,5 cm, B. 44 cm. - Swarzenski 1927, Nr. 182.
Inschrift: An der Mauer im Hintergrund die Jahreszahl 7520.
Erhaltung: Wie bei Nr. 14 weitgehend originaler Glasbestand;
Ergänzungen finden sich vor allem im unteren Drittel der Schei-
be und oben rechts, wo ein kleines Stück der Konsolrahmung
erneuert ist; auf eine Reparatur in dieser Partie deuten auch
ein Flickstück und zwei seitenverkehrt eingesetzte Stücke hin.
Zahlreiche Sprünge; im dunkelroten Gewand des Hl. Nikolaus
rückseitig flächendeckend Lochfraß. Die Bemalung ist überall
dort erheblich gestört, wo sie von Klebestreifen über den Sprün-
gen abgedeckt war; als Letztere abgezogen wurden, ging mit
ihnen das Schwarzlot großflächig ab. Besonders störend sind
diese Bemalungsverluste in den Gesichtern der Hll. Johannes
Ev. und Nikolaus.
Ikonografie, Komposition: Ausgerichtet auf ein fehlendes Pen-
dant, das ebenfalls drei Heilige vor einer Mauer mit - über-
greifendem(?) - Landschaftsausblick gezeigt haben muss, sind
neben- und versetzt hintereinander drei stehende Heilige dar-
gestellt: Johannes Ev., Maria Magdalena und Nikolaus. An der
Figur des heiligen Bischofs lässt sich erneut vermuten, dass
die Hirsvogel-Werkstatt auf bereits existentes Vorlagengut
Fig. 443. Hl. Nikolaus aus
dem Salus animae (fol. iS8r).
Nürnberg, 1503.
zurückgegriffen haben dürfte, indem für sie der Hl. Nikolaus
aus der Salus animae (1503) als Vorbild bestimmt werden kann
(Fig- 443)73-
CVMA RT 13346, Großdia RT 05/159
EINZELSCHEIBEN UND FRAGMENTE AUS DER ZEIT UM 1520/30 (Nr. 16-20)
Fig. 444E, 447E, 450, Abb. 300, 303-306
16. HLL. KONRAD UND PELAGIUS MIT DEM WAPPEN
DES KONSTANZER BISCHOFS HUGO VON HOHEN-
LANDENBERG Fig. 444f., Abb. 303
Konstanz (Ludwig Stillhart?), um 1520.
Fragment, H. 44,5 cm, B. 42 cm. - Swarzenski 1927, Nr. 197.
1891 aus der Slg. Vincent, Konstanz, erworben; der ursprüng-
liche Standort ist unbekannt74.
Bibliografie: Rahn 1890, S. 190, Nr. 32 (weist auf die fehlende
Umrahmung hin; Datierung Anfang 16. Jh.); Auktionskat. Köln,
Slg. Vincent, 1891, S. 4, Nr. 29 mit Abb. (wie Rahn 1890); Oidt-
mann 1901, Sp. 246L (Erwähnung); Oidtmann 1905, S. 299
(dto.); Swarzenski 1927, S. 50, Nr. 197, Taf. LXVII (Beschrei-
bung; Lokalisierung nach Konstanz, Datierung wie Rahn 1890);
Hans Lehmann, in: T/B, XXXII, 1938, S. 50 (Zuschreibung
an Ludwig Stillhart, Datierung um 1520); Boesch 1950, S. 133,
Anm. 25, Nr. 4 (Erwähnung); Heribert Reiners, Das Münster
Unserer Lieben Frau zu Konstanz (Die Kunstdenkmäler Süd-
badens I), Konstanz 1955, S. 268 (Erwähnung); Villinger 1976,
S. 363 (vermutet den Kapitelsaal des Konstanzer Münsters als ehe-
maligen Standort der Scheibe); Margrit Früh, Glasmalereien im
Umkreis der Bischöfe von Konstanz, in: Die Bischöfe von Kons-
tanz, II: Kultur, hrsg. von Elmar L. Kuhn u.a., Friedrichshafen
1988, S. 143-162, hier S. 152 (Zuschreibung an Ludwig Stillhart;
betont die Verwandtschaft mit zwei weiteren, 1519 und 1521 da-
tierten Wappenscheiben Bischof Hugos von Hohenlandenberg).
75 1. Wappenscheibe Hohenlandenberg, 1519 (heutiger Standort und
Maße sind unbekannt); Paul Ganz, Wappenscheibe des Bischofs von
Konstanz Hugo von Hohenlandenberg. 1519, in: Archives heraldiques
suisses 49, 1935, S. 97k mit Abb. - 2. Wappenscheibe Hohenlanden-
berg, 1521 (Zürich, Schweizerisches Landesmuseum, Inv. Nr. LM 1520;
59 x 50,7 cm); Schneider (1970), I, S. 68, Nr. 164.
Erhaltung: In Glassubstanz und Bemalung vorzüglich; der gute
Zustand wird indessen durch zahlreiche Flickstücke beein-
trächtigt, die in ihrer Anhäufung am oberen Rand, wo zudem
die Halbfigur der Strahlenkranzmadonna beschnitten ist, auf
eine massive Störung der ursprünglichen Komposition schlie-
ßen lassen (s.u.). Verbleiung 19. Jh. Seitenverkehrt eingesetzt.
Ikonografie, Komposition: Von den Hll. Konrad und Pelagius
als den Stadt- und Bistumspatronen von Konstanz präsentiert,
erscheint im Zentrum das Wappen Bischof Hugos von Hohen-
landenberg (geviert; 1 und ehern. 4: in Silber ein rotes Kreuz
[Konstanz]; 2: in Rot drei silberne Ringe [Landenberg]; 3:
schwarz-golden geviert [Greifenklee]). Der Schild wird von ei-
ner Mitra überhöht, auf der der Hl. Hieronymus lesend darge-
stellt ist, und über dieser schwebt, von Wolken umgeben, Maria
mit dem Christusknaben in einem Strahlenkranz.
Mit diesen Merkmalen lässt die Scheibe sich, worauf Margrit
Früh hingewiesen hat, zwei weiteren Scheibenstiftungen Bi-
schof Hugos von Hohenlandenberg an die Seite stellen: einer
Wappenscheibe von 1519, die sich bei ihrer Erstveröffentlichung
in Privatbesitz befand, und einer Wappenscheibe von 1521 im
Schweizerischen Landesmuseum (Fig. 446)75. Beide zeigen das
Heiligenpaar mit dem Bischofswappen innerhalb einer Säu-
len- bzw. Pilasterrahmung, die jeweils von einem giebelartigen
Fig. 444. ES Worms Heylshof Nr. 16.
M 1:15