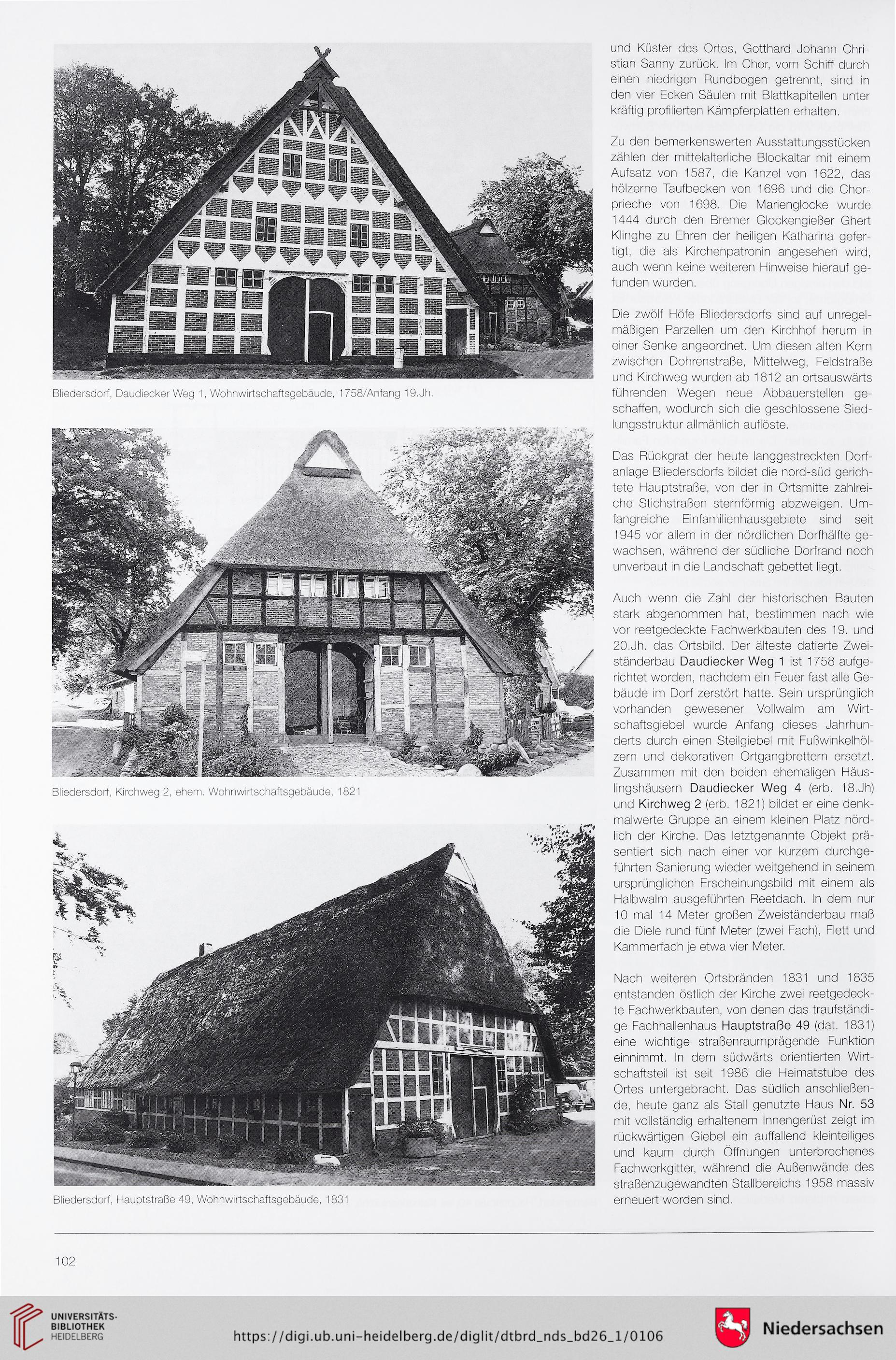Bliedersdorf, Daudiecker Weg 1, Wohnwirtschaftsgebäude, 1758/Anfang 19.Jh.
Bliedersdorf, Kirchweg 2, ehern. Wohnwirtschaftsgebäude, 1821
Bliedersdorf, Hauptstraße 49, Wohnwirtschaftsgebäude, 1831
und Küster des Ortes, Gotthard Johann Chri-
stian Sanny zurück. Im Chor, vom Schiff durch
einen niedrigen Rundbogen getrennt, sind in
den vier Ecken Säulen mit Blattkapitellen unter
kräftig profilierten Kämpferplatten erhalten.
Zu den bemerkenswerten Ausstattungsstücken
zählen der mittelalterliche Blockaltar mit einem
Aufsatz von 1587, die Kanzel von 1622, das
hölzerne Taufbecken von 1696 und die Chor-
prieche von 1698. Die Marienglocke wurde
1444 durch den Bremer Glockengießer Ghert
Klinghe zu Ehren der heiligen Katharina gefer-
tigt, die als Kirchenpatronin angesehen wird,
auch wenn keine weiteren Hinweise hierauf ge-
funden wurden.
Die zwölf Höfe Bliedersdorfs sind auf unregel-
mäßigen Parzellen um den Kirchhof herum in
einer Senke angeordnet. Um diesen alten Kern
zwischen Dohrenstraße, Mittelweg, Feldstraße
und Kirchweg wurden ab 1812 an ortsauswärts
führenden Wegen neue Abbauerstellen ge-
schaffen, wodurch sich die geschlossene Sied-
lungsstruktur allmählich auflöste.
Das Rückgrat der heute langgestreckten Dorf-
anlage Bliedersdorfs bildet die nord-süd gerich-
tete Hauptstraße, von der in Ortsmitte zahlrei-
che Stichstraßen sternförmig abzweigen. Um-
fangreiche Einfamilienhausgebiete sind seit
1945 vor allem in der nördlichen Dorfhälfte ge-
wachsen, während der südliche Dorfrand noch
unverbaut in die Landschaft gebettet liegt.
Auch wenn die Zahl der historischen Bauten
stark abgenommen hat, bestimmen nach wie
vor reetgedeckte Fachwerkbauten des 19. und
20.Jh. das Ortsbild. Der älteste datierte Zwei-
ständerbau Daudiecker Weg 1 ist 1758 aufge-
richtet worden, nachdem ein Feuer fast alle Ge-
bäude im Dorf zerstört hatte. Sein ursprünglich
vorhanden gewesener Vollwalm am Wirt-
schaftsgiebel wurde Anfang dieses Jahrhun-
derts durch einen Steilgiebel mit Fußwinkelhöl-
zern und dekorativen Ortgangbrettern ersetzt.
Zusammen mit den beiden ehemaligen Häus-
lingshäusern Daudiecker Weg 4 (erb. 18,Jh)
und Kirchweg 2 (erb. 1821) bildet er eine denk-
malwerte Gruppe an einem kleinen Platz nörd-
lich der Kirche. Das letztgenannte Objekt prä-
sentiert sich nach einer vor kurzem durchge-
führten Sanierung wieder weitgehend in seinem
ursprünglichen Erscheinungsbild mit einem als
Halbwalm ausgeführten Reetdach. In dem nur
10 mal 14 Meter großen Zweiständerbau maß
die Diele rund fünf Meter (zwei Fach), Flett und
Kammerfach je etwa vier Meter.
Nach weiteren Ortsbränden 1831 und 1835
entstanden östlich der Kirche zwei reetgedeck-
te Fachwerkbauten, von denen das traufständi-
ge Fachhallenhaus Hauptstraße 49 (dat. 1831)
eine wichtige straßenraumprägende Funktion
einnimmt. In dem südwärts orientierten Wirt-
schaftsteil ist seit 1986 die Heimatstube des
Ortes untergebracht. Das südlich anschließen-
de, heute ganz als Stall genutzte Haus Nr. 53
mit vollständig erhaltenem Innengerüst zeigt im
rückwärtigen Giebel ein auffallend kleinteiliges
und kaum durch Öffnungen unterbrochenes
Fachwerkgitter, während die Außenwände des
straßenzugewandten Stallbereichs 1958 massiv
erneuert worden sind.
102
Bliedersdorf, Kirchweg 2, ehern. Wohnwirtschaftsgebäude, 1821
Bliedersdorf, Hauptstraße 49, Wohnwirtschaftsgebäude, 1831
und Küster des Ortes, Gotthard Johann Chri-
stian Sanny zurück. Im Chor, vom Schiff durch
einen niedrigen Rundbogen getrennt, sind in
den vier Ecken Säulen mit Blattkapitellen unter
kräftig profilierten Kämpferplatten erhalten.
Zu den bemerkenswerten Ausstattungsstücken
zählen der mittelalterliche Blockaltar mit einem
Aufsatz von 1587, die Kanzel von 1622, das
hölzerne Taufbecken von 1696 und die Chor-
prieche von 1698. Die Marienglocke wurde
1444 durch den Bremer Glockengießer Ghert
Klinghe zu Ehren der heiligen Katharina gefer-
tigt, die als Kirchenpatronin angesehen wird,
auch wenn keine weiteren Hinweise hierauf ge-
funden wurden.
Die zwölf Höfe Bliedersdorfs sind auf unregel-
mäßigen Parzellen um den Kirchhof herum in
einer Senke angeordnet. Um diesen alten Kern
zwischen Dohrenstraße, Mittelweg, Feldstraße
und Kirchweg wurden ab 1812 an ortsauswärts
führenden Wegen neue Abbauerstellen ge-
schaffen, wodurch sich die geschlossene Sied-
lungsstruktur allmählich auflöste.
Das Rückgrat der heute langgestreckten Dorf-
anlage Bliedersdorfs bildet die nord-süd gerich-
tete Hauptstraße, von der in Ortsmitte zahlrei-
che Stichstraßen sternförmig abzweigen. Um-
fangreiche Einfamilienhausgebiete sind seit
1945 vor allem in der nördlichen Dorfhälfte ge-
wachsen, während der südliche Dorfrand noch
unverbaut in die Landschaft gebettet liegt.
Auch wenn die Zahl der historischen Bauten
stark abgenommen hat, bestimmen nach wie
vor reetgedeckte Fachwerkbauten des 19. und
20.Jh. das Ortsbild. Der älteste datierte Zwei-
ständerbau Daudiecker Weg 1 ist 1758 aufge-
richtet worden, nachdem ein Feuer fast alle Ge-
bäude im Dorf zerstört hatte. Sein ursprünglich
vorhanden gewesener Vollwalm am Wirt-
schaftsgiebel wurde Anfang dieses Jahrhun-
derts durch einen Steilgiebel mit Fußwinkelhöl-
zern und dekorativen Ortgangbrettern ersetzt.
Zusammen mit den beiden ehemaligen Häus-
lingshäusern Daudiecker Weg 4 (erb. 18,Jh)
und Kirchweg 2 (erb. 1821) bildet er eine denk-
malwerte Gruppe an einem kleinen Platz nörd-
lich der Kirche. Das letztgenannte Objekt prä-
sentiert sich nach einer vor kurzem durchge-
führten Sanierung wieder weitgehend in seinem
ursprünglichen Erscheinungsbild mit einem als
Halbwalm ausgeführten Reetdach. In dem nur
10 mal 14 Meter großen Zweiständerbau maß
die Diele rund fünf Meter (zwei Fach), Flett und
Kammerfach je etwa vier Meter.
Nach weiteren Ortsbränden 1831 und 1835
entstanden östlich der Kirche zwei reetgedeck-
te Fachwerkbauten, von denen das traufständi-
ge Fachhallenhaus Hauptstraße 49 (dat. 1831)
eine wichtige straßenraumprägende Funktion
einnimmt. In dem südwärts orientierten Wirt-
schaftsteil ist seit 1986 die Heimatstube des
Ortes untergebracht. Das südlich anschließen-
de, heute ganz als Stall genutzte Haus Nr. 53
mit vollständig erhaltenem Innengerüst zeigt im
rückwärtigen Giebel ein auffallend kleinteiliges
und kaum durch Öffnungen unterbrochenes
Fachwerkgitter, während die Außenwände des
straßenzugewandten Stallbereichs 1958 massiv
erneuert worden sind.
102