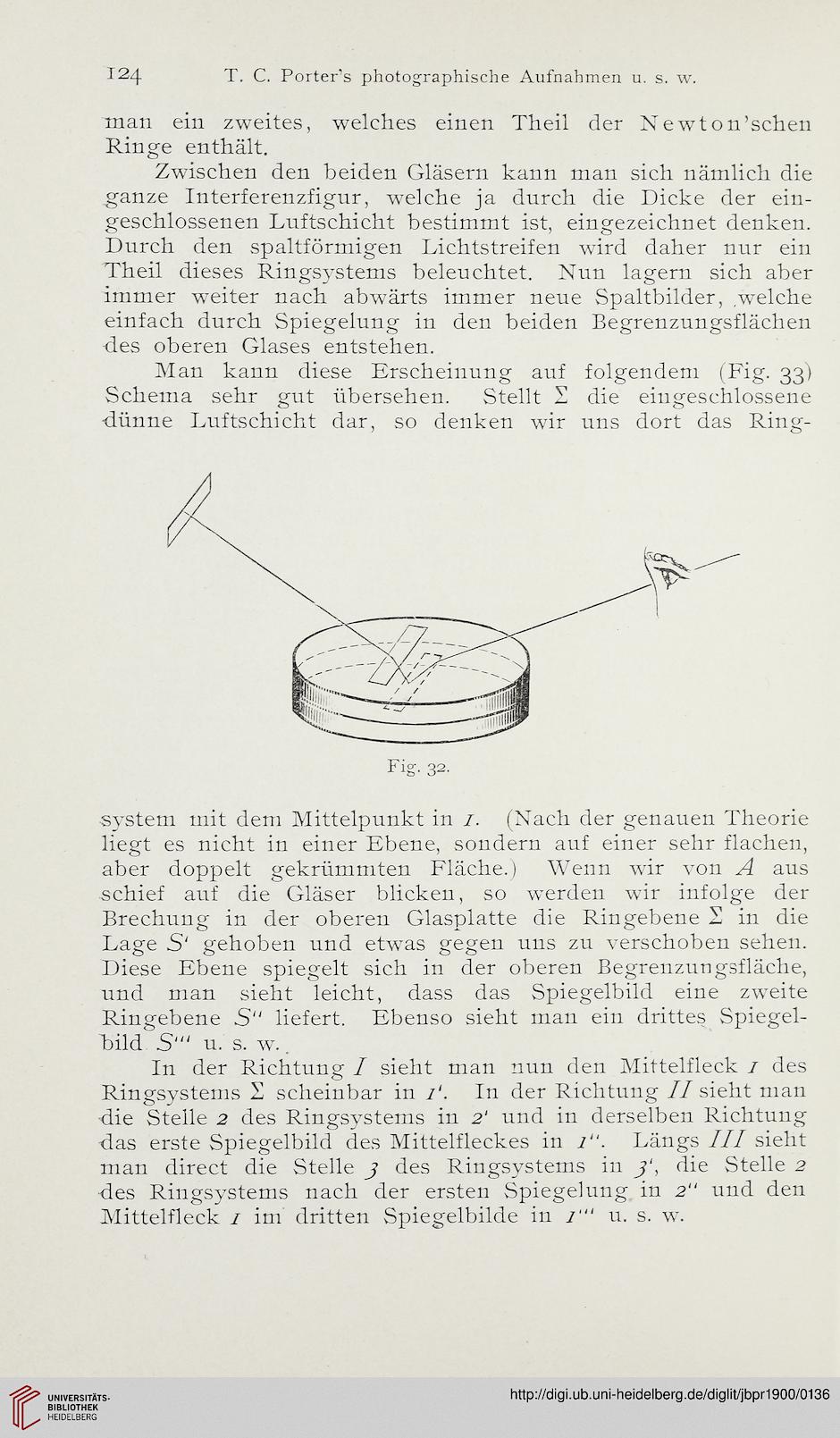Jahrbuch für Photographie und Reproduktionstechnik — 14.1900
Cite this page
Please cite this page by using the following URL/DOI:
https://doi.org/10.11588/diglit.37611#0136
DOI issue:
Originalbeiträge
DOI article:Czermak, Paul: T. C. Porter's photographische Aufnahmen der Newton'schen Farbenringe
DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.37611#0136
124
T. C. Porters photographische Aufnahmen u. s. w.
man ein zweites, welches einen Theil der Newton’schen
Ringe enthält.
Zwischen den beiden Gläsern kann man sich nämlich die
ganze Interferenzfigur, welche ja durch die Dicke der ein-
geschlossenen Luftschicht bestimmt ist, eingezeichnet denken.
Durch den spaltförmigen Lichtstreifen wird daher nur ein
Theil dieses Ringsystems beleuchtet. Nun lagern sich aber
immer weiter nach abwärts immer neue Spaltbilder, .welche
einfach durch Spiegelung in den beiden Begrenzungsflächen
des oberen Glases entstehen.
Man kann diese Erscheinung auf folgendem (Fig. 33)
Scheina sehr gut übersehen. Stellt S die eingeschlossene
dünne Luftschicht dar, so denken wir uns dort das Ring-
system mit dem Mittelpunkt in 1. (Nach der genauen Theorie
liegt es nicht in einer Ebene, sondern auf einer sehr flachen,
aber doppelt gekrümmten Fläche.) Wenn wir von A aus
schief auf die Gläser blicken, so werden wir infolge der
Brechung in der oberen Glasplatte die Ringebene S in die
Lage S' gehoben und etwas gegen uns zu verschoben sehen.
Diese Ebene spiegelt sich in der oberen Begrenzungsfläche,
und man sieht leicht, dass das Spiegelbild eine zweite
Ringebene S“ liefert. Ebenso sieht man ein drittes Spiegel-
bild S“‘ u. s. w..
In der Richtung I sieht man nun den Mittelfleck 7 des
Ringsystems S scheinbar in 7'. In der Richtung II sieht man
die Stelle 2 des Ringsystems in 2' und in derselben Richtung
das erste Spiegelbild des Mittelfleckes in 7". Längs III sieht
man direct die Stelle j des Ringsystems in 5', die Stelle 2
des Ringsystems nach der ersten Spiegelung in 2" und den
Mittelfleck 7 im dritten Spiegelbilde in r“ u. s. w.
T. C. Porters photographische Aufnahmen u. s. w.
man ein zweites, welches einen Theil der Newton’schen
Ringe enthält.
Zwischen den beiden Gläsern kann man sich nämlich die
ganze Interferenzfigur, welche ja durch die Dicke der ein-
geschlossenen Luftschicht bestimmt ist, eingezeichnet denken.
Durch den spaltförmigen Lichtstreifen wird daher nur ein
Theil dieses Ringsystems beleuchtet. Nun lagern sich aber
immer weiter nach abwärts immer neue Spaltbilder, .welche
einfach durch Spiegelung in den beiden Begrenzungsflächen
des oberen Glases entstehen.
Man kann diese Erscheinung auf folgendem (Fig. 33)
Scheina sehr gut übersehen. Stellt S die eingeschlossene
dünne Luftschicht dar, so denken wir uns dort das Ring-
system mit dem Mittelpunkt in 1. (Nach der genauen Theorie
liegt es nicht in einer Ebene, sondern auf einer sehr flachen,
aber doppelt gekrümmten Fläche.) Wenn wir von A aus
schief auf die Gläser blicken, so werden wir infolge der
Brechung in der oberen Glasplatte die Ringebene S in die
Lage S' gehoben und etwas gegen uns zu verschoben sehen.
Diese Ebene spiegelt sich in der oberen Begrenzungsfläche,
und man sieht leicht, dass das Spiegelbild eine zweite
Ringebene S“ liefert. Ebenso sieht man ein drittes Spiegel-
bild S“‘ u. s. w..
In der Richtung I sieht man nun den Mittelfleck 7 des
Ringsystems S scheinbar in 7'. In der Richtung II sieht man
die Stelle 2 des Ringsystems in 2' und in derselben Richtung
das erste Spiegelbild des Mittelfleckes in 7". Längs III sieht
man direct die Stelle j des Ringsystems in 5', die Stelle 2
des Ringsystems nach der ersten Spiegelung in 2" und den
Mittelfleck 7 im dritten Spiegelbilde in r“ u. s. w.