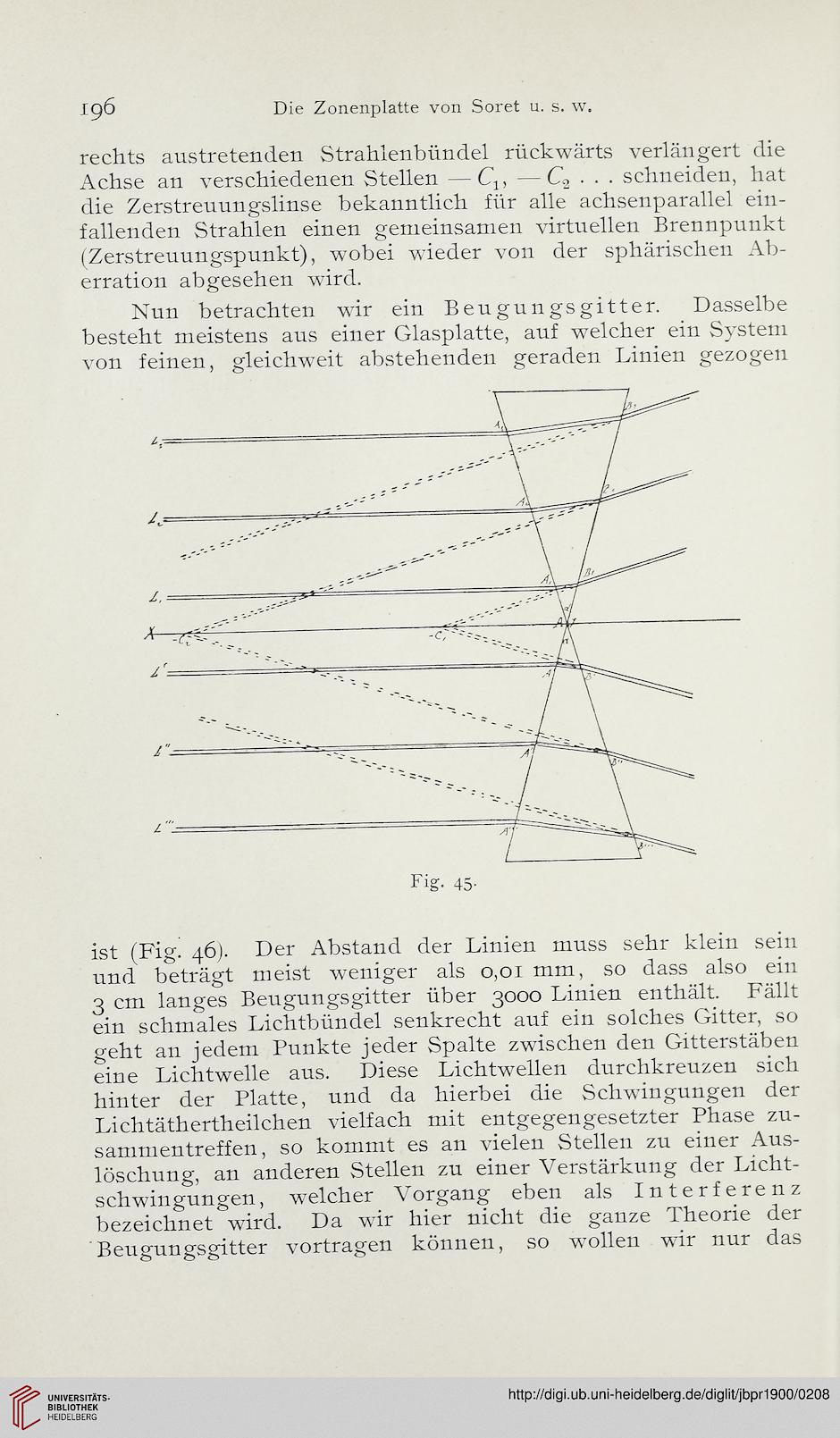Jahrbuch für Photographie und Reproduktionstechnik — 14.1900
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.37611#0208
DOI Heft:
Originalbeiträge
DOI Artikel:Pfaundler von Hadermur, Leopold: Die Zonenplatte von Soret und die Phasenumkehrplatte von Wood als Ersatz der Linse: Anwendungen derselben in der Photographie
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.37611#0208
196
Die Zonenplatte von Soret u. s. w.
rechts austretenden Strahlenbündel rückwärts verlängert die
Achse an verschiedenen Stellen —Q, —Q . . . schneiden, hat
die Zerstreuungslinse bekanntlich für alle achsenparallel ein-
fallenden Strahlen einen gemeinsamen virtuellen Brennpunkt
(Zerstreuungspunkt), wobei wieder von der sphärischen Ab-
erration abgesehen wird.
Nun betrachten wir ein Beugungsgitter. Dasselbe
besteht meistens aus einer Glasplatte, auf welcher ein System
von feinen, gleichweit abstehenden geraden Linien gezogen
ist (Fig. 46). Der Abstand der Linien muss sehr klein sein
und beträgt meist weniger als 0,01 mm, so dass also ein
3 cm langes Beugungsgitter über 3000 Linien enthält. Fällt
ein schmales Lichtbündel senkrecht auf ein solches Gitter, so
geht an jedem Punkte jeder Spalte zwischen den Gitterstäben
eine Lichtwelle aus. Diese Lichtwellen durchkreuzen sich
hinter der Platte, und da hierbei die Schwingungen der
Lichtäthertheilchen vielfach mit entgegengesetzter Phase Zu-
sammentreffen, so kommt es an vielen Stellen zu einer Aus-
löschung, an anderen Stellen zu einer Verstärkung der Licht-
schwingungen, welcher Vorgang eben als Interferenz
bezeichnet wird. Da wir hier nicht die ganze Theorie der
Beugungsgitter vortragen können, so wollen wir nur das
Die Zonenplatte von Soret u. s. w.
rechts austretenden Strahlenbündel rückwärts verlängert die
Achse an verschiedenen Stellen —Q, —Q . . . schneiden, hat
die Zerstreuungslinse bekanntlich für alle achsenparallel ein-
fallenden Strahlen einen gemeinsamen virtuellen Brennpunkt
(Zerstreuungspunkt), wobei wieder von der sphärischen Ab-
erration abgesehen wird.
Nun betrachten wir ein Beugungsgitter. Dasselbe
besteht meistens aus einer Glasplatte, auf welcher ein System
von feinen, gleichweit abstehenden geraden Linien gezogen
ist (Fig. 46). Der Abstand der Linien muss sehr klein sein
und beträgt meist weniger als 0,01 mm, so dass also ein
3 cm langes Beugungsgitter über 3000 Linien enthält. Fällt
ein schmales Lichtbündel senkrecht auf ein solches Gitter, so
geht an jedem Punkte jeder Spalte zwischen den Gitterstäben
eine Lichtwelle aus. Diese Lichtwellen durchkreuzen sich
hinter der Platte, und da hierbei die Schwingungen der
Lichtäthertheilchen vielfach mit entgegengesetzter Phase Zu-
sammentreffen, so kommt es an vielen Stellen zu einer Aus-
löschung, an anderen Stellen zu einer Verstärkung der Licht-
schwingungen, welcher Vorgang eben als Interferenz
bezeichnet wird. Da wir hier nicht die ganze Theorie der
Beugungsgitter vortragen können, so wollen wir nur das