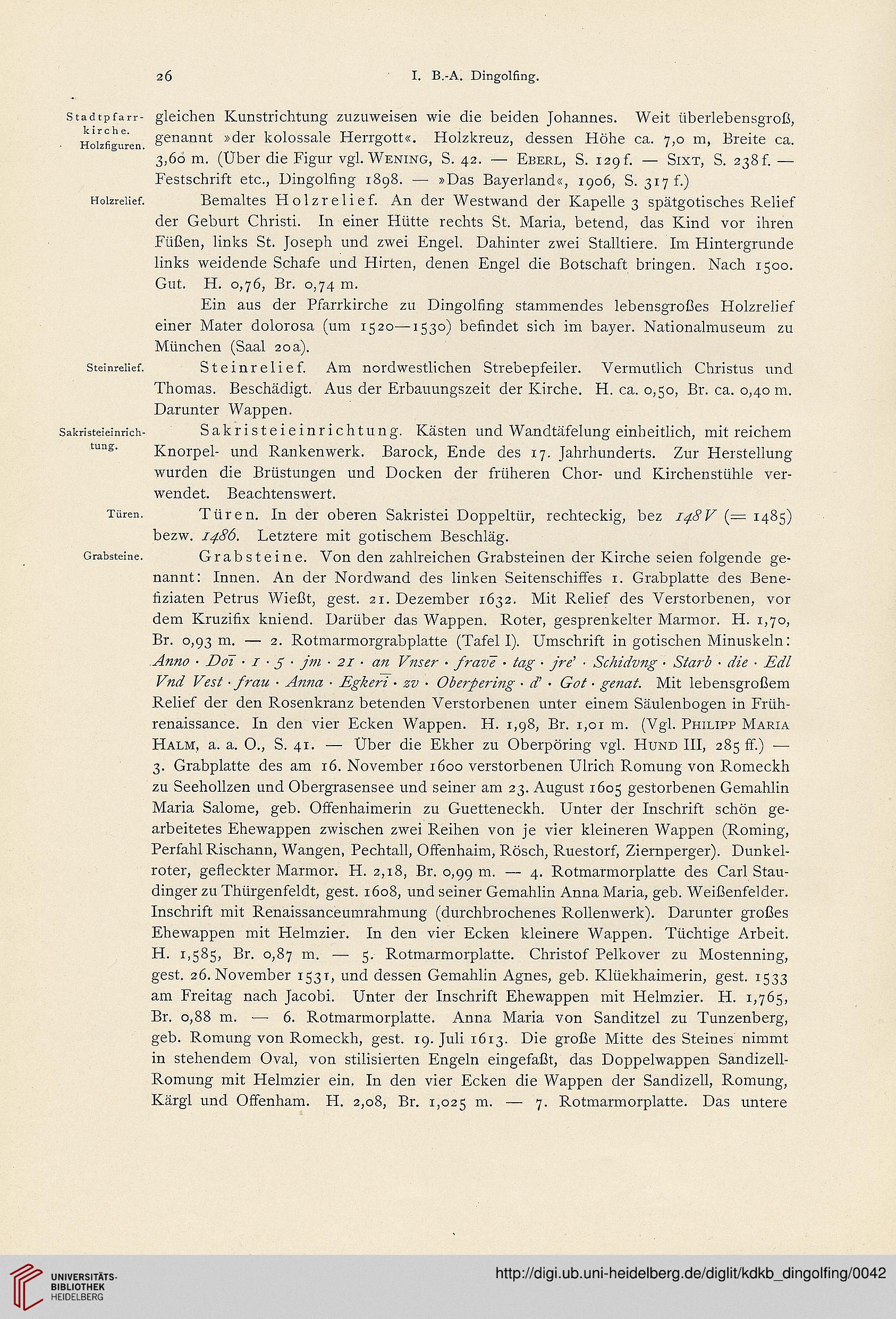26
I. B.-A. Dingolfing.
Stadtpfarr-
kirche.
Holzfiguren.
Holzrelief.
Steinrelief.
Sakristeieinrich-
tung.
Türen.
Grabsteine.
gleichen Kunstrichtung zuzuweisen wie die beiden Johannes. Weit überlebensgroß,
genannt »der kolossale Herrgott«. Holzkreuz, dessen Höhe ca. 7,0 m, Breite ca.
3,60 m. (Uber die Figur vgl. Wening, S. 42. — Eberl, S. 129F — Sixt, S. 238f. —
Festschrift etc., Dingolfing 1898. — »Das Bayerland«, 1906, S. 317 f.)
Bemaltes Holzrelief. An der Westwand der Kapelle 3 spätgotisches Relief
der Geburt Christi. In einer Hütte rechts St. Maria, betend, das Kind vor ihren
Füßen, links St. Joseph und zwei Engel. Dahinter zwei Stalltiere. Im Hintergründe
links weidende Schafe und Hirten, denen Engel die Botschaft bringen. Nach 1500.
Gut. H. 0,76, Br. 0,74 m.
Ein aus der Pfarrkirche zu Dingolfing stammendes lebensgroßes Holzrelief
einer Mater dolorosa (um 1520—1530) befindet sich im bayer. Nationalmuseum zu
München (Saal 20a).
Steinrelief. Am nordwestlichen Strebepfeiler. Vermutlich Christus und
Thomas. Beschädigt. Aus der Erbauungszeit der Kirche. H. ca. 0,50, Br. ca. 0,40 m.
Darunter Wappen.
Sakristeieinrichtung. Kästen und Wandtäfelung einheitlich, mit reichem
Knorpel- und Ranken werk. Barock, Ende des 17. Jahrhunderts. Zur Herstellung
wurden die Brüstungen und Docken der früheren Chor- und Kirchenstühle ver-
wendet. Beachtenswert.
Türen. In der oberen Sakristei Doppeltür, rechteckig, bez 148 V (= 1485)
bezw. i486. Letztere mit gotischem Beschlag.
Grabsteine. Von den zahlreichen Grabsteinen der Kirche seien folgende ge-
nannt: Innen. An der Nordwand des linken Seitenschiffes 1. Grabplatte des Bene-
fiziaten Petrus Wießt, gest. 21. Dezember 1632. Mit Relief des Verstorbenen, vor
dem Kruzifix kniend. Darüber das Wappen. Roter, gesprenkelter Marmor. H. 1,70,
Br. 0,93 m. — 2. Rotmarmorgrabplatte (Tafel I). Umschrift in gotischen Minuskeln:
Anno • Dol • I ■ 5 ■ jm • 21 • an Vnser • fr ave • tag ■ jre’ • Schidvng • Starb • die • Edl
Vnd Ves t ■ fr au • Anna ■ Egkeri • zv • Oberpering ■ d’ • Got ■ genat. Mit lebensgroßem
Relief der den Rosenkranz betenden Verstorbenen unter einem Säulenbogen in Früh-
renaissance. In den vier Ecken Wappen. H. 1,98, Br. 1,01 m. (Vgl. Philipp Maria
Halm, a. a. O., S. 41. — Uber die Ekher zu Oberpöring vgl. Hund III, 28511.) —
3. Grabplatte des am 16. November 1600 verstorbenen Ulrich Romung von Romeckh
zu Seehollzen und Obergrasensee und seiner am 23. August 1605 gestorbenen Gemahlin
Maria Salome, geb. Offenhaimerin zu Guetteneckh. Unter der Inschrift schön ge-
arbeitetes Ehewappen zwischen zwei Reihen von je vier kleineren Wappen (Roming,
Perfahl Rischann, Wangen, Pechtall, Offenhaim, Rösch, Ruestorf, Ziernperger). Dunkel-
roter, gefleckter Marmor. H. 2,18, Br. 0,99 m. — 4. Rotmarmorplatte des Carl Stau-
dinger zu Thiirgenfeldt, gest. 1608, und seiner Gemahlin Anna Maria, geb. Weißenfelder.
Inschrift mit Renaissanceumrahmung (durchbrochenes Rollenwerk). Darunter großes
Ehewappen mit Helmzier. In den vier Ecken kleinere Wappen. Tüchtige Arbeit.
H. 1,585, Br. 0,87 m. — 5. Rotmarmorplatte. Christof Pelkover zu Mostenning,
gest. 26. November 1531, und dessen Gemahlin Agnes, geb. Klüekhaimerin, gest. 1533
am Freitag nach Jacobi. Unter der Inschrift Ehewappen mit Helmzier. H. 1,765,
Br. 0,88 m. —• 6. Rotmarmorplatte. Anna Maria von Sanditzel zu Tunzenberg,
geb. Romung von Romeckh, gest. 19. Juli 1613. Die große Mitte des Steines nimmt
in stehendem Oval, von stilisierten Engeln eingefaßt, das Doppelwappen Sandizell-
Romung mit Helmzier ein. In den vier Ecken die Wappen der Sandizell, Romung,
Kärgl und Offenham. H. 2,08, Br. 1,025 m- •—-7. Rotmarmorplatte. Das untere
I. B.-A. Dingolfing.
Stadtpfarr-
kirche.
Holzfiguren.
Holzrelief.
Steinrelief.
Sakristeieinrich-
tung.
Türen.
Grabsteine.
gleichen Kunstrichtung zuzuweisen wie die beiden Johannes. Weit überlebensgroß,
genannt »der kolossale Herrgott«. Holzkreuz, dessen Höhe ca. 7,0 m, Breite ca.
3,60 m. (Uber die Figur vgl. Wening, S. 42. — Eberl, S. 129F — Sixt, S. 238f. —
Festschrift etc., Dingolfing 1898. — »Das Bayerland«, 1906, S. 317 f.)
Bemaltes Holzrelief. An der Westwand der Kapelle 3 spätgotisches Relief
der Geburt Christi. In einer Hütte rechts St. Maria, betend, das Kind vor ihren
Füßen, links St. Joseph und zwei Engel. Dahinter zwei Stalltiere. Im Hintergründe
links weidende Schafe und Hirten, denen Engel die Botschaft bringen. Nach 1500.
Gut. H. 0,76, Br. 0,74 m.
Ein aus der Pfarrkirche zu Dingolfing stammendes lebensgroßes Holzrelief
einer Mater dolorosa (um 1520—1530) befindet sich im bayer. Nationalmuseum zu
München (Saal 20a).
Steinrelief. Am nordwestlichen Strebepfeiler. Vermutlich Christus und
Thomas. Beschädigt. Aus der Erbauungszeit der Kirche. H. ca. 0,50, Br. ca. 0,40 m.
Darunter Wappen.
Sakristeieinrichtung. Kästen und Wandtäfelung einheitlich, mit reichem
Knorpel- und Ranken werk. Barock, Ende des 17. Jahrhunderts. Zur Herstellung
wurden die Brüstungen und Docken der früheren Chor- und Kirchenstühle ver-
wendet. Beachtenswert.
Türen. In der oberen Sakristei Doppeltür, rechteckig, bez 148 V (= 1485)
bezw. i486. Letztere mit gotischem Beschlag.
Grabsteine. Von den zahlreichen Grabsteinen der Kirche seien folgende ge-
nannt: Innen. An der Nordwand des linken Seitenschiffes 1. Grabplatte des Bene-
fiziaten Petrus Wießt, gest. 21. Dezember 1632. Mit Relief des Verstorbenen, vor
dem Kruzifix kniend. Darüber das Wappen. Roter, gesprenkelter Marmor. H. 1,70,
Br. 0,93 m. — 2. Rotmarmorgrabplatte (Tafel I). Umschrift in gotischen Minuskeln:
Anno • Dol • I ■ 5 ■ jm • 21 • an Vnser • fr ave • tag ■ jre’ • Schidvng • Starb • die • Edl
Vnd Ves t ■ fr au • Anna ■ Egkeri • zv • Oberpering ■ d’ • Got ■ genat. Mit lebensgroßem
Relief der den Rosenkranz betenden Verstorbenen unter einem Säulenbogen in Früh-
renaissance. In den vier Ecken Wappen. H. 1,98, Br. 1,01 m. (Vgl. Philipp Maria
Halm, a. a. O., S. 41. — Uber die Ekher zu Oberpöring vgl. Hund III, 28511.) —
3. Grabplatte des am 16. November 1600 verstorbenen Ulrich Romung von Romeckh
zu Seehollzen und Obergrasensee und seiner am 23. August 1605 gestorbenen Gemahlin
Maria Salome, geb. Offenhaimerin zu Guetteneckh. Unter der Inschrift schön ge-
arbeitetes Ehewappen zwischen zwei Reihen von je vier kleineren Wappen (Roming,
Perfahl Rischann, Wangen, Pechtall, Offenhaim, Rösch, Ruestorf, Ziernperger). Dunkel-
roter, gefleckter Marmor. H. 2,18, Br. 0,99 m. — 4. Rotmarmorplatte des Carl Stau-
dinger zu Thiirgenfeldt, gest. 1608, und seiner Gemahlin Anna Maria, geb. Weißenfelder.
Inschrift mit Renaissanceumrahmung (durchbrochenes Rollenwerk). Darunter großes
Ehewappen mit Helmzier. In den vier Ecken kleinere Wappen. Tüchtige Arbeit.
H. 1,585, Br. 0,87 m. — 5. Rotmarmorplatte. Christof Pelkover zu Mostenning,
gest. 26. November 1531, und dessen Gemahlin Agnes, geb. Klüekhaimerin, gest. 1533
am Freitag nach Jacobi. Unter der Inschrift Ehewappen mit Helmzier. H. 1,765,
Br. 0,88 m. —• 6. Rotmarmorplatte. Anna Maria von Sanditzel zu Tunzenberg,
geb. Romung von Romeckh, gest. 19. Juli 1613. Die große Mitte des Steines nimmt
in stehendem Oval, von stilisierten Engeln eingefaßt, das Doppelwappen Sandizell-
Romung mit Helmzier ein. In den vier Ecken die Wappen der Sandizell, Romung,
Kärgl und Offenham. H. 2,08, Br. 1,025 m- •—-7. Rotmarmorplatte. Das untere