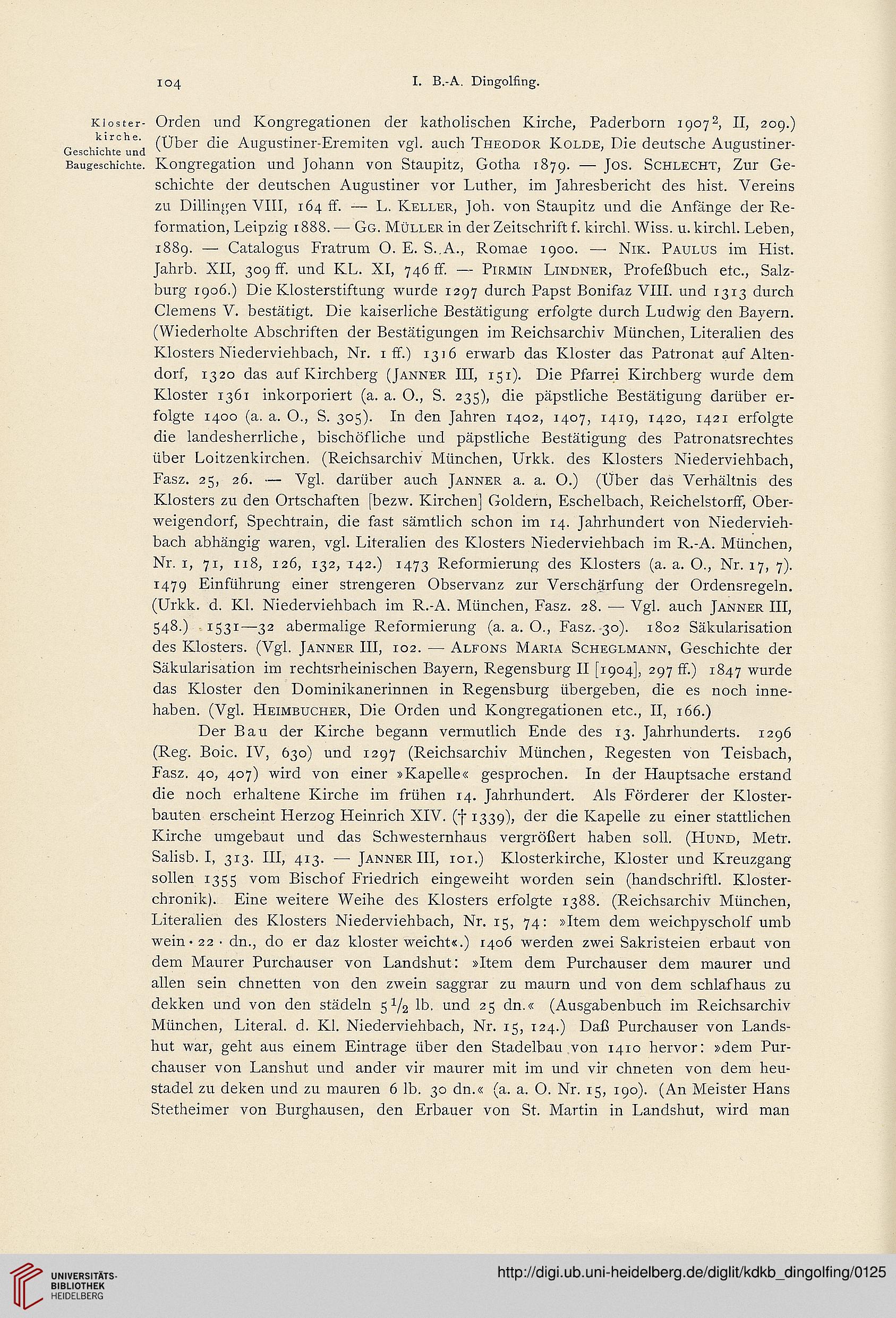104
I. B.-A. Dingolfing.
Kloster- Orden und Kongregationen der katholischen Kirche, Paderborn 19072, II, 209.)
kirche. mber die Augustiner-Eremiten vgl. auch Theodor Kolde, Die deutsche Augustiner-
Geschichte und x _ 0
Baugeschichte. Kongregation und Johann von Staupitz, Gotha 1879. — Jos. Schlecht, Zur Ge-
schichte der deutschen Augustiner vor Luther, im Jahresbericht des hist. Vereins
zu Dillingen VIII, 164 ff. — L. Keller, Joh. von Staupitz und die Anfänge der Re-
formation, Leipzig 1888. — Gg. Müller in der Zeitschrift f. kirchl. Wiss. u. kirchl. Leben,
1889. — Catalogus Fratrum O. E. S..A., Romae 1900. —- Nik. Paulus im Hist.
Jahrb. XII, 309 ff. und KL. XI, 746 ff. — Pirmin Lindner, Profeßbuch etc., Salz-
burg 1906.) Die Klosterstiftung wurde 1297 durch Papst Bonifaz VIII. und 1313 durch
Clemens V. bestätigt. Die kaiserliche Bestätigung erfolgte durch Ludwig den Bayern.
(Wiederholte Abschriften der Bestätigungen im Reichsarchiv München, Literalien des
Klosters Niederviehbach, Nr. 1 ff.) 1316 erwarb das Kloster das Patronat auf Alten-
dorf, 1320 das aufKirchberg (Jänner III, 151). Die Pfarrei Kirchberg wurde dem
Kloster 1361 inkorporiert (a. a. O., S. 235), die päpstliche Bestätigung darüber er-
folgte 1400 (a. a. O., S. 305). In den Jahren 1402, 1407, 1419, 1420, 1421 erfolgte
die landesherrliche, bischöfliche und päpstliche Bestätigung des Patronatsrechtes
über Loitzenkirchen. (Reichsarchiv München, Urkk. des Klosters Niederviehbach,
Fasz. 25, 26. — Vgl. darüber auch Jänner a. a. O.) (Uber das Verhältnis des
Klosters zu den Ortschaften fbezw. Kirchen] Goldern, Eschelbach, Reichelstorff, Ober-
weigendorf, Spechtrain, die fast sämtlich schon im 14. Jahrhundert von Niedervieh-
bach abhängig waren, vgl. Literalien des Klosters Niederviehbach im R.-A. München,
Nr. 1, 71, 118, 126, 132, 142.) 1473 Reformierung des Klosters (a. a. O., Nr. 17, 7).
1479 Einführung einer strengeren Observanz zur Verschärfung der Ordensregeln.
(Urkk. d. Kl. Niederviehbach im R.-A. München, Fasz. 28. — Vgl. auch Jänner III,
548.) 1531—32 abermalige Reformierung (a. a. O., Fasz. 30). 1802 Säkularisation
des Klosters. (Vgl. Jänner III, 102. — Alfons Maria Scheglmann, Geschichte der
Säkularisation im rechtsrheinischen Bayern, Regensburg II [1904], 297 ff.) 1847 wurde
das Kloster den Dominikanerinnen in Regensburg übergeben, die es noch inne-
haben. (Vgl. Heimbucher, Die Orden und Kongregationen etc., II, 166.)
Der Bau der Kirche begann vermutlich Ende des 13. Jahrhunderts. 1296
(Reg. Boic. IV, 630) und 1297 (Reichsarchiv München, Regesten von Teisbach,
Fasz. 40, 407) wird von einer »Kapelle« gesprochen. In der Hauptsache erstand
die noch erhaltene Kirche im frühen 14. Jahrhundert. Als Förderer der Kloster-
bauten erscheint Herzog Heinrich XIV. (f 1339), der die Kapelle zu einer stattlichen
Kirche umgebaut und das Schwesternhaus vergrößert haben soll. (Hund, Metr.
Salisb. I, 313. III, 413. — Jänner III, 101.) Klosterkirche, Kloster und Kreuzgang
sollen 1353 vom Bischof Friedrich eingeweiht worden sein (handschriftl. Kloster-
chronik). Eine weitere Weihe des Klosters erfolgte 1388. (Reichsarchiv München,
Literalien des Klosters Niederviehbach, Nr. 15, 74: »Item dem weichpyscholf umb
wein - 22 • dn., do er daz kloster weicht«.) 1406 werden zwei Sakristeien erbaut von
dem Maurer Purchauser von Landshut: »Item dem Purchauser dem maurer und
allen sein chnetten von den zwein saggrar zu maurn und von dem schlafhaus zu
dekken und von den städeln 51/2 lb. und 25 dn.« (Ausgabenbuch im Reichsarchiv
München, Literal, d. Kl. Niederviehbach, Nr. 15, 124.) Daß Purchauser von Lands-
hut war, geht aus einem Einträge über den Stadelbau von 1410 hervor: »dem Pur-
chauser von Lanshut und ander vir maurer mit im und vir chneten von dem heu-
stadel zu deken und zu mauren 6 lb. 30 dn.« (a. a. O. Nr. 15, 190). (An Meister Hans
Stetheimer von Burghausen, den Erbauer von St. Martin in Landshut, wird man
I. B.-A. Dingolfing.
Kloster- Orden und Kongregationen der katholischen Kirche, Paderborn 19072, II, 209.)
kirche. mber die Augustiner-Eremiten vgl. auch Theodor Kolde, Die deutsche Augustiner-
Geschichte und x _ 0
Baugeschichte. Kongregation und Johann von Staupitz, Gotha 1879. — Jos. Schlecht, Zur Ge-
schichte der deutschen Augustiner vor Luther, im Jahresbericht des hist. Vereins
zu Dillingen VIII, 164 ff. — L. Keller, Joh. von Staupitz und die Anfänge der Re-
formation, Leipzig 1888. — Gg. Müller in der Zeitschrift f. kirchl. Wiss. u. kirchl. Leben,
1889. — Catalogus Fratrum O. E. S..A., Romae 1900. —- Nik. Paulus im Hist.
Jahrb. XII, 309 ff. und KL. XI, 746 ff. — Pirmin Lindner, Profeßbuch etc., Salz-
burg 1906.) Die Klosterstiftung wurde 1297 durch Papst Bonifaz VIII. und 1313 durch
Clemens V. bestätigt. Die kaiserliche Bestätigung erfolgte durch Ludwig den Bayern.
(Wiederholte Abschriften der Bestätigungen im Reichsarchiv München, Literalien des
Klosters Niederviehbach, Nr. 1 ff.) 1316 erwarb das Kloster das Patronat auf Alten-
dorf, 1320 das aufKirchberg (Jänner III, 151). Die Pfarrei Kirchberg wurde dem
Kloster 1361 inkorporiert (a. a. O., S. 235), die päpstliche Bestätigung darüber er-
folgte 1400 (a. a. O., S. 305). In den Jahren 1402, 1407, 1419, 1420, 1421 erfolgte
die landesherrliche, bischöfliche und päpstliche Bestätigung des Patronatsrechtes
über Loitzenkirchen. (Reichsarchiv München, Urkk. des Klosters Niederviehbach,
Fasz. 25, 26. — Vgl. darüber auch Jänner a. a. O.) (Uber das Verhältnis des
Klosters zu den Ortschaften fbezw. Kirchen] Goldern, Eschelbach, Reichelstorff, Ober-
weigendorf, Spechtrain, die fast sämtlich schon im 14. Jahrhundert von Niedervieh-
bach abhängig waren, vgl. Literalien des Klosters Niederviehbach im R.-A. München,
Nr. 1, 71, 118, 126, 132, 142.) 1473 Reformierung des Klosters (a. a. O., Nr. 17, 7).
1479 Einführung einer strengeren Observanz zur Verschärfung der Ordensregeln.
(Urkk. d. Kl. Niederviehbach im R.-A. München, Fasz. 28. — Vgl. auch Jänner III,
548.) 1531—32 abermalige Reformierung (a. a. O., Fasz. 30). 1802 Säkularisation
des Klosters. (Vgl. Jänner III, 102. — Alfons Maria Scheglmann, Geschichte der
Säkularisation im rechtsrheinischen Bayern, Regensburg II [1904], 297 ff.) 1847 wurde
das Kloster den Dominikanerinnen in Regensburg übergeben, die es noch inne-
haben. (Vgl. Heimbucher, Die Orden und Kongregationen etc., II, 166.)
Der Bau der Kirche begann vermutlich Ende des 13. Jahrhunderts. 1296
(Reg. Boic. IV, 630) und 1297 (Reichsarchiv München, Regesten von Teisbach,
Fasz. 40, 407) wird von einer »Kapelle« gesprochen. In der Hauptsache erstand
die noch erhaltene Kirche im frühen 14. Jahrhundert. Als Förderer der Kloster-
bauten erscheint Herzog Heinrich XIV. (f 1339), der die Kapelle zu einer stattlichen
Kirche umgebaut und das Schwesternhaus vergrößert haben soll. (Hund, Metr.
Salisb. I, 313. III, 413. — Jänner III, 101.) Klosterkirche, Kloster und Kreuzgang
sollen 1353 vom Bischof Friedrich eingeweiht worden sein (handschriftl. Kloster-
chronik). Eine weitere Weihe des Klosters erfolgte 1388. (Reichsarchiv München,
Literalien des Klosters Niederviehbach, Nr. 15, 74: »Item dem weichpyscholf umb
wein - 22 • dn., do er daz kloster weicht«.) 1406 werden zwei Sakristeien erbaut von
dem Maurer Purchauser von Landshut: »Item dem Purchauser dem maurer und
allen sein chnetten von den zwein saggrar zu maurn und von dem schlafhaus zu
dekken und von den städeln 51/2 lb. und 25 dn.« (Ausgabenbuch im Reichsarchiv
München, Literal, d. Kl. Niederviehbach, Nr. 15, 124.) Daß Purchauser von Lands-
hut war, geht aus einem Einträge über den Stadelbau von 1410 hervor: »dem Pur-
chauser von Lanshut und ander vir maurer mit im und vir chneten von dem heu-
stadel zu deken und zu mauren 6 lb. 30 dn.« (a. a. O. Nr. 15, 190). (An Meister Hans
Stetheimer von Burghausen, den Erbauer von St. Martin in Landshut, wird man