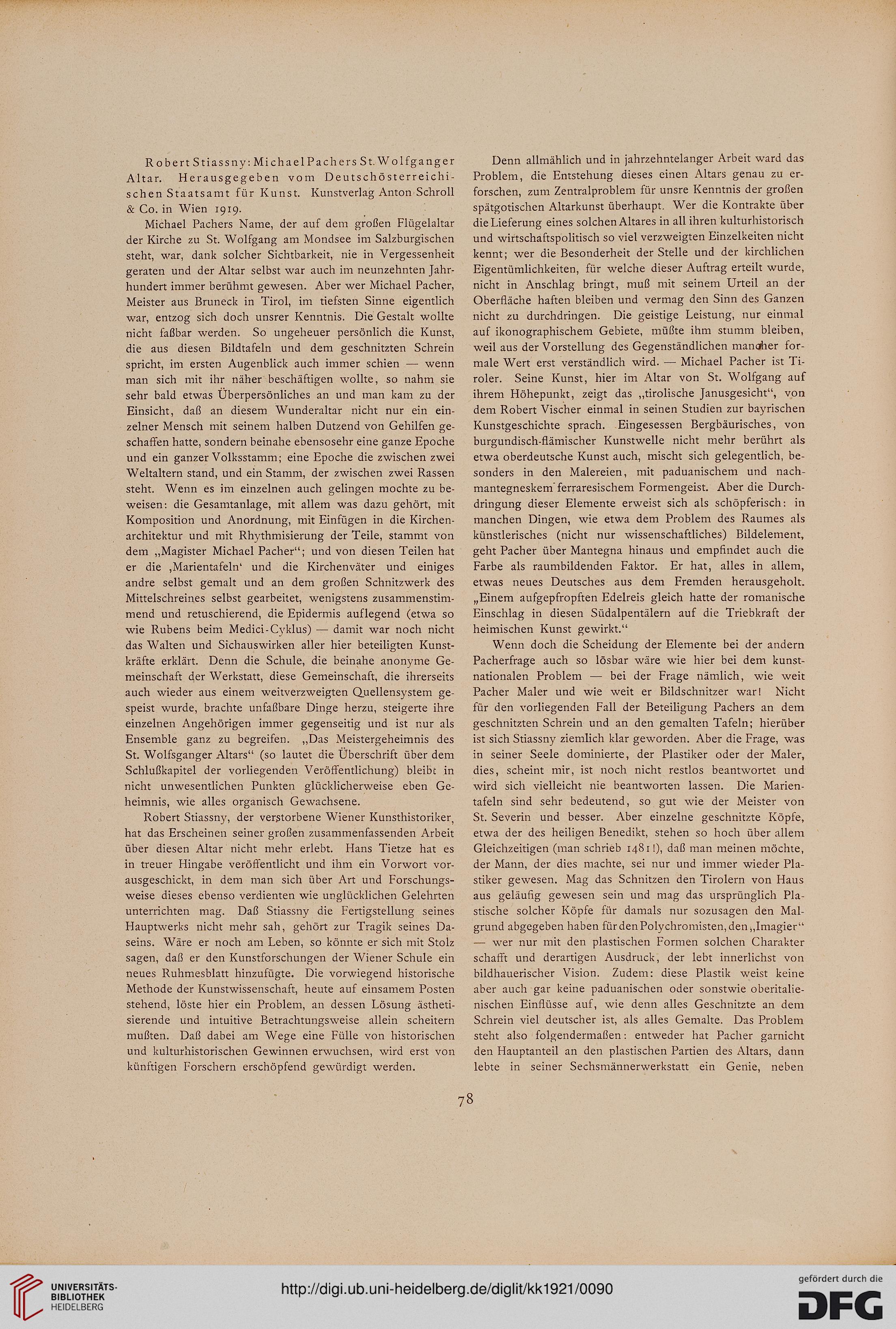R o bert Stiassiiy:MichaelPachers St. Wolfganger
Altar. Herausgegeben vom Deutschö sterreichi-
schen Staatsamt für Kunst. Kunstverlag Anton Schroll
& Co. in Wien 1919.
Michael Pachers Name, der auf dem großen Flügelaltar
der Kirche zu St. Wolfgang am Mondsee im Salzburgischen
steht, war, dank solcher Sichtbarkeit, nie in Vergessenheit
geraten und der Altar selbst war auch im neunzehnten Jahr-
hundert immer berühmt gewesen. Aber wer Michael Pacher,
Meister aus Bruneck in Tirol, im tiefsten Sinne eigentlich
war, entzog sich doch unsrer Kenntnis. Die Gestalt wollte
nicht faßbar werden. So ungeheuer persönlich die Kunst,
die aus diesen Bildtafeln und dem geschnitzten Schrein
spricht, im ersten Augenblick auch immer schien — wenn
man sich mit ihr näher beschäftigen wollte, so nahm sie
sehr bald etwas Überpersönliches an und man kam zu der
Einsicht, daß an diesem Wunderaltar nicht nur ein ein-
zelner Mensch mit seinem halben Dutzend von Gehilfen ge-
schaffen hatte, sondern beinahe ebensosehr eine ganze Epoche
und ein ganzer Volksstamm; eine Epoche die zwischen zwei
Weltaltern stand, und ein Stamm, der zwischen zwei Rassen
steht. Wenn es im einzelnen auch gelingen mochte zu be-
weisen: die Gesamtanlage, mit allem was dazu gehört, mit
Komposition und Anordnung, mit Einfügen in die Kirchen-
architektur und mit Rhythmisierung der Teile, stammt von
dem „Magister Michael Pacher"; und von diesen Teilen hat
er die ,Marientafeln' und die Kirchenväter und einiges
andre selbst gemalt und an dem großen Schnitzwerk des
Mittelschreines selbst gearbeitet, wenigstens zusammenstim-
mend und retuschierend, die Epidermis auflegend (etwa so
wie Rubens beim Medici-Cvklus) — damit war noch nicht
das Walten und Sichauswirken aller hier beteiligten Kunst-
kräfte erklärt. Denn die Schule, die beinahe anonyme Ge-
meinschaft der Werkstatt, diese Gemeinschaft, die ihrerseits
auch wieder aus einem weitverzweigten Quellensystem ge-
speist wurde, brachte unfaßbare Dinge herzu, steigerte ihre
einzelnen Angehörigen immer gegenseitig und ist nur als
Ensemble ganz zu begreifen. „Das Meistergeheimnis des
St. Wolfsganger Altars" (so lautet die Überschrift über dem
Schlußkapitel der vorliegenden Veröffentlichung) bleibt in
nicht unwesentlichen Punkten glücklicherweise eben Ge-
heimnis, wie alles organisch Gewachsene.
Robert Stiassny, der verstorbene Wiener Kunsthistoriker,
hat das Erscheinen seiner großen zusammenfassenden Arbeit
über diesen Altar nicht mehr erlebt. Hans Tietze hat es
in treuer Hingabe veröffentlicht und ihm ein Vorwort vor-
ausgeschickt, in dem man sich über Art und Forschungs-
weise dieses ebenso verdienten wie unglücklichen Gelehrten
unterrichten mag. Daß Stiassny die Fertigstellung seines
Hauptwerks nicht mehr sah, gehört zur Tragik seines Da-
seins. Wäre er noch am Leben, so könnte er sich mit Stolz
sagen, daß er den Kunstforschungen der Wiener Schule ein
neues Ruhmesblatt hinzufügte. Die vorwiegend historische
Methode der Kunstwissenschaft, heute auf einsamem Posten
stehend, löste hier ein Problem, an dessen Lösung ästheti-
sierende und intuitive Betrachtungsweise allein scheitern
mußten. Daß dabei am Wege eine Fülle von historischen
und kulturhistorischen Gewinnen erwuchsen, wird erst von
künftigen Forschern erschöpfend gewürdigt werden.
Denn allmählich und in jahrzehntelanger Arbeit ward das
Problem, die Entstehung dieses einen Altars genau zu er-
forschen, zum Zentralproblem für unsre Kenntnis der großen
spätgotischen Altarkunst überhaupt. Wer die Kontrakte über
die Lieferung eines solchen Altares in all ihren kulturhistorisch
und wirtschaftspolitisch so viel verzweigten Einzelkeiten nicht
kennt; wer die Besonderheit der Stelle und der kirchlichen
Eigentümlichkeiten, für welche dieser Auftrag erteilt wurde,
nicht in Anschlag bringt, muß mit seinem Urteil an der
Oberfläche haften bleiben und vermag den Sinn des Ganzen
nicht zu durchdringen. Die geistige Leistung, nur einmal
auf ikonographischem Gebiete, müßte ihm stumm bleiben,
weil aus der Vorstellung des Gegenständlichen manaher for-
male Wert erst verständlich wird. — Michael Pacher ist Ti-
roler. Seine Kunst, hier im Altar von St. Wolfgang auf
ihrem Höhepunkt, zeigt das „tirolische Janusgesicht", von
dem Robert Vischer einmal in seinen Studien zur bayrischen
Kunstgeschichte sprach. Eingesessen Bergbäurisches, von
burgundisch-flämischer Kunstwelle nicht mehr berührt als
etwa oberdeutsche Kunst auch, mischt sich gelegentlich, be-
sonders in den Malereien, mit paduanischem und nach-
mantegneskem'ferraresischem Formengeist. Aber die Durch-
dringung dieser Elemente erweist sich als schöpferisch: in
manchen Dingen, wie etwa dem Problem des Raumes als
künstlerisches (nicht nur wissenschaftliches) Bildelement,
geht Pacher über Mantegna hinaus und empfindet auch die
Farbe als raumbildenden Faktor. Er hat, alles in allem,
etwas neues Deutsches aus dem Fremden herausgeholt.
„Einem aufgepfropften Edelreis gleich hatte der romanische
Einschlag in diesen Südalpentälern auf die Triebkraft der
heimischen Kunst gewirkt."
Wenn doch die Scheidung der Elemente bei der andern
Pacherfrage auch so lösbar wäre wie hier bei dem kunst-
nationalen Problem — bei der Frage nämlich, wie weit
Pacher Maler und wie weit er Bildschnitzer warl Nicht
für den vorliegenden Fall der Beteiligung Pachers an dem
geschnitzten Schrein und an den gemalten Tafeln; hierüber
ist sich Stiassny ziemlich klar geworden. Aber die Frage, was
in seiner Seele dominierte, der Plastiker oder der Maler,
dies, scheint mir, ist noch nicht restlos beantwortet und
wird sich vielleicht nie beantworten lassen. Die Marien-
tafeln sind sehr bedeutend, so gut wie der Meister von
St. Severin und besser. Aber einzelne geschnitzte Köpfe,
etwa der des heiligen Benedikt, stehen so hoch über allem
Gleichzeitigen (man schrieb 1481!), daß man meinen möchte,
der Mann, der dies machte, sei nur und immer wieder Pla-
stiker gewesen. Mag das Schnitzen den Tirolern von Haus
aus geläufig gewesen sein und mag das ursprünglich Pla-
stische solcher Köpfe für damals nur sozusagen den Mal-
grund abgegeben haben fürdenPolychromisten,den„Imagier"
— wer nur mit den plastischen Formen solchen Charakter
schafft und derartigen Ausdruck, der lebt innerlichst von
bildhauerischer Vision. Zudem: diese Plastik weist keine
aber auch gar keine paduanischen oder sonstwie oberitalie-
nischen Einflüsse auf, wie denn alles Geschnitzte an dem
Schrein viel deutscher ist, als alles Gemalte. Das Problem
steht also folgendermaßen: entweder hat Pacher garnicht
den Hauptanteil an den plastischen Partien des Altars, dann
lebte in seiner Sechsmännerwerkstatt ein Genie, neben
78
Altar. Herausgegeben vom Deutschö sterreichi-
schen Staatsamt für Kunst. Kunstverlag Anton Schroll
& Co. in Wien 1919.
Michael Pachers Name, der auf dem großen Flügelaltar
der Kirche zu St. Wolfgang am Mondsee im Salzburgischen
steht, war, dank solcher Sichtbarkeit, nie in Vergessenheit
geraten und der Altar selbst war auch im neunzehnten Jahr-
hundert immer berühmt gewesen. Aber wer Michael Pacher,
Meister aus Bruneck in Tirol, im tiefsten Sinne eigentlich
war, entzog sich doch unsrer Kenntnis. Die Gestalt wollte
nicht faßbar werden. So ungeheuer persönlich die Kunst,
die aus diesen Bildtafeln und dem geschnitzten Schrein
spricht, im ersten Augenblick auch immer schien — wenn
man sich mit ihr näher beschäftigen wollte, so nahm sie
sehr bald etwas Überpersönliches an und man kam zu der
Einsicht, daß an diesem Wunderaltar nicht nur ein ein-
zelner Mensch mit seinem halben Dutzend von Gehilfen ge-
schaffen hatte, sondern beinahe ebensosehr eine ganze Epoche
und ein ganzer Volksstamm; eine Epoche die zwischen zwei
Weltaltern stand, und ein Stamm, der zwischen zwei Rassen
steht. Wenn es im einzelnen auch gelingen mochte zu be-
weisen: die Gesamtanlage, mit allem was dazu gehört, mit
Komposition und Anordnung, mit Einfügen in die Kirchen-
architektur und mit Rhythmisierung der Teile, stammt von
dem „Magister Michael Pacher"; und von diesen Teilen hat
er die ,Marientafeln' und die Kirchenväter und einiges
andre selbst gemalt und an dem großen Schnitzwerk des
Mittelschreines selbst gearbeitet, wenigstens zusammenstim-
mend und retuschierend, die Epidermis auflegend (etwa so
wie Rubens beim Medici-Cvklus) — damit war noch nicht
das Walten und Sichauswirken aller hier beteiligten Kunst-
kräfte erklärt. Denn die Schule, die beinahe anonyme Ge-
meinschaft der Werkstatt, diese Gemeinschaft, die ihrerseits
auch wieder aus einem weitverzweigten Quellensystem ge-
speist wurde, brachte unfaßbare Dinge herzu, steigerte ihre
einzelnen Angehörigen immer gegenseitig und ist nur als
Ensemble ganz zu begreifen. „Das Meistergeheimnis des
St. Wolfsganger Altars" (so lautet die Überschrift über dem
Schlußkapitel der vorliegenden Veröffentlichung) bleibt in
nicht unwesentlichen Punkten glücklicherweise eben Ge-
heimnis, wie alles organisch Gewachsene.
Robert Stiassny, der verstorbene Wiener Kunsthistoriker,
hat das Erscheinen seiner großen zusammenfassenden Arbeit
über diesen Altar nicht mehr erlebt. Hans Tietze hat es
in treuer Hingabe veröffentlicht und ihm ein Vorwort vor-
ausgeschickt, in dem man sich über Art und Forschungs-
weise dieses ebenso verdienten wie unglücklichen Gelehrten
unterrichten mag. Daß Stiassny die Fertigstellung seines
Hauptwerks nicht mehr sah, gehört zur Tragik seines Da-
seins. Wäre er noch am Leben, so könnte er sich mit Stolz
sagen, daß er den Kunstforschungen der Wiener Schule ein
neues Ruhmesblatt hinzufügte. Die vorwiegend historische
Methode der Kunstwissenschaft, heute auf einsamem Posten
stehend, löste hier ein Problem, an dessen Lösung ästheti-
sierende und intuitive Betrachtungsweise allein scheitern
mußten. Daß dabei am Wege eine Fülle von historischen
und kulturhistorischen Gewinnen erwuchsen, wird erst von
künftigen Forschern erschöpfend gewürdigt werden.
Denn allmählich und in jahrzehntelanger Arbeit ward das
Problem, die Entstehung dieses einen Altars genau zu er-
forschen, zum Zentralproblem für unsre Kenntnis der großen
spätgotischen Altarkunst überhaupt. Wer die Kontrakte über
die Lieferung eines solchen Altares in all ihren kulturhistorisch
und wirtschaftspolitisch so viel verzweigten Einzelkeiten nicht
kennt; wer die Besonderheit der Stelle und der kirchlichen
Eigentümlichkeiten, für welche dieser Auftrag erteilt wurde,
nicht in Anschlag bringt, muß mit seinem Urteil an der
Oberfläche haften bleiben und vermag den Sinn des Ganzen
nicht zu durchdringen. Die geistige Leistung, nur einmal
auf ikonographischem Gebiete, müßte ihm stumm bleiben,
weil aus der Vorstellung des Gegenständlichen manaher for-
male Wert erst verständlich wird. — Michael Pacher ist Ti-
roler. Seine Kunst, hier im Altar von St. Wolfgang auf
ihrem Höhepunkt, zeigt das „tirolische Janusgesicht", von
dem Robert Vischer einmal in seinen Studien zur bayrischen
Kunstgeschichte sprach. Eingesessen Bergbäurisches, von
burgundisch-flämischer Kunstwelle nicht mehr berührt als
etwa oberdeutsche Kunst auch, mischt sich gelegentlich, be-
sonders in den Malereien, mit paduanischem und nach-
mantegneskem'ferraresischem Formengeist. Aber die Durch-
dringung dieser Elemente erweist sich als schöpferisch: in
manchen Dingen, wie etwa dem Problem des Raumes als
künstlerisches (nicht nur wissenschaftliches) Bildelement,
geht Pacher über Mantegna hinaus und empfindet auch die
Farbe als raumbildenden Faktor. Er hat, alles in allem,
etwas neues Deutsches aus dem Fremden herausgeholt.
„Einem aufgepfropften Edelreis gleich hatte der romanische
Einschlag in diesen Südalpentälern auf die Triebkraft der
heimischen Kunst gewirkt."
Wenn doch die Scheidung der Elemente bei der andern
Pacherfrage auch so lösbar wäre wie hier bei dem kunst-
nationalen Problem — bei der Frage nämlich, wie weit
Pacher Maler und wie weit er Bildschnitzer warl Nicht
für den vorliegenden Fall der Beteiligung Pachers an dem
geschnitzten Schrein und an den gemalten Tafeln; hierüber
ist sich Stiassny ziemlich klar geworden. Aber die Frage, was
in seiner Seele dominierte, der Plastiker oder der Maler,
dies, scheint mir, ist noch nicht restlos beantwortet und
wird sich vielleicht nie beantworten lassen. Die Marien-
tafeln sind sehr bedeutend, so gut wie der Meister von
St. Severin und besser. Aber einzelne geschnitzte Köpfe,
etwa der des heiligen Benedikt, stehen so hoch über allem
Gleichzeitigen (man schrieb 1481!), daß man meinen möchte,
der Mann, der dies machte, sei nur und immer wieder Pla-
stiker gewesen. Mag das Schnitzen den Tirolern von Haus
aus geläufig gewesen sein und mag das ursprünglich Pla-
stische solcher Köpfe für damals nur sozusagen den Mal-
grund abgegeben haben fürdenPolychromisten,den„Imagier"
— wer nur mit den plastischen Formen solchen Charakter
schafft und derartigen Ausdruck, der lebt innerlichst von
bildhauerischer Vision. Zudem: diese Plastik weist keine
aber auch gar keine paduanischen oder sonstwie oberitalie-
nischen Einflüsse auf, wie denn alles Geschnitzte an dem
Schrein viel deutscher ist, als alles Gemalte. Das Problem
steht also folgendermaßen: entweder hat Pacher garnicht
den Hauptanteil an den plastischen Partien des Altars, dann
lebte in seiner Sechsmännerwerkstatt ein Genie, neben
78