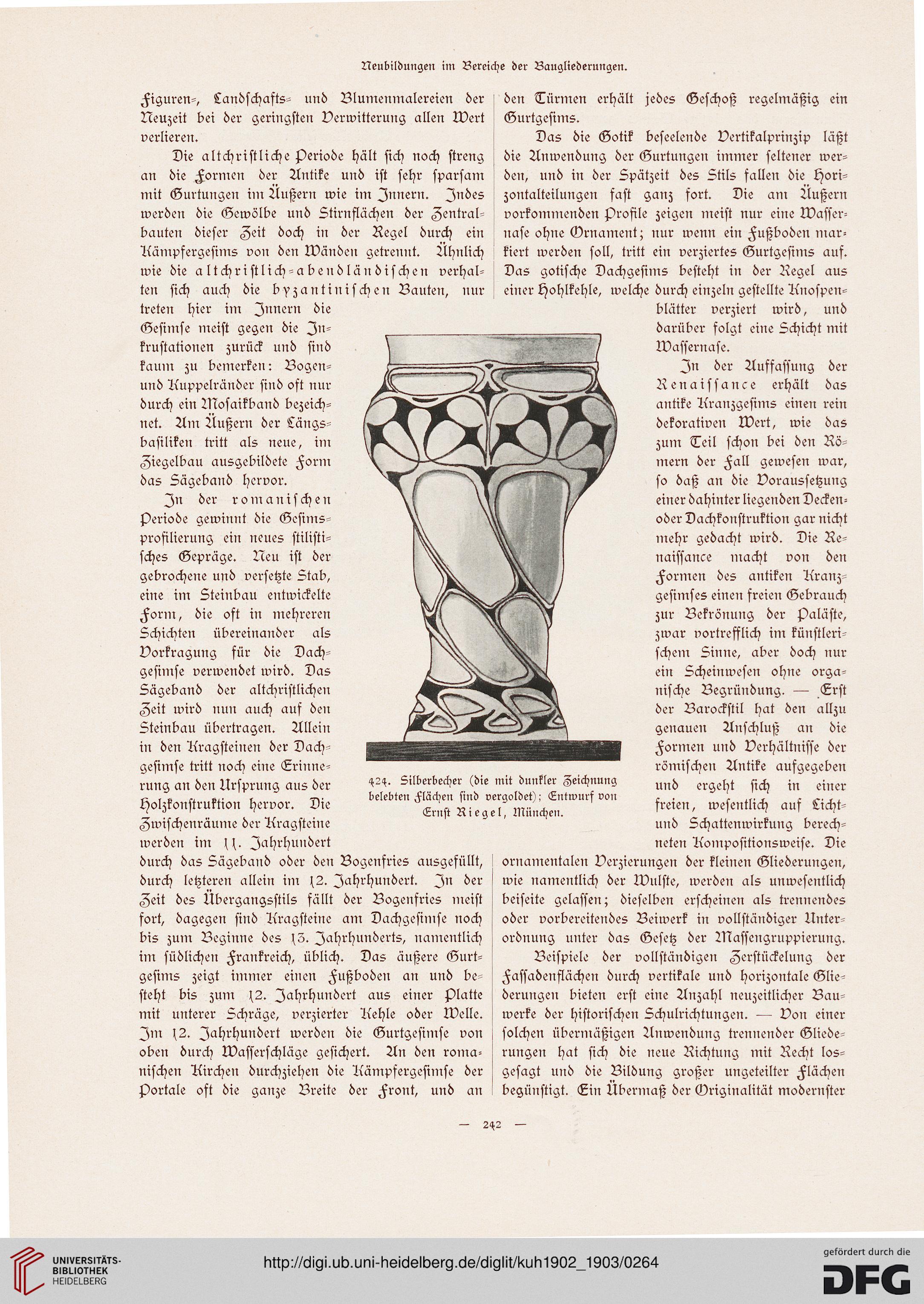Neubildungen im Bereiche der Baugliederungen.
Figuren-, Landschafts- und Blumenmalereien der
Neuzeit bei der geringsten Verwitterung allen Wert
verlieren.
Die altchristliche Periode hält sich noch streng
au die Formen der Antike und ist sehr sparsam
mit Gurtungen im Äußern wie im Innern. Indes
werden die Gewölbe und Stirnflächen der Zentral-
bauten dieser Zeit doch in der Regel durch ein
Kämpfergesims von den Wänden getrennt. Ähnlich
wie die a ltchristlich-a beud län dischen verhal-
ten sich auch die byzantinischen Bauten, nur
treten hier im Innern die
Gesimse meist gegen die In-
krustationen zurück und sind
kauin zu bemerken: Bogen-
und Kuppelränder sind oft nur
durch ein Nosaikband bezeich-
net. Am Äußern der Längs-
basiliken tritt als neue, im
Ziegelbau ausgebildete Form
das Sägeband hervor.
In der romanischen
Periode gewinnt die Gesims-
profllierung ein neues stilisti-
sches Gepräge. Neu ist der
gebrochene und versetzte Stab,
eine im Steinbau entwickelte
Form, die oft in mehreren
Schichten übereinander als
Vorkragung für die Dach-
gesimse verwendet wird. Das
Sägeband der altchristlichen
Zeit wird nun auch auf den
Steinbau übertragen. Allein
in den Kragsteinen der Dach-
gesimse tritt noch eine Erinne-
rung an den Ursprung aus der
polzkonstruktion hervor. Die
Zwischenräume der Kragsteins
werden im \{. Jahrhundert
durch das Sägeband oder den Bogenfries ausgefüllt,
durch letzteren allein im \2. Jahrhundert. In der
Zeit des Übergangsstils fällt der Bogenfries meist
fort, dagegen sind Kragsteine am Dachgesimse noch
bis zum Beginne des f3. Jahrhunderts, namentlich
im südlichen Frankreich, üblich. Das äußere Gurt-
gesims zeigt immer einen Fußboden an und be-
steht bis zum \2, Jahrhundert aus einer Platte
mit unterer Schräge, verzierter Kehle oder Welle.
Im \2. Jahrhundert werden die Gurtgesimse von
oben durch Wasserschläge gesichert. An den roma-
nischen Kirchen durchziehen die Kämpfergesimse der
Portale oft die ganze Breite der Front, und an
den Türmen erhält jedes Geschoß regelmäßig ein
Gurtgesims.
Das die Gotik beseelende Vertikalprinzip läßt
die Anwendung der Gurtungen immer seltener wer-
den, und in der Spätzeit des Stils fallen die pori-
zontalteilungen fast ganz fort. Die an: Äußern
vorkommenden Profile zeigen meist nur eine Wasser-
nase ohne Ornament; nur wenn ein Fußboden niar-
kiert werden soll, tritt ein verziertes Gurtgesims auf.
Das gotische Dachgesims besteht in der Regel aus
einer Hohlkehle, welche durch einzeln gestellte Knospen-
blätter verziert wird, und
darüber folgt eine Schicht mit
Wassernase.
In der Auffassung der
Renaissance erhält das
antike Kranzgesims einen rein
dekorativen Wert, wie das
zum Teil schon bei den Rö-
mern der Fall gewesen war,
so daß an die Voraussetzung
einer dahinter liegenden Decken-
oder Dachkonstruktion gar nicht
mehr gedacht wird. Die Re-
naissance macht von den
Formen des antiken Kranz-
gesimfes einen freien Gebrauch
zur Bekrönung der Paläste,
zwar vortrefflich im künstleri-
schem Sinne, aber doch nur
ein Scheinwesen ohne orga-
nische Begründung. — Erst
der Barockstil hat den allzu
genauen Anschluß an die
Formen und Verhältnisse der
römischen Antike aufgegeben
und ergeht sich in einer
freien, wesentlich auf Licht-
und Schattenwirkung berech-
neten Kompositionsweise. Die
ornamentalen Verzierungen der kleinen Gliederungen,
wie namentlich der Wulste, werden als unwesentlich
beiseite gelassen; dieselben erscheinen als trennendes
oder vorbereitendes Beiwerk in vollständiger Unter-
ordnung unter das Gesetz der Nkaffengruppierung.
Beispiele der vollständigen Zerstückelung der
Fassadenflächen durch vertikale und horizontale Glie-
derungen bieten erst eine Anzahl neuzeitlicher Bau-
werke der historischen Schulrichtungen. — Von einer
solchen überniäßigen Anwendung trennender Gliede-
rungen hat sich die neue Richtung mit Recht los-
gefagt und die Bildung großer ungeteilter Flächen
begünstigt. Ein Übermaß der Originalität modernster
Silberbecher (die mit dunkler Zeichnung
belebten Flächen sind vergoldet); Entwurf von
Ernst Riegel, München.
Figuren-, Landschafts- und Blumenmalereien der
Neuzeit bei der geringsten Verwitterung allen Wert
verlieren.
Die altchristliche Periode hält sich noch streng
au die Formen der Antike und ist sehr sparsam
mit Gurtungen im Äußern wie im Innern. Indes
werden die Gewölbe und Stirnflächen der Zentral-
bauten dieser Zeit doch in der Regel durch ein
Kämpfergesims von den Wänden getrennt. Ähnlich
wie die a ltchristlich-a beud län dischen verhal-
ten sich auch die byzantinischen Bauten, nur
treten hier im Innern die
Gesimse meist gegen die In-
krustationen zurück und sind
kauin zu bemerken: Bogen-
und Kuppelränder sind oft nur
durch ein Nosaikband bezeich-
net. Am Äußern der Längs-
basiliken tritt als neue, im
Ziegelbau ausgebildete Form
das Sägeband hervor.
In der romanischen
Periode gewinnt die Gesims-
profllierung ein neues stilisti-
sches Gepräge. Neu ist der
gebrochene und versetzte Stab,
eine im Steinbau entwickelte
Form, die oft in mehreren
Schichten übereinander als
Vorkragung für die Dach-
gesimse verwendet wird. Das
Sägeband der altchristlichen
Zeit wird nun auch auf den
Steinbau übertragen. Allein
in den Kragsteinen der Dach-
gesimse tritt noch eine Erinne-
rung an den Ursprung aus der
polzkonstruktion hervor. Die
Zwischenräume der Kragsteins
werden im \{. Jahrhundert
durch das Sägeband oder den Bogenfries ausgefüllt,
durch letzteren allein im \2. Jahrhundert. In der
Zeit des Übergangsstils fällt der Bogenfries meist
fort, dagegen sind Kragsteine am Dachgesimse noch
bis zum Beginne des f3. Jahrhunderts, namentlich
im südlichen Frankreich, üblich. Das äußere Gurt-
gesims zeigt immer einen Fußboden an und be-
steht bis zum \2, Jahrhundert aus einer Platte
mit unterer Schräge, verzierter Kehle oder Welle.
Im \2. Jahrhundert werden die Gurtgesimse von
oben durch Wasserschläge gesichert. An den roma-
nischen Kirchen durchziehen die Kämpfergesimse der
Portale oft die ganze Breite der Front, und an
den Türmen erhält jedes Geschoß regelmäßig ein
Gurtgesims.
Das die Gotik beseelende Vertikalprinzip läßt
die Anwendung der Gurtungen immer seltener wer-
den, und in der Spätzeit des Stils fallen die pori-
zontalteilungen fast ganz fort. Die an: Äußern
vorkommenden Profile zeigen meist nur eine Wasser-
nase ohne Ornament; nur wenn ein Fußboden niar-
kiert werden soll, tritt ein verziertes Gurtgesims auf.
Das gotische Dachgesims besteht in der Regel aus
einer Hohlkehle, welche durch einzeln gestellte Knospen-
blätter verziert wird, und
darüber folgt eine Schicht mit
Wassernase.
In der Auffassung der
Renaissance erhält das
antike Kranzgesims einen rein
dekorativen Wert, wie das
zum Teil schon bei den Rö-
mern der Fall gewesen war,
so daß an die Voraussetzung
einer dahinter liegenden Decken-
oder Dachkonstruktion gar nicht
mehr gedacht wird. Die Re-
naissance macht von den
Formen des antiken Kranz-
gesimfes einen freien Gebrauch
zur Bekrönung der Paläste,
zwar vortrefflich im künstleri-
schem Sinne, aber doch nur
ein Scheinwesen ohne orga-
nische Begründung. — Erst
der Barockstil hat den allzu
genauen Anschluß an die
Formen und Verhältnisse der
römischen Antike aufgegeben
und ergeht sich in einer
freien, wesentlich auf Licht-
und Schattenwirkung berech-
neten Kompositionsweise. Die
ornamentalen Verzierungen der kleinen Gliederungen,
wie namentlich der Wulste, werden als unwesentlich
beiseite gelassen; dieselben erscheinen als trennendes
oder vorbereitendes Beiwerk in vollständiger Unter-
ordnung unter das Gesetz der Nkaffengruppierung.
Beispiele der vollständigen Zerstückelung der
Fassadenflächen durch vertikale und horizontale Glie-
derungen bieten erst eine Anzahl neuzeitlicher Bau-
werke der historischen Schulrichtungen. — Von einer
solchen überniäßigen Anwendung trennender Gliede-
rungen hat sich die neue Richtung mit Recht los-
gefagt und die Bildung großer ungeteilter Flächen
begünstigt. Ein Übermaß der Originalität modernster
Silberbecher (die mit dunkler Zeichnung
belebten Flächen sind vergoldet); Entwurf von
Ernst Riegel, München.