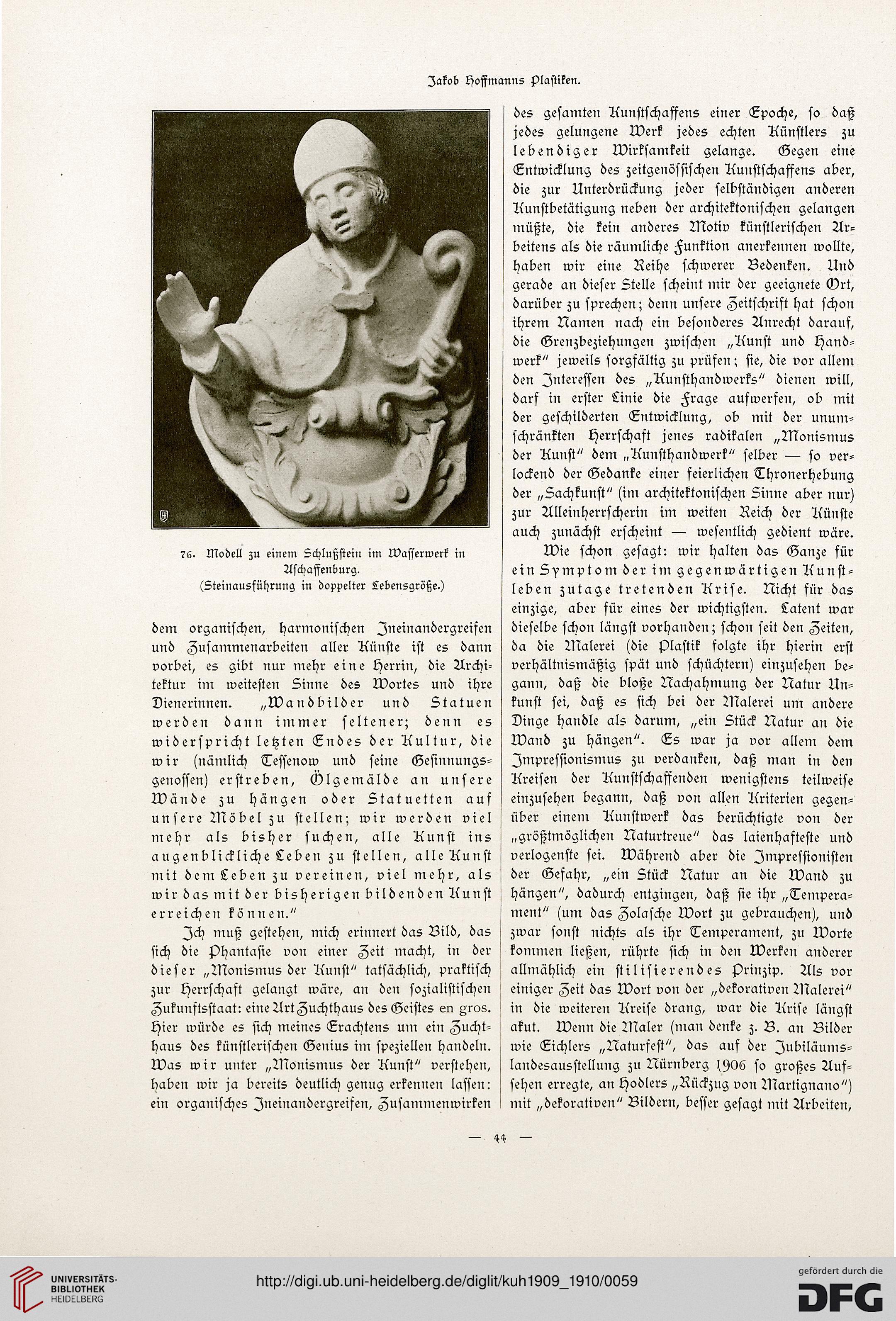Jakob ksoffmanns Plastiken.
76. Modell zu einem Schlußstein im Wasserwerk in
Aschasfenburg.
(Steinausführung in doppelter Lebensgröße.)
dein organischen, harmonischen Ineinandergreifen
und Zusammenarbeiten aller Aünste ist es dann
vorbei, es gibt nur mehr eine Herrin, die Archi-
tektur im weitesten Sinne des Wortes und ihre
Dienerinnen. „Wandbilder und Statuen
werden dann immer seltener; denn es
widerspricht letzten Endes der Aultur, die
wir (nämlich Tessenow und seine Gesinnungs-
genossen) erstreben, Mlgemälde an unsere
Wände zu häirgen oder Statuetten auf
unsere Möbel zu stellen; wir werden viel
nrehr als bisher suchen, alle Aunst ins
augenblickliche Leben zu ftellen, alle Aunst
ntit de nr Leben zu vereinen, viel mehr, als
wir das mit der bisherigen bildenden Aunst
erreichen können."
Ich muß gestehen, mich erinnert das Bild, das
sich die Phantasie von einer Zeit macht, in der
dieser „Monismus der Aunst" tatsächlich, praktisch
zur Herrschaft gelangt wäre, an den sozialistischen
Zukunftsstaat: eine Art Zuchthaus des Geistes en gros.
!)ier würde es sich meines Erachtens um ein Zucht-
haus des künstlerischen Genius im speziellen handeln.
Was wir unter „Monismus der Aunst" verstehen,
haben wir ja bereits deutlich genug erkennen lassen:
ein organisches Ineinandergreifen, Zusammenwirken
des gesamten Aunstschaffens einer Epoche, so daß
jedes gelungene Werk jedes echten Aünstlers zu
lebendiger Wirksamkeit gelange. Gegen eilte
Entwicklung des zeitgenössischen Aunstschaffens aber,
die zur Unterdrückung jeder selbständigen anderen
Aunstbetätigung neben der architektoitischen gelangen
iitüßte, die kein anderes Motiv künstlerischen Ar-
beitens als die räumliche Funktion anerkennen wollte,
haben wir eine Reihe schwerer Bedenken. Und
gerade an dieser Stelle scheint mir der geeignete Drt,
darüber zu sprechen; denn unsere Zeitschrift hat schon
ihrem Namen nach ein besonderes Anrecht darauf,
die Grenzbeziehungen zwischen „Aunst und Hand-
werk" jeweils sorgfältig zu prüfen; sie, die vor allem
den Interessen des „Aunfthandwerks" dieneit will,
darf in erster Linie die Hrage aufwerfen, ob mit
der geschilderten Entwicklung, ob mit der unuin-
schränkten Herrschaft jenes radikalen „Monismus
der Aunst" dem „Aunfthandwerk" selber — so ver-
lockend der Gedanke einer feierlichen Thronerhebung
der „Sachkunst" (im architektonischen Sinne aber nur)
zur Alleinherrscherin im weiten Reich der Aünste
auch zunächst erscheint —■ wesentlich gedient wäre.
Wie schon gesagt: wir halten das Ganze für
ein Symptom der i m gegenwärtigen A u n st -
leben zutage tretenden Arise. Nicht für das
einzige, aber für eines der wichtigsten. Latent war
dieselbe schon längst vorhanden; schon seit den Zeiten,
da die Malerei (die Plastik folgte ihr hierin erst
verhältnismäßig spät und schüchtern) einzusehen be-
gann, daß die bloße Nachahmung der Natur Un-
kunst sei, daß es sich bei der Malerei um andere
Dinge handle als darum, „ein Stück Natur an die
wand zu hängen". Es war ja vor allem dem
Impressionismus zu verdanken, daß man in den
Areisen der Aunstschaffenden wenigstens teilweise
einzusehen begann, daß von allen Ariterien gegen-
über einem Aunstwerk das berüchtigte von der
„größtmöglichen Naturtreue" das laienhafteste und
verlogenste sei. Während aber die Impressionisten
der Gefahr, „ein Stück Natur an die Wand zu
hängen", dadurch entgingen, daß sie ihr „Tempera-
ment" (um das Zolasche Wort zu gebrauchen), und
zwar sonst nichts als ihr Temperament, zu Worte
kommen ließen, rührte sich in den Werken anderer
allmählich ein stilisierendes Prinzip. Als vor
einiger Zeit das Wort von der „dekorativen Malerei"
in die weiteren Areise drang, war die Arise längst
akut. Wenn die Maler (man denke z. B. an Bilder
wie Eichlers „Naturfest", das auf der Iubiläums-
landesausstellung zu Nürnberg (906 so großes Auf-
sehen erregte, an Hodlers „Rückzug von Martignano")
mit „dekorativen" Bildern, bester gesagt mit Arbeiten,
76. Modell zu einem Schlußstein im Wasserwerk in
Aschasfenburg.
(Steinausführung in doppelter Lebensgröße.)
dein organischen, harmonischen Ineinandergreifen
und Zusammenarbeiten aller Aünste ist es dann
vorbei, es gibt nur mehr eine Herrin, die Archi-
tektur im weitesten Sinne des Wortes und ihre
Dienerinnen. „Wandbilder und Statuen
werden dann immer seltener; denn es
widerspricht letzten Endes der Aultur, die
wir (nämlich Tessenow und seine Gesinnungs-
genossen) erstreben, Mlgemälde an unsere
Wände zu häirgen oder Statuetten auf
unsere Möbel zu stellen; wir werden viel
nrehr als bisher suchen, alle Aunst ins
augenblickliche Leben zu ftellen, alle Aunst
ntit de nr Leben zu vereinen, viel mehr, als
wir das mit der bisherigen bildenden Aunst
erreichen können."
Ich muß gestehen, mich erinnert das Bild, das
sich die Phantasie von einer Zeit macht, in der
dieser „Monismus der Aunst" tatsächlich, praktisch
zur Herrschaft gelangt wäre, an den sozialistischen
Zukunftsstaat: eine Art Zuchthaus des Geistes en gros.
!)ier würde es sich meines Erachtens um ein Zucht-
haus des künstlerischen Genius im speziellen handeln.
Was wir unter „Monismus der Aunst" verstehen,
haben wir ja bereits deutlich genug erkennen lassen:
ein organisches Ineinandergreifen, Zusammenwirken
des gesamten Aunstschaffens einer Epoche, so daß
jedes gelungene Werk jedes echten Aünstlers zu
lebendiger Wirksamkeit gelange. Gegen eilte
Entwicklung des zeitgenössischen Aunstschaffens aber,
die zur Unterdrückung jeder selbständigen anderen
Aunstbetätigung neben der architektoitischen gelangen
iitüßte, die kein anderes Motiv künstlerischen Ar-
beitens als die räumliche Funktion anerkennen wollte,
haben wir eine Reihe schwerer Bedenken. Und
gerade an dieser Stelle scheint mir der geeignete Drt,
darüber zu sprechen; denn unsere Zeitschrift hat schon
ihrem Namen nach ein besonderes Anrecht darauf,
die Grenzbeziehungen zwischen „Aunst und Hand-
werk" jeweils sorgfältig zu prüfen; sie, die vor allem
den Interessen des „Aunfthandwerks" dieneit will,
darf in erster Linie die Hrage aufwerfen, ob mit
der geschilderten Entwicklung, ob mit der unuin-
schränkten Herrschaft jenes radikalen „Monismus
der Aunst" dem „Aunfthandwerk" selber — so ver-
lockend der Gedanke einer feierlichen Thronerhebung
der „Sachkunst" (im architektonischen Sinne aber nur)
zur Alleinherrscherin im weiten Reich der Aünste
auch zunächst erscheint —■ wesentlich gedient wäre.
Wie schon gesagt: wir halten das Ganze für
ein Symptom der i m gegenwärtigen A u n st -
leben zutage tretenden Arise. Nicht für das
einzige, aber für eines der wichtigsten. Latent war
dieselbe schon längst vorhanden; schon seit den Zeiten,
da die Malerei (die Plastik folgte ihr hierin erst
verhältnismäßig spät und schüchtern) einzusehen be-
gann, daß die bloße Nachahmung der Natur Un-
kunst sei, daß es sich bei der Malerei um andere
Dinge handle als darum, „ein Stück Natur an die
wand zu hängen". Es war ja vor allem dem
Impressionismus zu verdanken, daß man in den
Areisen der Aunstschaffenden wenigstens teilweise
einzusehen begann, daß von allen Ariterien gegen-
über einem Aunstwerk das berüchtigte von der
„größtmöglichen Naturtreue" das laienhafteste und
verlogenste sei. Während aber die Impressionisten
der Gefahr, „ein Stück Natur an die Wand zu
hängen", dadurch entgingen, daß sie ihr „Tempera-
ment" (um das Zolasche Wort zu gebrauchen), und
zwar sonst nichts als ihr Temperament, zu Worte
kommen ließen, rührte sich in den Werken anderer
allmählich ein stilisierendes Prinzip. Als vor
einiger Zeit das Wort von der „dekorativen Malerei"
in die weiteren Areise drang, war die Arise längst
akut. Wenn die Maler (man denke z. B. an Bilder
wie Eichlers „Naturfest", das auf der Iubiläums-
landesausstellung zu Nürnberg (906 so großes Auf-
sehen erregte, an Hodlers „Rückzug von Martignano")
mit „dekorativen" Bildern, bester gesagt mit Arbeiten,