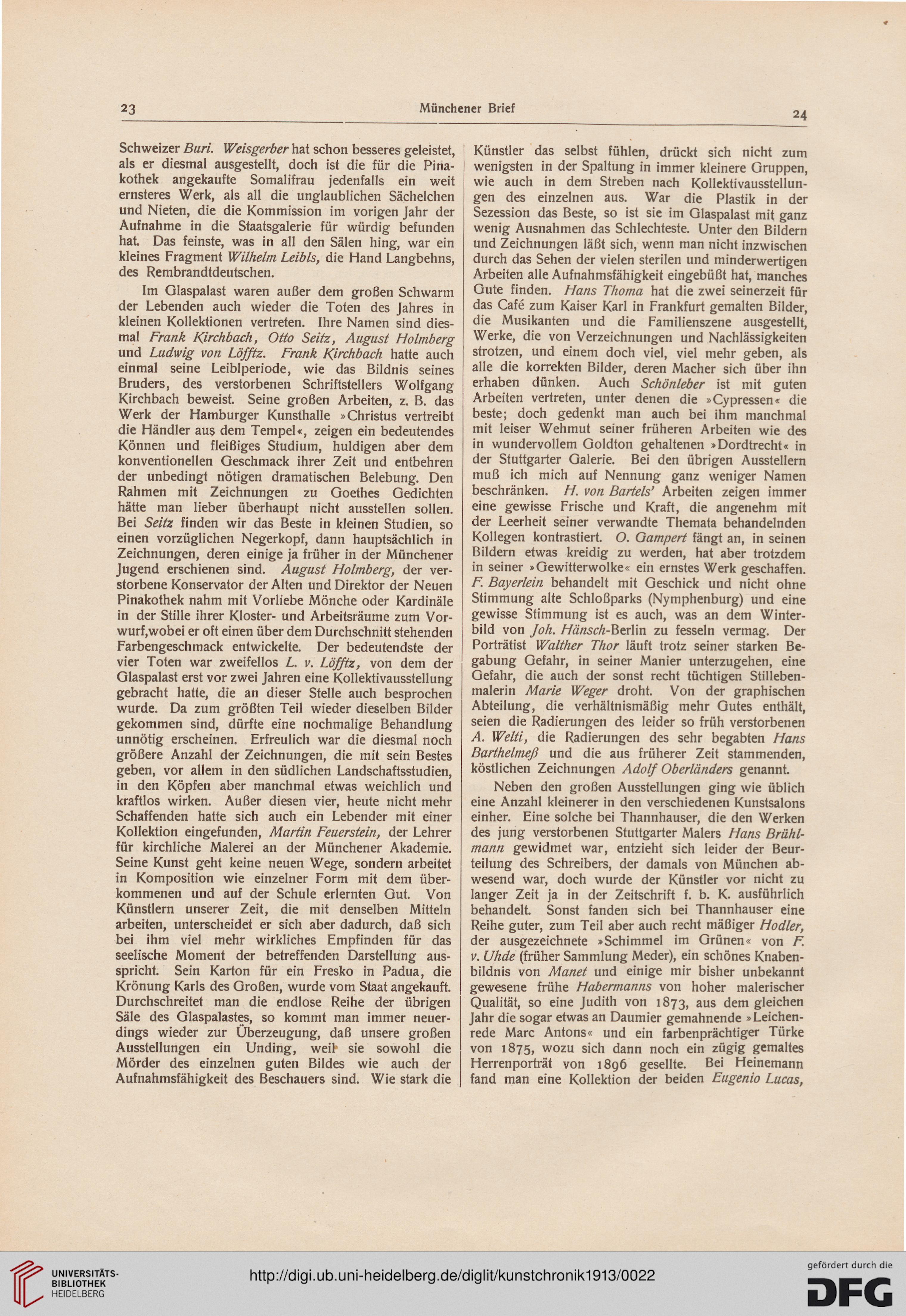23
Münchener Brief
24
Schweizer Bari. Weisgerber hat schon besseres geleistet,
als er diesmal ausgestellt, doch ist die für die Pina-
kothek angekaufte Somalifrau jedenfalls ein weit
ernsteres Werk, als all die unglaublichen Sächelchen
und Nieten, die die Kommission im vorigen Jahr der
Aufnahme in die Staatsgalerie für würdig befunden
hat. Das feinste, was in all den Sälen hing, war ein
kleines Fragment Wilhelm Leibis, die Hand Langbehns,
des Rembrandtdeutschen.
Im Glaspalast waren außer dem großen Schwärm
der Lebenden auch wieder die Toten des Jahres in
kleinen Kollektionen vertreten. Ihre Namen sind dies-
mal Frank Kirchbach, Otto Seitz, August Holmberg
und Ludwig von Löfftz. Frank Kirchbach hatte auch
einmal seine Leibiperiode, wie das Bildnis seines
Bruders, des verstorbenen Schriftstellers Wolfgang
Kirchbach beweist. Seine großen Arbeiten, z. B. das
Werk der Hamburger Kunsthalle »Christus vertreibt
die Händler aus dem Tempel«, zeigen ein bedeutendes
Können und fleißiges Studium, huldigen aber dem
konventionellen Geschmack ihrer Zeit und entbehren
der unbedingt nötigen dramatischen Belebung. Den
Rahmen mit Zeichnungen zu Goethes Gedichten
hätte man lieber überhaupt nicht ausstellen sollen.
Bei Seitz finden wir das Beste in kleinen Studien, so
einen vorzüglichen Negerkopf, dann hauptsächlich in
Zeichnungen, deren einige ja früher in der Münchener
Jugend erschienen sind. August Holmberg, der ver-
storbene Konservator der Alten und Direktor der Neuen
Pinakothek nahm mit Vorliebe Mönche oder Kardinäle
in der Stille ihrer Kloster- und Arbeitsräume zum Vor-
wurf, wobei er oft einen über dem Durchschnitt stehenden
Farbengeschmack entwickelte. Der bedeutendste der
vier Toten war zweifellos L. v. Löfftz, von dem der
Glaspalast erst vor zwei Jahren eine Kollektivausstellung
gebracht hatte, die an dieser Stelle auch besprochen
wurde. Da zum größten Teil wieder dieselben Bilder
gekommen sind, dürfte eine nochmalige Behandlung
unnötig erscheinen. Erfreulich war die diesmal noch
größere Anzahl der Zeichnungen, die mit sein Bestes
geben, vor allem in den südlichen Landschaftsstudien,
in den Köpfen aber manchmal etwas weichlich und
kraftlos wirken. Außer diesen vier, heute nicht mehr
Schaffenden hatte sich auch ein Lebender mit einer
Kollektion eingefunden, Martin Feuerstein, der Lehrer
für kirchliche Malerei an der Münchener Akademie.
Seine Kunst geht keine neuen Wege, sondern arbeitet
in Komposition wie einzelner Form mit dem über-
kommenen und auf der Schule erlernten Gut. Von
Künstlern unserer Zeit, die mit denselben Mitteln
arbeiten, unterscheidet er sich aber dadurch, daß sich
bei ihm viel mehr wirkliches Empfinden für das
seelische Moment der betreffenden Darstellung aus-
spricht. Sein Karton für ein Fresko in Padua, die
Krönung Karls des Großen, wurde vom Staat angekauft.
Durchschreitet man die endlose Reihe der übrigen
Säle des Glaspalastes, so kommt man immer neuer-
dings wieder zur Überzeugung, daß unsere großen
Ausstellungen ein Unding, weil sie sowohl die
Mörder des einzelnen guten Bildes wie auch der
Aufnahmsfähigkeit des Beschauers sind. Wie stark die
Künstler das selbst fühlen, drückt sich nicht zum
wenigsten in der Spaltung in immer kleinere Gruppen,
wie auch in dem Streben nach Kollektivausstellun-
gen des einzelnen aus. War die Plastik in der
Sezession das Beste, so ist sie im Glaspalast mit ganz
wenig Ausnahmen das Schlechteste. Unter den Bildern
und Zeichnungen läßt sich, wenn man nicht inzwischen
durch das Sehen der vielen sterilen und minderwertigen
Arbeiten alle Aufnahmsfähigkeit eingebüßt hat, manches
Gute finden. Hans Thoma hat die zwei seinerzeit für
das Cafe zum Kaiser Karl in Frankfurt gemalten Bilder,
die Musikanten und die Familienszene ausgestellt,
Werke, die von Verzeichnungen und Nachlässigkeiten
strotzen, und einem doch viel, viel mehr geben, als
alle die korrekten Bilder, deren Macher sich über ihn
erhaben dünken. Auch Schönleber ist mit guten
Arbeiten vertreten, unter denen die »Cypressen« die
beste; doch gedenkt man auch bei ihm manchmal
mit leiser Wehmut seiner früheren Arbeiten wie des
in wundervollem Goldton gehaltenen »Dordtrecht« in
der Stuttgarter Galerie. Bei den übrigen Ausstellern
muß ich mich auf Nennung ganz weniger Namen
beschränken. H. von Bartels' Arbeiten zeigen immer
eine gewisse Frische und Kraft, die angenehm mit
der Leerheit seiner verwandte Themata behandelnden
Kollegen kontrastiert. O. Oampert fängt an, in seinen
Bildern etwas kreidig zu werden, hat aber trotzdem
in seiner »Gewitterwolke« ein ernstes Werk geschaffen.
F. Bayerlein behandelt mit Geschick und nicht ohne
Stimmung alte Schloßparks (Nymphenburg) und eine
gewisse Stimmung ist es auch, was an dem Winter-
bild von Joh. Hänsch-BerYm zu fesseln vermag. Der
Porträtist Walther Thor läuft trotz seiner starken Be-
gabung Gefahr, in seiner Manier unterzugehen, eine
Gefahr, die auch der sonst recht tüchtigen Stilleben-
malerin Marie Weger droht. Von der graphischen
Abteilung, die verhältnismäßig mehr Gutes enthält,
seien die Radierungen des leider so früh verstorbenen
A. Welti, die Radierungen des sehr begabten Hans
Barthelmeß und die aus früherer Zeit stammenden,
köstlichen Zeichnungen Adolf Oberländers genannt
Neben den großen Ausstellungen ging wie üblich
eine Anzahl kleinerer in den verschiedenen Kunstsalons
einher. Eine solche bei Thannhauser, die den Werken
des jung verstorbenen Stuttgarter Malers Hans Brühl-
mann gewidmet war, entzieht sich leider der Beur-
teilung des Schreibers, der damals von München ab-
wesend war, doch wurde der Künstler vor nicht zu
langer Zeit ja in der Zeitschrift f. b. K. ausführlich
behandelt. Sonst fanden sich bei Thannhauser eine
Reihe guter, zum Teil aber auch recht mäßiger Hodler,
der ausgezeichnete »Schimmel im Grünen« von F.
v. Uhde (früher Sammlung Meder), ein schönes Knaben-
bildnis von Manet und einige mir bisher unbekannt
gewesene frühe Habermanns von hoher malerischer
Qualität, so eine Judith von 1873, aus dem gleichen
Jahr die sogar etwas an Daumier gemahnende »Leichen-
rede Marc Antons« und ein farbenprächtiger Türke
von 1875, wozu sich dann noch ein zügig gemaltes
Herrenporträt von 1896 gesellte. Bei Heinemann
fand man eine Kollektion der beiden Eugenio Lucas,
Münchener Brief
24
Schweizer Bari. Weisgerber hat schon besseres geleistet,
als er diesmal ausgestellt, doch ist die für die Pina-
kothek angekaufte Somalifrau jedenfalls ein weit
ernsteres Werk, als all die unglaublichen Sächelchen
und Nieten, die die Kommission im vorigen Jahr der
Aufnahme in die Staatsgalerie für würdig befunden
hat. Das feinste, was in all den Sälen hing, war ein
kleines Fragment Wilhelm Leibis, die Hand Langbehns,
des Rembrandtdeutschen.
Im Glaspalast waren außer dem großen Schwärm
der Lebenden auch wieder die Toten des Jahres in
kleinen Kollektionen vertreten. Ihre Namen sind dies-
mal Frank Kirchbach, Otto Seitz, August Holmberg
und Ludwig von Löfftz. Frank Kirchbach hatte auch
einmal seine Leibiperiode, wie das Bildnis seines
Bruders, des verstorbenen Schriftstellers Wolfgang
Kirchbach beweist. Seine großen Arbeiten, z. B. das
Werk der Hamburger Kunsthalle »Christus vertreibt
die Händler aus dem Tempel«, zeigen ein bedeutendes
Können und fleißiges Studium, huldigen aber dem
konventionellen Geschmack ihrer Zeit und entbehren
der unbedingt nötigen dramatischen Belebung. Den
Rahmen mit Zeichnungen zu Goethes Gedichten
hätte man lieber überhaupt nicht ausstellen sollen.
Bei Seitz finden wir das Beste in kleinen Studien, so
einen vorzüglichen Negerkopf, dann hauptsächlich in
Zeichnungen, deren einige ja früher in der Münchener
Jugend erschienen sind. August Holmberg, der ver-
storbene Konservator der Alten und Direktor der Neuen
Pinakothek nahm mit Vorliebe Mönche oder Kardinäle
in der Stille ihrer Kloster- und Arbeitsräume zum Vor-
wurf, wobei er oft einen über dem Durchschnitt stehenden
Farbengeschmack entwickelte. Der bedeutendste der
vier Toten war zweifellos L. v. Löfftz, von dem der
Glaspalast erst vor zwei Jahren eine Kollektivausstellung
gebracht hatte, die an dieser Stelle auch besprochen
wurde. Da zum größten Teil wieder dieselben Bilder
gekommen sind, dürfte eine nochmalige Behandlung
unnötig erscheinen. Erfreulich war die diesmal noch
größere Anzahl der Zeichnungen, die mit sein Bestes
geben, vor allem in den südlichen Landschaftsstudien,
in den Köpfen aber manchmal etwas weichlich und
kraftlos wirken. Außer diesen vier, heute nicht mehr
Schaffenden hatte sich auch ein Lebender mit einer
Kollektion eingefunden, Martin Feuerstein, der Lehrer
für kirchliche Malerei an der Münchener Akademie.
Seine Kunst geht keine neuen Wege, sondern arbeitet
in Komposition wie einzelner Form mit dem über-
kommenen und auf der Schule erlernten Gut. Von
Künstlern unserer Zeit, die mit denselben Mitteln
arbeiten, unterscheidet er sich aber dadurch, daß sich
bei ihm viel mehr wirkliches Empfinden für das
seelische Moment der betreffenden Darstellung aus-
spricht. Sein Karton für ein Fresko in Padua, die
Krönung Karls des Großen, wurde vom Staat angekauft.
Durchschreitet man die endlose Reihe der übrigen
Säle des Glaspalastes, so kommt man immer neuer-
dings wieder zur Überzeugung, daß unsere großen
Ausstellungen ein Unding, weil sie sowohl die
Mörder des einzelnen guten Bildes wie auch der
Aufnahmsfähigkeit des Beschauers sind. Wie stark die
Künstler das selbst fühlen, drückt sich nicht zum
wenigsten in der Spaltung in immer kleinere Gruppen,
wie auch in dem Streben nach Kollektivausstellun-
gen des einzelnen aus. War die Plastik in der
Sezession das Beste, so ist sie im Glaspalast mit ganz
wenig Ausnahmen das Schlechteste. Unter den Bildern
und Zeichnungen läßt sich, wenn man nicht inzwischen
durch das Sehen der vielen sterilen und minderwertigen
Arbeiten alle Aufnahmsfähigkeit eingebüßt hat, manches
Gute finden. Hans Thoma hat die zwei seinerzeit für
das Cafe zum Kaiser Karl in Frankfurt gemalten Bilder,
die Musikanten und die Familienszene ausgestellt,
Werke, die von Verzeichnungen und Nachlässigkeiten
strotzen, und einem doch viel, viel mehr geben, als
alle die korrekten Bilder, deren Macher sich über ihn
erhaben dünken. Auch Schönleber ist mit guten
Arbeiten vertreten, unter denen die »Cypressen« die
beste; doch gedenkt man auch bei ihm manchmal
mit leiser Wehmut seiner früheren Arbeiten wie des
in wundervollem Goldton gehaltenen »Dordtrecht« in
der Stuttgarter Galerie. Bei den übrigen Ausstellern
muß ich mich auf Nennung ganz weniger Namen
beschränken. H. von Bartels' Arbeiten zeigen immer
eine gewisse Frische und Kraft, die angenehm mit
der Leerheit seiner verwandte Themata behandelnden
Kollegen kontrastiert. O. Oampert fängt an, in seinen
Bildern etwas kreidig zu werden, hat aber trotzdem
in seiner »Gewitterwolke« ein ernstes Werk geschaffen.
F. Bayerlein behandelt mit Geschick und nicht ohne
Stimmung alte Schloßparks (Nymphenburg) und eine
gewisse Stimmung ist es auch, was an dem Winter-
bild von Joh. Hänsch-BerYm zu fesseln vermag. Der
Porträtist Walther Thor läuft trotz seiner starken Be-
gabung Gefahr, in seiner Manier unterzugehen, eine
Gefahr, die auch der sonst recht tüchtigen Stilleben-
malerin Marie Weger droht. Von der graphischen
Abteilung, die verhältnismäßig mehr Gutes enthält,
seien die Radierungen des leider so früh verstorbenen
A. Welti, die Radierungen des sehr begabten Hans
Barthelmeß und die aus früherer Zeit stammenden,
köstlichen Zeichnungen Adolf Oberländers genannt
Neben den großen Ausstellungen ging wie üblich
eine Anzahl kleinerer in den verschiedenen Kunstsalons
einher. Eine solche bei Thannhauser, die den Werken
des jung verstorbenen Stuttgarter Malers Hans Brühl-
mann gewidmet war, entzieht sich leider der Beur-
teilung des Schreibers, der damals von München ab-
wesend war, doch wurde der Künstler vor nicht zu
langer Zeit ja in der Zeitschrift f. b. K. ausführlich
behandelt. Sonst fanden sich bei Thannhauser eine
Reihe guter, zum Teil aber auch recht mäßiger Hodler,
der ausgezeichnete »Schimmel im Grünen« von F.
v. Uhde (früher Sammlung Meder), ein schönes Knaben-
bildnis von Manet und einige mir bisher unbekannt
gewesene frühe Habermanns von hoher malerischer
Qualität, so eine Judith von 1873, aus dem gleichen
Jahr die sogar etwas an Daumier gemahnende »Leichen-
rede Marc Antons« und ein farbenprächtiger Türke
von 1875, wozu sich dann noch ein zügig gemaltes
Herrenporträt von 1896 gesellte. Bei Heinemann
fand man eine Kollektion der beiden Eugenio Lucas,