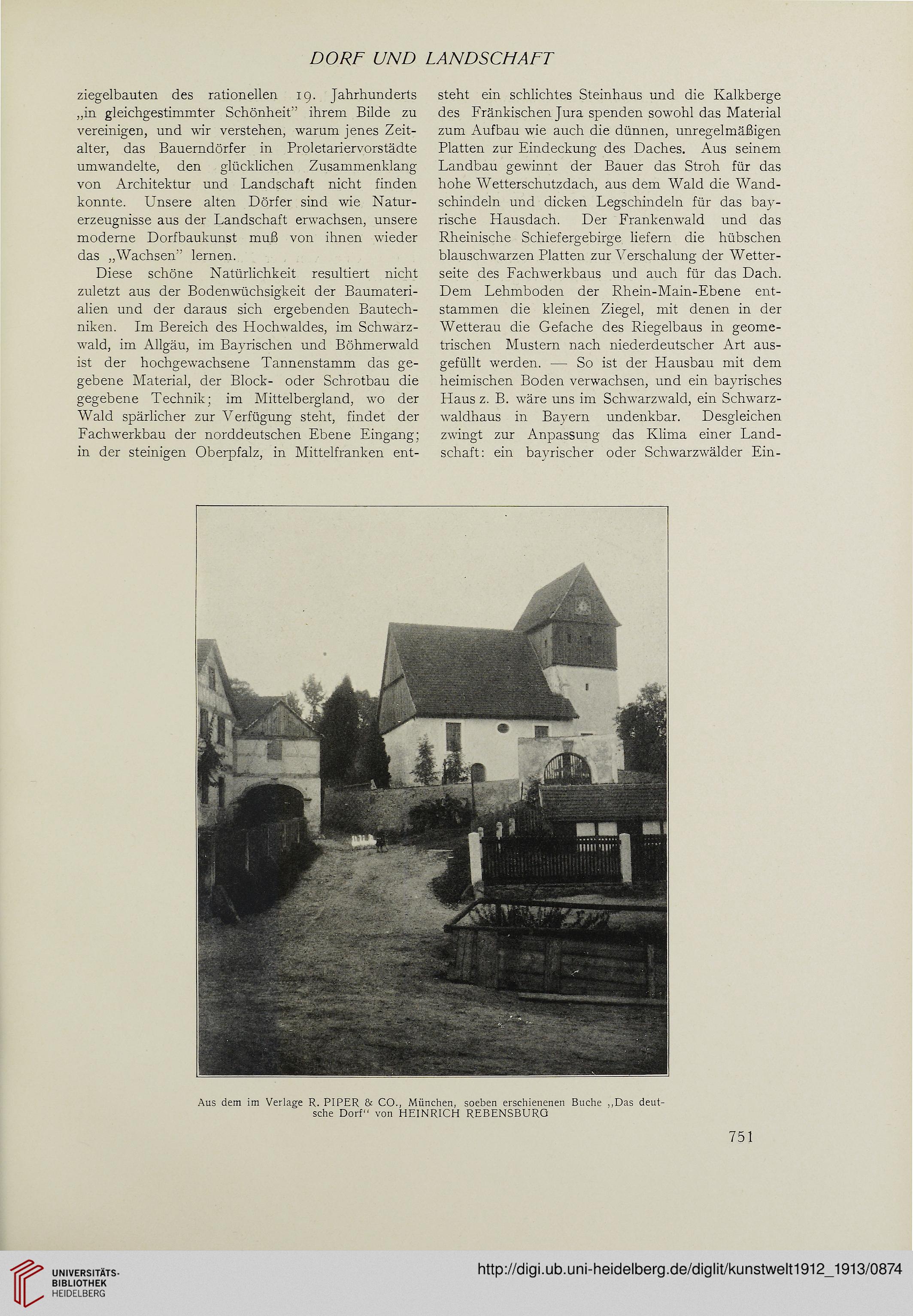DORF UND LANDSCHAFT
Ziegelbauten des rationellen 19. Jahrhunderts
„in gleichgestimmter Schönheit" ihrem Bilde zu
vereinigen, und wir verstehen, warum jenes Zeit-
alter, das Bauerndörfer in Proletariervorstädte
umwandelte, den glücklichen Zusammenklang
von Architektur und Landschaft nicht finden
konnte. Unsere alten Dörfer sind wie Natur-
erzeugnisse aus der Landschaft erwachsen, unsere
moderne Dorfbaukunst muß von ihnen wieder
das „Wachsen'' lernen.
Diese schöne Natürlichkeit resultiert nicht
zuletzt aus der Bodenwüchsigkeit der Baumateri-
alien und der daraus sich ergebenden Bautech-
niken. Im Bereich des Hochwaldes, im Schwarz-
wald, im Allgäu, im Bayrischen und Böhmerwald
ist der hochgewachsene Tannenstamm das ge-
gebene Material, der Block- oder Schrotbau die
gegebene Technik; im Mittelbergland, wo der
Wald spärlicher zur Verfügung steht, findet der
Fachwerkbau der norddeutschen Ebene Eingang;
in der steinigen Oberpfalz, in Mittelfranken ent-
steht ein schlichtes Steinhaus und die Kalkberge
des Fränkischen Jura spenden sowohl das Material
zum Aufbau wie auch die dünnen, unregelmäßigen
Platten zur Eindeckuno; des Daches. Aus seinem
Landbau gewinnt der Bauer das Stroh für das
hohe Wetterschutzdach, aus dem Wald die Wand-
schindeln und dicken Legschindeln für das bay-
rische Hausdach. Der Frankenwald und das
Rheinische Schiefergebirge liefern die hübschen
blauschwarzen Platten zur Verschalung der Wetter-
seite des Fachwerkbaus und auch für das Dach.
Dem Lehmboden der Rhein-Main-Ebene ent-
stammen die kleinen Ziegel, mit denen in der
Wetterau die Gefache des Riegelbaus in geome-
trischen Mustern nach niederdeutscher Art aus-
gefüllt werden. — So ist der Hausbau mit dem
heimischen Boden verwachsen, und ein bayrisches
Haus z. B. wäre uns im Schwarzwald, ein Schwarz-
waldhaus in Bayern undenkbar. Desgleichen
zwingt zur Anpassung das Klima einer Land-
schaft: ein bayrischer oder Schwarzwälder Ein-
751
Ziegelbauten des rationellen 19. Jahrhunderts
„in gleichgestimmter Schönheit" ihrem Bilde zu
vereinigen, und wir verstehen, warum jenes Zeit-
alter, das Bauerndörfer in Proletariervorstädte
umwandelte, den glücklichen Zusammenklang
von Architektur und Landschaft nicht finden
konnte. Unsere alten Dörfer sind wie Natur-
erzeugnisse aus der Landschaft erwachsen, unsere
moderne Dorfbaukunst muß von ihnen wieder
das „Wachsen'' lernen.
Diese schöne Natürlichkeit resultiert nicht
zuletzt aus der Bodenwüchsigkeit der Baumateri-
alien und der daraus sich ergebenden Bautech-
niken. Im Bereich des Hochwaldes, im Schwarz-
wald, im Allgäu, im Bayrischen und Böhmerwald
ist der hochgewachsene Tannenstamm das ge-
gebene Material, der Block- oder Schrotbau die
gegebene Technik; im Mittelbergland, wo der
Wald spärlicher zur Verfügung steht, findet der
Fachwerkbau der norddeutschen Ebene Eingang;
in der steinigen Oberpfalz, in Mittelfranken ent-
steht ein schlichtes Steinhaus und die Kalkberge
des Fränkischen Jura spenden sowohl das Material
zum Aufbau wie auch die dünnen, unregelmäßigen
Platten zur Eindeckuno; des Daches. Aus seinem
Landbau gewinnt der Bauer das Stroh für das
hohe Wetterschutzdach, aus dem Wald die Wand-
schindeln und dicken Legschindeln für das bay-
rische Hausdach. Der Frankenwald und das
Rheinische Schiefergebirge liefern die hübschen
blauschwarzen Platten zur Verschalung der Wetter-
seite des Fachwerkbaus und auch für das Dach.
Dem Lehmboden der Rhein-Main-Ebene ent-
stammen die kleinen Ziegel, mit denen in der
Wetterau die Gefache des Riegelbaus in geome-
trischen Mustern nach niederdeutscher Art aus-
gefüllt werden. — So ist der Hausbau mit dem
heimischen Boden verwachsen, und ein bayrisches
Haus z. B. wäre uns im Schwarzwald, ein Schwarz-
waldhaus in Bayern undenkbar. Desgleichen
zwingt zur Anpassung das Klima einer Land-
schaft: ein bayrischer oder Schwarzwälder Ein-
751