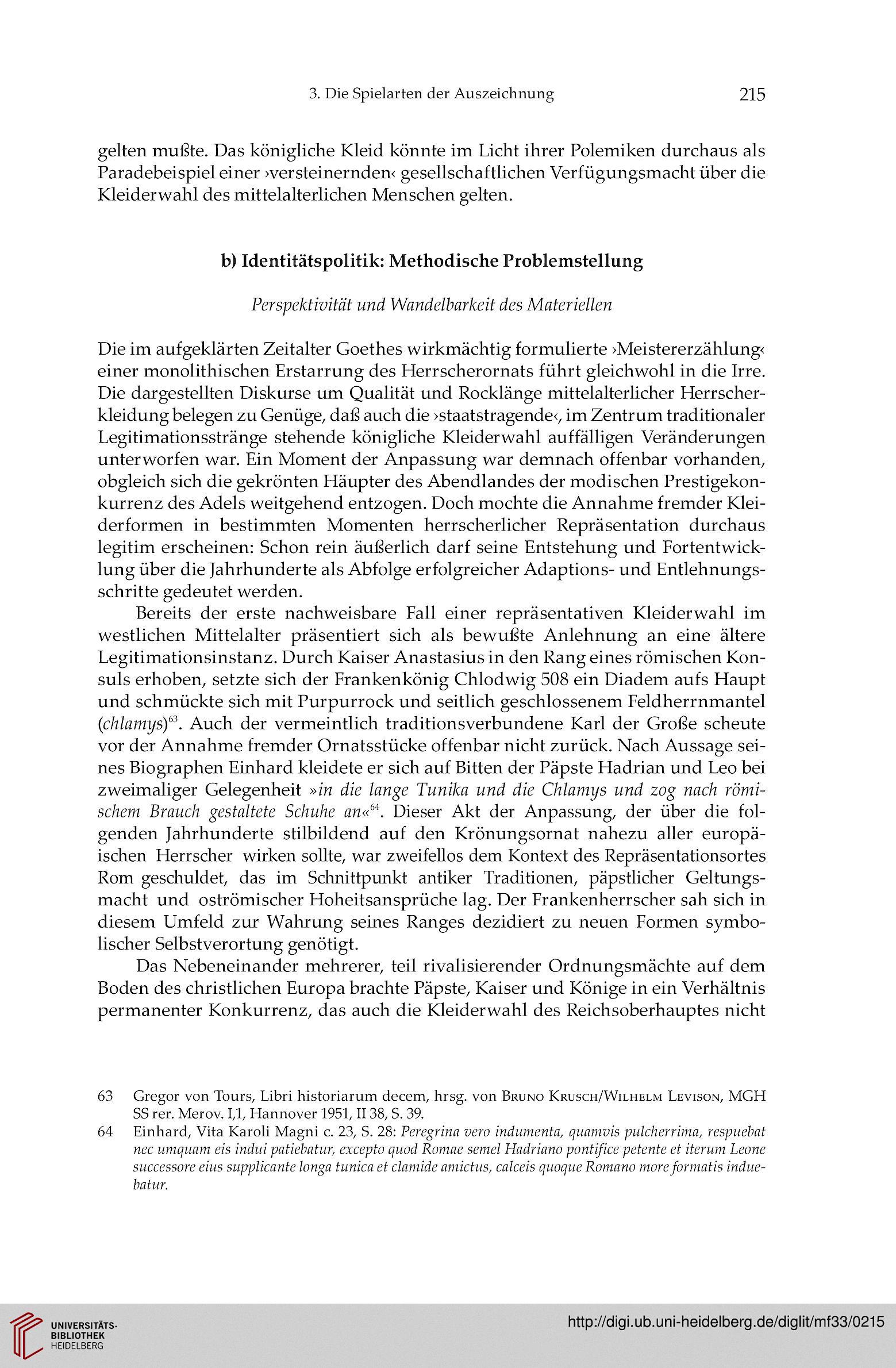3. Die Spielarten der Auszeichnung
215
gelten mußte. Das königliche Kleid könnte im Licht ihrer Polemiken durchaus als
Paradebeispiel einer >versteinernden< gesellschaftlichen Verfügungsmacht über die
Kleiderwahl des mittelalterlichen Menschen gelten.
b) Identitätspolitik: Methodische Problemstellung
Perspektivität und Wandelbarkeit des Materiellen
Die im aufgeklärten Zeitalter Goethes wirkmächtig formulierte >Meistererzählung<
einer monolithischen Erstarrung des Herrscherornats führt gleichwohl in die Irre.
Die dargestellten Diskurse um Qualität und Rocklänge mittelalterlicher Herrscher-
kleidung belegen zu Genüge, daß auch die >staatstragende<, im Zentrum traditionaler
Legitimationsstränge stehende königliche Kleiderwahl auffälligen Veränderungen
unterworfen war. Ein Moment der Anpassung war demnach offenbar vorhanden,
obgleich sich die gekrönten Häupter des Abendlandes der modischen Prestigekon-
kurrenz des Adels weitgehend entzogen. Doch mochte die Annahme fremder Klei-
derformen in bestimmten Momenten herrscherlicher Repräsentation durchaus
legitim erscheinen: Schon rein äußerlich darf seine Entstehung und Fortentwick-
lung über die Jahrhunderte als Abfolge erfolgreicher Adaptions- und Entlehnungs-
schritte gedeutet werden.
Bereits der erste nachweisbare Fall einer repräsentativen Kleiderwahl im
westlichen Mittelalter präsentiert sich als bewußte Anlehnung an eine ältere
Legitimationsinstanz. Durch Kaiser Anastasius in den Rang eines römischen Kon-
suls erhoben, setzte sich der Frankenkönig Chlodwig 508 ein Diadem aufs Haupt
und schmückte sich mit Purpurrock und seitlich geschlossenem Feldherrnmantel
(chlamys)63. Auch der vermeintlich traditionsverbundene Karl der Große scheute
vor der Annahme fremder Ornatsstücke offenbar nicht zurück. Nach Aussage sei-
nes Biographen Einhard kleidete er sich auf Bitten der Päpste Hadrian und Leo bei
zweimaliger Gelegenheit »in die lange Tunika und die Chlamys und zog nach römi-
schem Brauch gestaltete Schuhe an«6\ Dieser Akt der Anpassung, der über die fol-
genden Jahrhunderte stilbildend auf den Krönungsornat nahezu aller europä-
ischen Herrscher wirken sollte, war zweifellos dem Kontext des Repräsentationsortes
Rom geschuldet, das im Schnittpunkt antiker Traditionen, päpstlicher Geltungs-
macht und oströmischer Hoheitsansprüche lag. Der Frankenherrscher sah sich in
diesem Umfeld zur Wahrung seines Ranges dezidiert zu neuen Formen symbo-
lischer Selbstverortung genötigt.
Das Nebeneinander mehrerer, teil rivalisierender Ordnungsmächte auf dem
Boden des christlichen Europa brachte Päpste, Kaiser und Könige in ein Verhältnis
permanenter Konkurrenz, das auch die Kleiderwahl des Reichsoberhauptes nicht
63 Gregor von Tours, Libri historiarum decem, hrsg. von Bruno Krusch/Wilhelm Levison, MGH
SS rer. Merov. 1,1, Hannover 1951, II38, S. 39.
64 Einhard, Vita Karoli Magni c. 23, S. 28: Peregrina vero indumenta, quamvis pulcherrima, respuebat
nec umquam eis indui patiebatur, excepto quod Romae semel Hadriano pontifice petente et iterum Leone
successore eius supplicante longa tunica et clamide amictus, calceis quoque Romano more formatis indue-
batur.
215
gelten mußte. Das königliche Kleid könnte im Licht ihrer Polemiken durchaus als
Paradebeispiel einer >versteinernden< gesellschaftlichen Verfügungsmacht über die
Kleiderwahl des mittelalterlichen Menschen gelten.
b) Identitätspolitik: Methodische Problemstellung
Perspektivität und Wandelbarkeit des Materiellen
Die im aufgeklärten Zeitalter Goethes wirkmächtig formulierte >Meistererzählung<
einer monolithischen Erstarrung des Herrscherornats führt gleichwohl in die Irre.
Die dargestellten Diskurse um Qualität und Rocklänge mittelalterlicher Herrscher-
kleidung belegen zu Genüge, daß auch die >staatstragende<, im Zentrum traditionaler
Legitimationsstränge stehende königliche Kleiderwahl auffälligen Veränderungen
unterworfen war. Ein Moment der Anpassung war demnach offenbar vorhanden,
obgleich sich die gekrönten Häupter des Abendlandes der modischen Prestigekon-
kurrenz des Adels weitgehend entzogen. Doch mochte die Annahme fremder Klei-
derformen in bestimmten Momenten herrscherlicher Repräsentation durchaus
legitim erscheinen: Schon rein äußerlich darf seine Entstehung und Fortentwick-
lung über die Jahrhunderte als Abfolge erfolgreicher Adaptions- und Entlehnungs-
schritte gedeutet werden.
Bereits der erste nachweisbare Fall einer repräsentativen Kleiderwahl im
westlichen Mittelalter präsentiert sich als bewußte Anlehnung an eine ältere
Legitimationsinstanz. Durch Kaiser Anastasius in den Rang eines römischen Kon-
suls erhoben, setzte sich der Frankenkönig Chlodwig 508 ein Diadem aufs Haupt
und schmückte sich mit Purpurrock und seitlich geschlossenem Feldherrnmantel
(chlamys)63. Auch der vermeintlich traditionsverbundene Karl der Große scheute
vor der Annahme fremder Ornatsstücke offenbar nicht zurück. Nach Aussage sei-
nes Biographen Einhard kleidete er sich auf Bitten der Päpste Hadrian und Leo bei
zweimaliger Gelegenheit »in die lange Tunika und die Chlamys und zog nach römi-
schem Brauch gestaltete Schuhe an«6\ Dieser Akt der Anpassung, der über die fol-
genden Jahrhunderte stilbildend auf den Krönungsornat nahezu aller europä-
ischen Herrscher wirken sollte, war zweifellos dem Kontext des Repräsentationsortes
Rom geschuldet, das im Schnittpunkt antiker Traditionen, päpstlicher Geltungs-
macht und oströmischer Hoheitsansprüche lag. Der Frankenherrscher sah sich in
diesem Umfeld zur Wahrung seines Ranges dezidiert zu neuen Formen symbo-
lischer Selbstverortung genötigt.
Das Nebeneinander mehrerer, teil rivalisierender Ordnungsmächte auf dem
Boden des christlichen Europa brachte Päpste, Kaiser und Könige in ein Verhältnis
permanenter Konkurrenz, das auch die Kleiderwahl des Reichsoberhauptes nicht
63 Gregor von Tours, Libri historiarum decem, hrsg. von Bruno Krusch/Wilhelm Levison, MGH
SS rer. Merov. 1,1, Hannover 1951, II38, S. 39.
64 Einhard, Vita Karoli Magni c. 23, S. 28: Peregrina vero indumenta, quamvis pulcherrima, respuebat
nec umquam eis indui patiebatur, excepto quod Romae semel Hadriano pontifice petente et iterum Leone
successore eius supplicante longa tunica et clamide amictus, calceis quoque Romano more formatis indue-
batur.