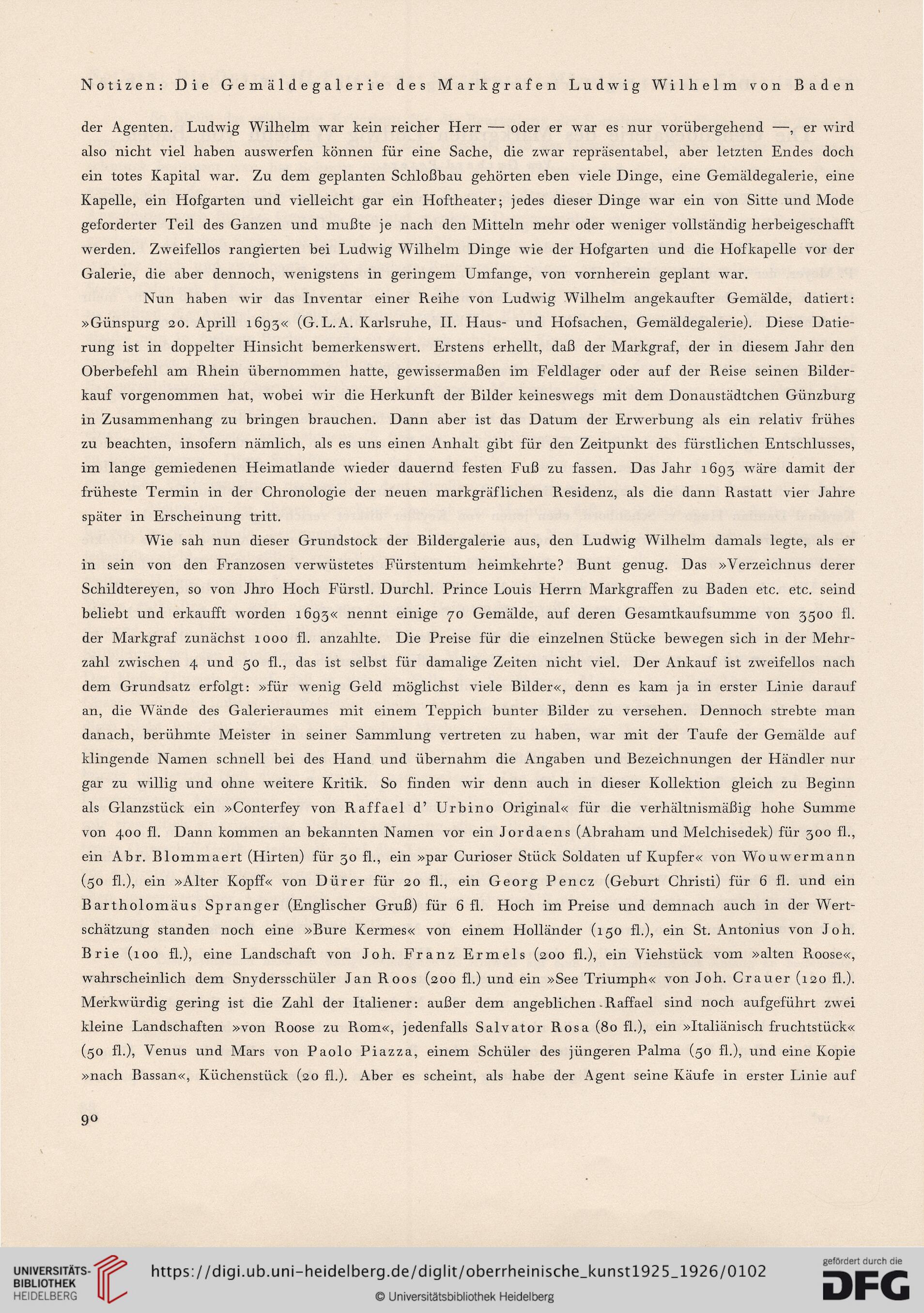Notizen: Die Gemäldegalerie des Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden
der Agenten. Ludwig Wilhelm war kein reicher Herr — oder er war es nur vorübergehend —, er wird
also nicht viel haben auswerfen können für eine Sache, die zwar repräsentabel, aber letzten Endes doch
ein totes Kapital war. Zu dem geplanten Schloßbau gehörten eben viele Dinge, eine Gemäldegalerie, eine
Kapelle, ein Hofgarten und vielleicht gar ein Hoftheater; jedes dieser Dinge war ein von Sitte und Mode
geforderter Teil des Ganzen und mußte je nach den Mitteln mehr oder weniger vollständig herbeigeschafft
werden. Zweifellos rangierten bei Ludwig Wilhelm Dinge wie der Hofgarten und die Hofkapelle vor der
Galerie, die aber dennoch, wenigstens in geringem Umfange, von vornherein geplant war.
Nun haben wir das Inventar einer Reihe von Ludwig Wilhelm angekaufter Gemälde, datiert:
»Günspurg 20. Aprill 1693« (G. L.A. Karlsruhe, II. Haus- und Hofsachen, Gemäldegalerie). Diese Datie-
rung ist in doppelter Hinsicht bemerkenswert. Erstens erhellt, daß der Markgraf, der in diesem Jahr den
Oberbefehl am Rhein übernommen hatte, gewissermaßen im Feldlager oder auf der Reise seinen Bilder-
kauf vorgenommen hat, wobei wir die Herkunft der Bilder keineswegs mit dem Donaustädtchen Günzburg
in Zusammenhang zu bringen brauchen. Dann aber ist das Datum der Erwerbung als ein relativ frühes
zu beachten, insofern nämlich, als es uns einen Anhalt gibt für den Zeitpunkt des fürstlichen Entschlusses,
im lange gemiedenen Heimatlande wieder dauernd festen Fuß zu fassen. Das Jahr 1693 wäre damit der
früheste Termin in der Chronologie der neuen markgräflichen Residenz, als die dann Rastatt vier Jahre
später in Erscheinung tritt.
Wie sah nun dieser Grundstock der Bildergalerie aus, den Ludwig Wilhelm damals legte, als er
in sein von den Franzosen verwüstetes Fürstentum heimkehrte? Bunt genug. Das »Verzeichnus derer
Schildtereyen, so von Jhro Hoch Fürstl. Durchl. Prince Louis Herrn Markgraffen zu Baden etc. etc. seind
beliebt und erkaufft worden 1693« nennt einige 70 Gemälde, auf deren Gesamtkaufsumme von 3500 fl.
der Markgraf zunächst 1000 fl. anzahlte. Die Preise für die einzelnen Stücke bewegen sich in der Mehr-
zahl zwischen 4 und 50 fl., das ist selbst für damalige Zeiten nicht viel. Der Ankauf ist zweifellos nach
dem Grundsatz erfolgt: »für wenig Geld möglichst viele Bilder«, denn es kam ja in erster Linie darauf
an, die Wände des Galerieraumes mit einem Teppich bunter Bilder zu versehen. Dennoch strebte man
danach, berühmte Meister in seiner Sammlung vertreten zu haben, war mit der Taufe der Gemälde auf
klingende Namen schnell bei des Hand und übernahm die Angaben und Bezeichnungen der Händler nur
gar zu willig und ohne weitere Kritik. So finden wir denn auch in dieser Kollektion gleich zu Beginn
als Glanzstück ein »Conterfey von Raffael d’ Urbino Original« für die verhältnismäßig hohe Summe
von 400 fl. Dann kommen an bekannten Namen vor ein Jordaens (Abraham und Melchisedek) für 300 fl.,
ein Abr. Blommaert (Hirten) für 30 fl., ein »par Curioser Stück Soldaten uf Kupfer« von Wouwermann
(50 fl.), ein »Alter Kopff« von Dürer für 20 fl., ein Georg Pencz (Geburt Christi) für 6 fl. und ein
Bartholomäus Spranger (Englischer Gruß) für 6 fl. Hoch im Preise und demnach auch in der Wert-
schätzung standen noch eine »Bure Kermes« von einem Holländer (150 fl.), ein St. Antonius von Joh.
Brie (100 fl.), eine Landschaft von Joh. Franz Ermels (200 fl.), ein Viehstück vom »alten Roose«,
wahrscheinlich dem Snydersschüler Jan Roos (200 fl.) und ein »See Triumph« von Joh. Crauer (120 fl.).
Merkwürdig gering ist die Zahl der Italiener: außer dem angeblichen.Raffael sind noch aufgeführt zwei
kleine Landschaften »von Roose zu Rom«, jedenfalls Salvator Rosa (80 fl.), ein »Italiänisch fruchtstück«
(50 fl.), Venus und Mars von Paolo Piazza, einem Schüler des jüngeren Palma (50 fl.), und eine Kopie
»nach Bassan«, Küchenstück (20 fl.). Aber es scheint, als habe der Agent seine Käufe in erster Linie auf
9°
der Agenten. Ludwig Wilhelm war kein reicher Herr — oder er war es nur vorübergehend —, er wird
also nicht viel haben auswerfen können für eine Sache, die zwar repräsentabel, aber letzten Endes doch
ein totes Kapital war. Zu dem geplanten Schloßbau gehörten eben viele Dinge, eine Gemäldegalerie, eine
Kapelle, ein Hofgarten und vielleicht gar ein Hoftheater; jedes dieser Dinge war ein von Sitte und Mode
geforderter Teil des Ganzen und mußte je nach den Mitteln mehr oder weniger vollständig herbeigeschafft
werden. Zweifellos rangierten bei Ludwig Wilhelm Dinge wie der Hofgarten und die Hofkapelle vor der
Galerie, die aber dennoch, wenigstens in geringem Umfange, von vornherein geplant war.
Nun haben wir das Inventar einer Reihe von Ludwig Wilhelm angekaufter Gemälde, datiert:
»Günspurg 20. Aprill 1693« (G. L.A. Karlsruhe, II. Haus- und Hofsachen, Gemäldegalerie). Diese Datie-
rung ist in doppelter Hinsicht bemerkenswert. Erstens erhellt, daß der Markgraf, der in diesem Jahr den
Oberbefehl am Rhein übernommen hatte, gewissermaßen im Feldlager oder auf der Reise seinen Bilder-
kauf vorgenommen hat, wobei wir die Herkunft der Bilder keineswegs mit dem Donaustädtchen Günzburg
in Zusammenhang zu bringen brauchen. Dann aber ist das Datum der Erwerbung als ein relativ frühes
zu beachten, insofern nämlich, als es uns einen Anhalt gibt für den Zeitpunkt des fürstlichen Entschlusses,
im lange gemiedenen Heimatlande wieder dauernd festen Fuß zu fassen. Das Jahr 1693 wäre damit der
früheste Termin in der Chronologie der neuen markgräflichen Residenz, als die dann Rastatt vier Jahre
später in Erscheinung tritt.
Wie sah nun dieser Grundstock der Bildergalerie aus, den Ludwig Wilhelm damals legte, als er
in sein von den Franzosen verwüstetes Fürstentum heimkehrte? Bunt genug. Das »Verzeichnus derer
Schildtereyen, so von Jhro Hoch Fürstl. Durchl. Prince Louis Herrn Markgraffen zu Baden etc. etc. seind
beliebt und erkaufft worden 1693« nennt einige 70 Gemälde, auf deren Gesamtkaufsumme von 3500 fl.
der Markgraf zunächst 1000 fl. anzahlte. Die Preise für die einzelnen Stücke bewegen sich in der Mehr-
zahl zwischen 4 und 50 fl., das ist selbst für damalige Zeiten nicht viel. Der Ankauf ist zweifellos nach
dem Grundsatz erfolgt: »für wenig Geld möglichst viele Bilder«, denn es kam ja in erster Linie darauf
an, die Wände des Galerieraumes mit einem Teppich bunter Bilder zu versehen. Dennoch strebte man
danach, berühmte Meister in seiner Sammlung vertreten zu haben, war mit der Taufe der Gemälde auf
klingende Namen schnell bei des Hand und übernahm die Angaben und Bezeichnungen der Händler nur
gar zu willig und ohne weitere Kritik. So finden wir denn auch in dieser Kollektion gleich zu Beginn
als Glanzstück ein »Conterfey von Raffael d’ Urbino Original« für die verhältnismäßig hohe Summe
von 400 fl. Dann kommen an bekannten Namen vor ein Jordaens (Abraham und Melchisedek) für 300 fl.,
ein Abr. Blommaert (Hirten) für 30 fl., ein »par Curioser Stück Soldaten uf Kupfer« von Wouwermann
(50 fl.), ein »Alter Kopff« von Dürer für 20 fl., ein Georg Pencz (Geburt Christi) für 6 fl. und ein
Bartholomäus Spranger (Englischer Gruß) für 6 fl. Hoch im Preise und demnach auch in der Wert-
schätzung standen noch eine »Bure Kermes« von einem Holländer (150 fl.), ein St. Antonius von Joh.
Brie (100 fl.), eine Landschaft von Joh. Franz Ermels (200 fl.), ein Viehstück vom »alten Roose«,
wahrscheinlich dem Snydersschüler Jan Roos (200 fl.) und ein »See Triumph« von Joh. Crauer (120 fl.).
Merkwürdig gering ist die Zahl der Italiener: außer dem angeblichen.Raffael sind noch aufgeführt zwei
kleine Landschaften »von Roose zu Rom«, jedenfalls Salvator Rosa (80 fl.), ein »Italiänisch fruchtstück«
(50 fl.), Venus und Mars von Paolo Piazza, einem Schüler des jüngeren Palma (50 fl.), und eine Kopie
»nach Bassan«, Küchenstück (20 fl.). Aber es scheint, als habe der Agent seine Käufe in erster Linie auf
9°