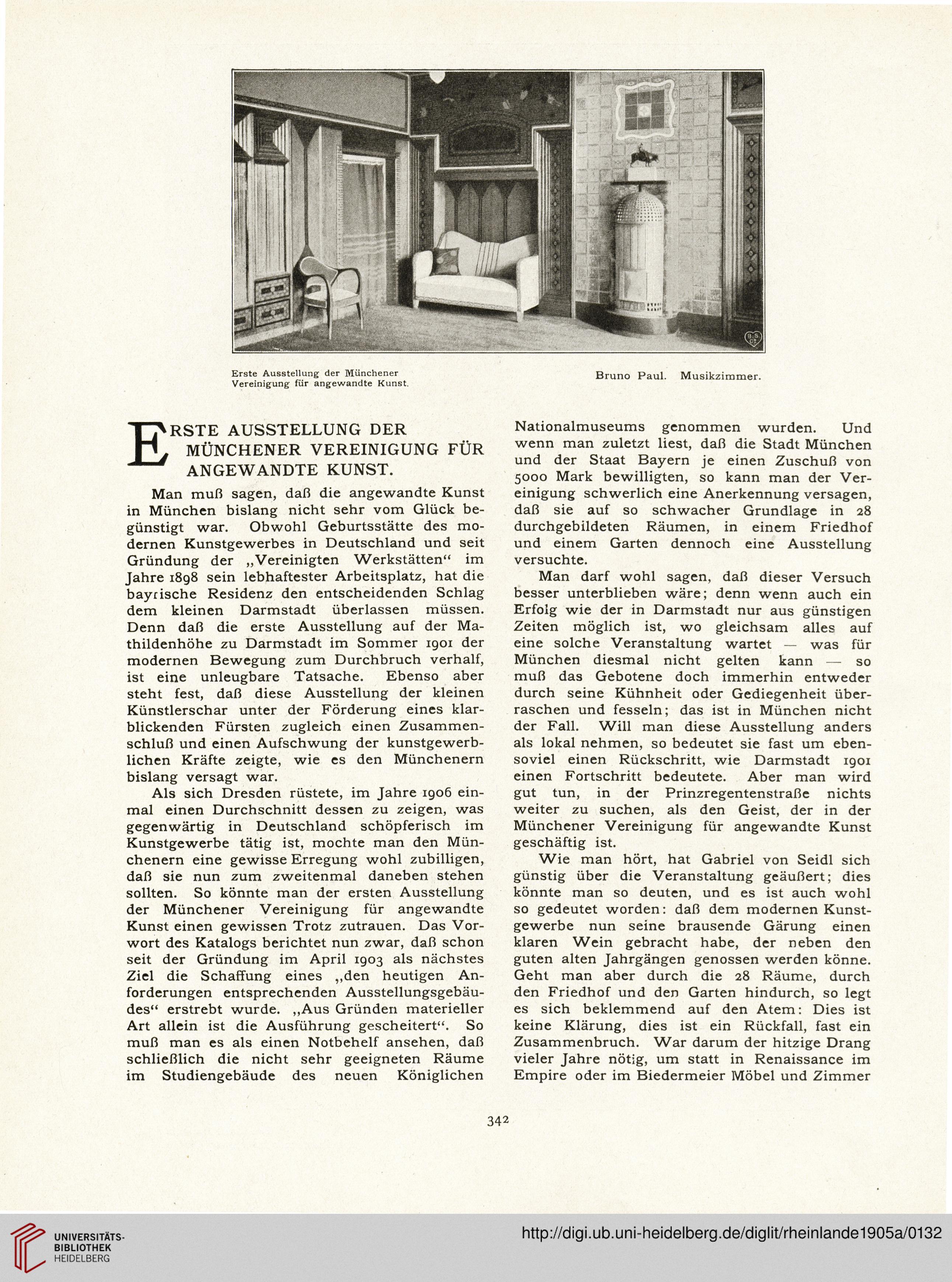Erste Ausstellung der Münchener Bruno Paul. Musikzimmer.
Vereinigung für angewandte Kunst.
RSTE AUSSTELLUNG DER
MÜNCHENER VEREINIGUNG FÜR
ANGEWANDTE KUNST.
Man muß sagen, daß die angewandte Kunst
in München bislang nicht sehr vom Glück be-
günstigt war. Obwohl Geburtsstätte des mo-
dernen Kunstgewerbes in Deutschland und seit
Gründung der „Vereinigten Werkstätten“ im
Jahre 1898 sein lebhaftester Arbeitsplatz, hat die
baycische Residenz den entscheidenden Schlag
dem kleinen Darmstadt überlassen müssen.
Denn daß die erste Ausstellung auf der Ma-
thildenhöhe zu Darmstadt im Sommer 1901 der
modernen Bewegung zum Durchbruch verhalf,
ist eine unleugbare Tatsache. Ebenso aber
steht fest, daß diese Ausstellung der kleinen
Künstlerschar unter der Förderung eines klar-
blickenden Fürsten zugleich einen Zusammen-
schluß und einen Aufschwung der kunstgewerb-
lichen Kräfte zeigte, wie es den Münchenern
bislang versagt war.
Als sich Dresden rüstete, im Jahre 1906 ein-
mal einen Durchschnitt dessen zu zeigen, was
gegenwärtig in Deutschland schöpferisch im
Kunstgewerbe tätig ist, mochte man den Mün-
chenern eine gewisse Erregung wohl zubilligen,
daß sie nun zum zweitenmal daneben stehen
sollten. So könnte man der ersten Ausstellung
der Münchener Vereinigung für angewandte
Kunst einen gewissen Trotz zutrauen. Das Vor-
wort des Katalogs berichtet nun zwar, daß schon
seit der Gründung im April 1903 als nächstes
Ziel die Schaffung eines ,,den heutigen An-
forderungen entsprechenden Ausstellungsgebäu-
des“ erstrebt wurde. „Aus Gründen materieller
Art allein ist die Ausführung gescheitert“. So
muß man es als einen Notbehelf ansehen, daß
schließlich die nicht sehr geeigneten Räume
im Studiengebäude des neuen Königlichen
Nationalmuseums genommen wurden. Und
wenn man zuletzt liest, daß die Stadt München
und der Staat Bayern je einen Zuschuß von
5000 Mark bewilligten, so kann man der Ver-
einigung schwerlich eine Anerkennung versagen,
daß sie auf so schwacher Grundlage in 28
durchgebildeten Räumen, in einem Friedhof
und einem Garten dennoch eine Ausstellung
versuchte.
Man darf wohl sagen, daß dieser Versuch
besser unterblieben wäre; denn wenn auch ein
Erfolg wie der in Darmstadt nur aus günstigen
Zeiten möglich ist, wo gleichsam alles auf
eine solche Veranstaltung wartet — was für
München diesmal nicht gelten kann — so
muß das Gebotene doch immerhin entweder
durch seine Kühnheit oder Gediegenheit über-
raschen und fesseln; das ist in München nicht
der Fall. Will man diese Ausstellung anders
als lokal nehmen, so bedeutet sie fast um eben-
soviel einen Rückschritt, wie Darmstadt 1901
einen Fortschritt bedeutete. Aber man wird
gut tun, in der Prinzregentenstraße nichts
weiter zu suchen, als den Geist, der in der
Münchener Vereinigung für angewandte Kunst
geschäftig ist.
Wie man hört, hat Gabriel von Seidl sich
günstig über die Veranstaltung geäußert; dies
könnte man so deuten, und es ist auch wohl
so gedeutet worden: daß dem modernen Kunst-
gewerbe nun seine brausende Gärung einen
klaren Wein gebracht habe, der neben den
guten alten Jahrgängen genossen werden könne.
Geht man aber durch die 28 Räume, durch
den Friedhof und den Garten hindurch, so legt
es sich beklemmend auf den Atem: Dies ist
keine Klärung, dies ist ein Rückfall, fast ein
Zusammenbruch. War darum der hitzige Drang
vieler Jahre nötig, um statt in Renaissance im
Empire oder im Biedermeier Möbel und Zimmer
342
Vereinigung für angewandte Kunst.
RSTE AUSSTELLUNG DER
MÜNCHENER VEREINIGUNG FÜR
ANGEWANDTE KUNST.
Man muß sagen, daß die angewandte Kunst
in München bislang nicht sehr vom Glück be-
günstigt war. Obwohl Geburtsstätte des mo-
dernen Kunstgewerbes in Deutschland und seit
Gründung der „Vereinigten Werkstätten“ im
Jahre 1898 sein lebhaftester Arbeitsplatz, hat die
baycische Residenz den entscheidenden Schlag
dem kleinen Darmstadt überlassen müssen.
Denn daß die erste Ausstellung auf der Ma-
thildenhöhe zu Darmstadt im Sommer 1901 der
modernen Bewegung zum Durchbruch verhalf,
ist eine unleugbare Tatsache. Ebenso aber
steht fest, daß diese Ausstellung der kleinen
Künstlerschar unter der Förderung eines klar-
blickenden Fürsten zugleich einen Zusammen-
schluß und einen Aufschwung der kunstgewerb-
lichen Kräfte zeigte, wie es den Münchenern
bislang versagt war.
Als sich Dresden rüstete, im Jahre 1906 ein-
mal einen Durchschnitt dessen zu zeigen, was
gegenwärtig in Deutschland schöpferisch im
Kunstgewerbe tätig ist, mochte man den Mün-
chenern eine gewisse Erregung wohl zubilligen,
daß sie nun zum zweitenmal daneben stehen
sollten. So könnte man der ersten Ausstellung
der Münchener Vereinigung für angewandte
Kunst einen gewissen Trotz zutrauen. Das Vor-
wort des Katalogs berichtet nun zwar, daß schon
seit der Gründung im April 1903 als nächstes
Ziel die Schaffung eines ,,den heutigen An-
forderungen entsprechenden Ausstellungsgebäu-
des“ erstrebt wurde. „Aus Gründen materieller
Art allein ist die Ausführung gescheitert“. So
muß man es als einen Notbehelf ansehen, daß
schließlich die nicht sehr geeigneten Räume
im Studiengebäude des neuen Königlichen
Nationalmuseums genommen wurden. Und
wenn man zuletzt liest, daß die Stadt München
und der Staat Bayern je einen Zuschuß von
5000 Mark bewilligten, so kann man der Ver-
einigung schwerlich eine Anerkennung versagen,
daß sie auf so schwacher Grundlage in 28
durchgebildeten Räumen, in einem Friedhof
und einem Garten dennoch eine Ausstellung
versuchte.
Man darf wohl sagen, daß dieser Versuch
besser unterblieben wäre; denn wenn auch ein
Erfolg wie der in Darmstadt nur aus günstigen
Zeiten möglich ist, wo gleichsam alles auf
eine solche Veranstaltung wartet — was für
München diesmal nicht gelten kann — so
muß das Gebotene doch immerhin entweder
durch seine Kühnheit oder Gediegenheit über-
raschen und fesseln; das ist in München nicht
der Fall. Will man diese Ausstellung anders
als lokal nehmen, so bedeutet sie fast um eben-
soviel einen Rückschritt, wie Darmstadt 1901
einen Fortschritt bedeutete. Aber man wird
gut tun, in der Prinzregentenstraße nichts
weiter zu suchen, als den Geist, der in der
Münchener Vereinigung für angewandte Kunst
geschäftig ist.
Wie man hört, hat Gabriel von Seidl sich
günstig über die Veranstaltung geäußert; dies
könnte man so deuten, und es ist auch wohl
so gedeutet worden: daß dem modernen Kunst-
gewerbe nun seine brausende Gärung einen
klaren Wein gebracht habe, der neben den
guten alten Jahrgängen genossen werden könne.
Geht man aber durch die 28 Räume, durch
den Friedhof und den Garten hindurch, so legt
es sich beklemmend auf den Atem: Dies ist
keine Klärung, dies ist ein Rückfall, fast ein
Zusammenbruch. War darum der hitzige Drang
vieler Jahre nötig, um statt in Renaissance im
Empire oder im Biedermeier Möbel und Zimmer
342