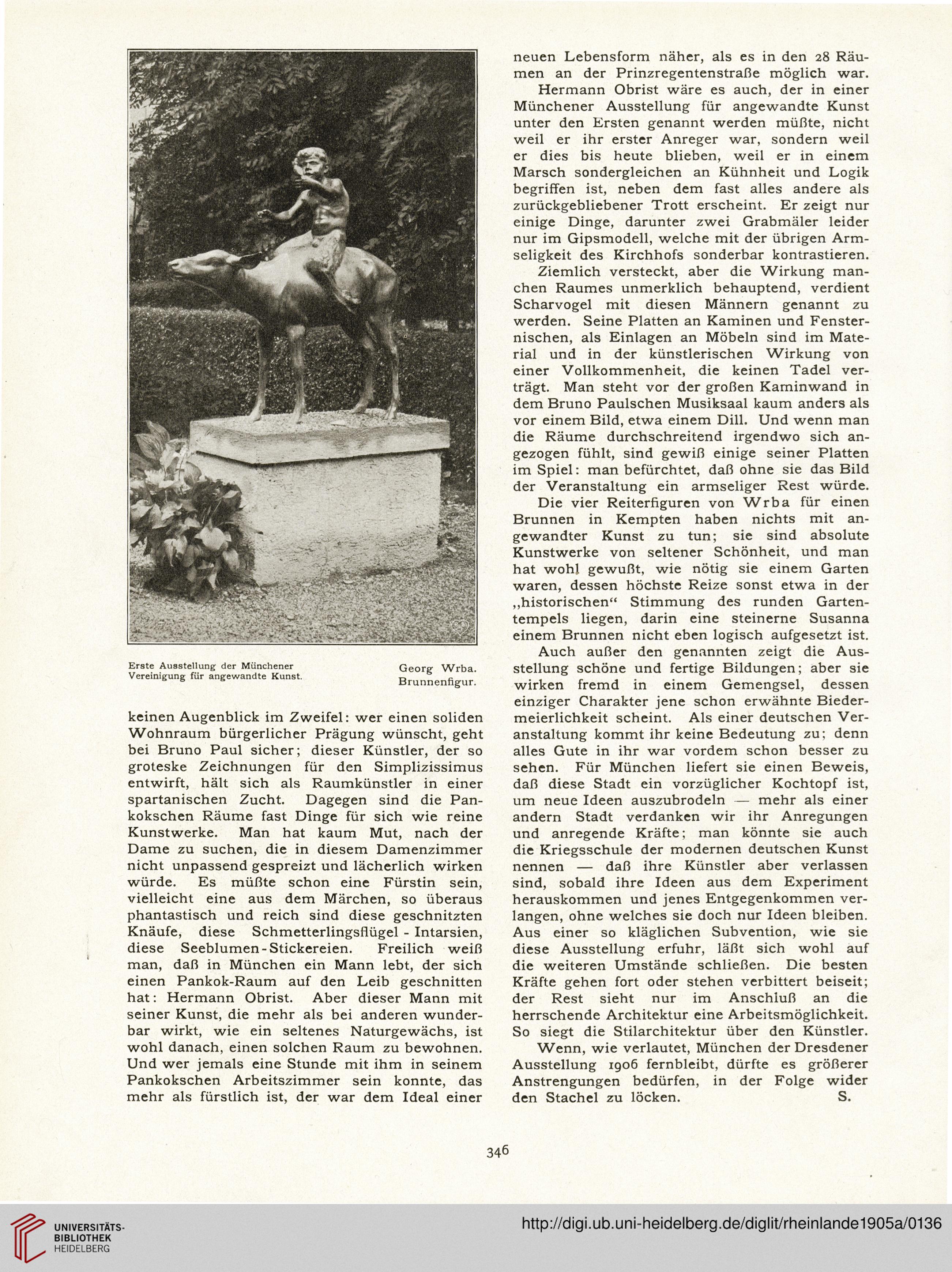Erste Ausstellung der Münchener Georg 1 Wrba.
Vereinigung für angewandte Kunst. R c
keinen Augenblick im Zweifel: wer einen soliden
Wohnraum bürgerlicher Prägung wünscht, geht
bei Bruno Paul sicher; dieser Künstler, der so
groteske Zeichnungen für den Simplizissimus
entwirft, hält sich als Raumkünstler in einer
spartanischen Zucht. Dagegen sind die Pan-
kokschen Räume fast Dinge für sich wie reine
Kunstwerke. Man hat kaum Mut, nach der
Dame zu suchen, die in diesem Damenzimmer
nicht unpassend gespreizt und lächerlich wirken
würde. Es müßte schon eine Fürstin sein,
vielleicht eine aus dem Märchen, so überaus
phantastisch und reich sind diese geschnitzten
Knäufe, diese Schmetterlingsflügel - Intarsien,
diese Seeblumen-Stickereien. Freilich weiß
man, daß in München ein Mann lebt, der sich
einen Pankok-Raum auf den Leib geschnitten
hat: Hermann Obrist. Aber dieser Mann mit
seiner Kunst, die mehr als bei anderen wunder-
bar wirkt, wie ein seltenes Naturgewächs, ist
wohl danach, einen solchen Raum zu bewohnen.
Und wer jemals eine Stunde mit ihm in seinem
Pankokschen Arbeitszimmer sein konnte, das
mehr als fürstlich ist, der war dem Ideal einer
neuen Lebensform nähcr, als es in den 28 Räu-
men an der Prinzregentenstraße möglich war.
Hermann Obrist wäre es auch, der in einer
Münchener Ausstellung für angewandte Kunst
unter den Ersten genannt werden müßte, nicht
weil er ihr erster Anreger war, sondern weil
er dies bis heute blieben, weil er in einem
Marsch sondergleichen an Kühnheit und Logik
begriffen ist, neben dem fast alles andere als
zurückgebliebener Trott erscheint. Er zeigt nur
einige Dinge, darunter zwei Grabmäler leider
nur im Gipsmodell, welche mit der übrigen Arm-
seligkeit des Kirchhofs sonderbar kontrastieren.
Ziemlich versteckt, aber die Wirkung man-
chen Raumes unmerklich behauptend, verdient
Scharvogel mit diesen Männern genannt zu
werden. Seine Platten an Kaminen und Fenster-
nischen, als Einlagen an Möbeln sind im Mate-
rial und in der künstlerischen Wirkung von
einer Vollkommenheit, die keinen Tadel ver-
trägt. Man steht vor der großen Kaminwand in
dem Bruno Paulschen Musiksaal kaum anders als
vor einem Bild, etwa einem Dill. Und wenn man
die Räume durchschreitend irgendwo sich an-
gezogen fühlt, sind gewiß einige seiner Platten
im Spiel: man befürchtet, daß ohne sie das Bild
der Veranstaltung ein armseliger Rest würde.
Die vier Reiterfiguren von Wrba für einen
Brunnen in Kempten haben nichts mit an-
gewandter Kunst zu tun; sie sind absolute
Kunstwerke von seltener Schönheit, und man
hat wohl gewußt, wie nötig sie einem Garten
waren, dessen höchste Reize sonst etwa in der
,,historischen“ Stimmung des runden Garten-
tempels liegen, darin eine steinerne Susanna
einem Brunnen nicht eben logisch aufgesetzt ist.
Auch außer den genannten zeigt die Aus-
stellung schöne und fertige Bildungen; aber sie
wirken fremd in einem Gemengsel, dessen
einziger Charakter jene schon erwähnte Bieder-
meierlichkeit scheint. Als einer deutschen Ver-
anstaltung kommt ihr keine Bedeutung zu; denn
alles Gute in ihr war vordem schon besser zu
sehen. Für München liefert sie einen Beweis,
daß diese Stadt ein vorzüglicher Kochtopf ist,
um neue Ideen auszubrodeln — mehr als einer
andern Stadt verdanken wir ihr Anregungen
und anregende Kräfte; man könnte sie auch
die Kriegsschule der modernen deutschen Kunst
nennen — daß ihre Künstler aber verlassen
sind, sobald ihre Ideen aus dem Experiment
herauskommen und jenes Entgegenkommen ver-
langen, ohne welches sie doch nur Ideen bleiben.
Aus einer so kläglichen Subvention, wie sie
diese Ausstellung erfuhr, läßt sich wohl auf
die weiteren Umstände schließen. Die besten
Kräfte gehen fort oder stehen verbittert beiseit;
der Rest sieht nur im Anschiuß an die
herrschende Architektur eine Arbeitsmöglichkeit.
So siegt die Stilarchitektur über den Künstler.
Wenn, wie verlautet, München der Dresdener
Ausstellung 1906 fernbleibt, dürfte es größerer
Anstrengungen bedürfen, in der Folge wider
den Stachel zu löcken. S.
346
Vereinigung für angewandte Kunst. R c
keinen Augenblick im Zweifel: wer einen soliden
Wohnraum bürgerlicher Prägung wünscht, geht
bei Bruno Paul sicher; dieser Künstler, der so
groteske Zeichnungen für den Simplizissimus
entwirft, hält sich als Raumkünstler in einer
spartanischen Zucht. Dagegen sind die Pan-
kokschen Räume fast Dinge für sich wie reine
Kunstwerke. Man hat kaum Mut, nach der
Dame zu suchen, die in diesem Damenzimmer
nicht unpassend gespreizt und lächerlich wirken
würde. Es müßte schon eine Fürstin sein,
vielleicht eine aus dem Märchen, so überaus
phantastisch und reich sind diese geschnitzten
Knäufe, diese Schmetterlingsflügel - Intarsien,
diese Seeblumen-Stickereien. Freilich weiß
man, daß in München ein Mann lebt, der sich
einen Pankok-Raum auf den Leib geschnitten
hat: Hermann Obrist. Aber dieser Mann mit
seiner Kunst, die mehr als bei anderen wunder-
bar wirkt, wie ein seltenes Naturgewächs, ist
wohl danach, einen solchen Raum zu bewohnen.
Und wer jemals eine Stunde mit ihm in seinem
Pankokschen Arbeitszimmer sein konnte, das
mehr als fürstlich ist, der war dem Ideal einer
neuen Lebensform nähcr, als es in den 28 Räu-
men an der Prinzregentenstraße möglich war.
Hermann Obrist wäre es auch, der in einer
Münchener Ausstellung für angewandte Kunst
unter den Ersten genannt werden müßte, nicht
weil er ihr erster Anreger war, sondern weil
er dies bis heute blieben, weil er in einem
Marsch sondergleichen an Kühnheit und Logik
begriffen ist, neben dem fast alles andere als
zurückgebliebener Trott erscheint. Er zeigt nur
einige Dinge, darunter zwei Grabmäler leider
nur im Gipsmodell, welche mit der übrigen Arm-
seligkeit des Kirchhofs sonderbar kontrastieren.
Ziemlich versteckt, aber die Wirkung man-
chen Raumes unmerklich behauptend, verdient
Scharvogel mit diesen Männern genannt zu
werden. Seine Platten an Kaminen und Fenster-
nischen, als Einlagen an Möbeln sind im Mate-
rial und in der künstlerischen Wirkung von
einer Vollkommenheit, die keinen Tadel ver-
trägt. Man steht vor der großen Kaminwand in
dem Bruno Paulschen Musiksaal kaum anders als
vor einem Bild, etwa einem Dill. Und wenn man
die Räume durchschreitend irgendwo sich an-
gezogen fühlt, sind gewiß einige seiner Platten
im Spiel: man befürchtet, daß ohne sie das Bild
der Veranstaltung ein armseliger Rest würde.
Die vier Reiterfiguren von Wrba für einen
Brunnen in Kempten haben nichts mit an-
gewandter Kunst zu tun; sie sind absolute
Kunstwerke von seltener Schönheit, und man
hat wohl gewußt, wie nötig sie einem Garten
waren, dessen höchste Reize sonst etwa in der
,,historischen“ Stimmung des runden Garten-
tempels liegen, darin eine steinerne Susanna
einem Brunnen nicht eben logisch aufgesetzt ist.
Auch außer den genannten zeigt die Aus-
stellung schöne und fertige Bildungen; aber sie
wirken fremd in einem Gemengsel, dessen
einziger Charakter jene schon erwähnte Bieder-
meierlichkeit scheint. Als einer deutschen Ver-
anstaltung kommt ihr keine Bedeutung zu; denn
alles Gute in ihr war vordem schon besser zu
sehen. Für München liefert sie einen Beweis,
daß diese Stadt ein vorzüglicher Kochtopf ist,
um neue Ideen auszubrodeln — mehr als einer
andern Stadt verdanken wir ihr Anregungen
und anregende Kräfte; man könnte sie auch
die Kriegsschule der modernen deutschen Kunst
nennen — daß ihre Künstler aber verlassen
sind, sobald ihre Ideen aus dem Experiment
herauskommen und jenes Entgegenkommen ver-
langen, ohne welches sie doch nur Ideen bleiben.
Aus einer so kläglichen Subvention, wie sie
diese Ausstellung erfuhr, läßt sich wohl auf
die weiteren Umstände schließen. Die besten
Kräfte gehen fort oder stehen verbittert beiseit;
der Rest sieht nur im Anschiuß an die
herrschende Architektur eine Arbeitsmöglichkeit.
So siegt die Stilarchitektur über den Künstler.
Wenn, wie verlautet, München der Dresdener
Ausstellung 1906 fernbleibt, dürfte es größerer
Anstrengungen bedürfen, in der Folge wider
den Stachel zu löcken. S.
346