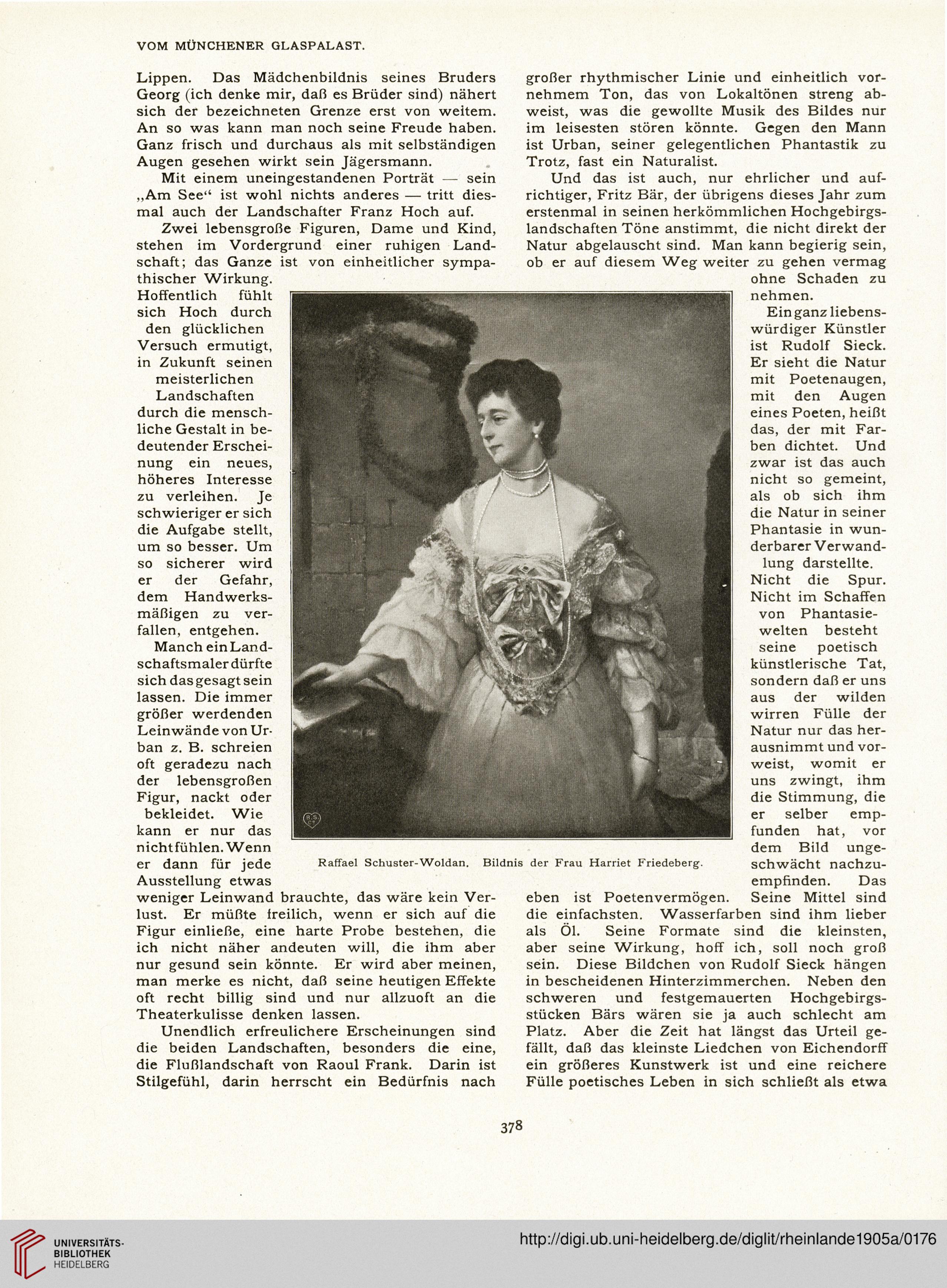VOM MÜNCHENER GLASPALAST.
Lippen. Das Mädchenbildnis seines Bruders
Georg (ich denke mir, daß es Brüder sind) nähert
sich der bezeichneten Grenze erst von weitem.
An so was kann man noch seine Freude haben.
Ganz frisch und durchaus als mit selbständigen
Augen gesehen wirkt sein Jägersmann.
Mit einem uneingestandenen Porträt — sein
,,Am See“ ist wohl nichts anderes — tritt dies-
mal auch der Landschafter Franz Hoch auf.
Zwei lebensgroße Figuren, Dame und Kind,
stehen im Vordergrund einer ruhigen Land-
schaft; das Ganze ist von einheitlicher sympa-
thischer Wirkung.
Hoffentlich fühlt
sich Hoch durch
den glücklichen
Versuch ermutigt,
in Zukunft seinen
meisterlichen
Landschaften
durch die mensch-
liche Gestalt in be-
deutender Erschei-
nung ein neues,
höheres Interesse
zu verleihen. Je
schwieriger er sich
die Aufgabe stellt,
um so besser. Um
so sicherer wird
er der Gefahr,
dem Handwerks-
mäßigen zu ver-
fallen, entgehen.
Manch einLand-
schaftsmaler dürfte
sich das gesagt sein
lassen. Die immer
größer werdenden
Leinwände von Ur-
ban z. B. schreien
oft geradezu nach
der lebensgroßen
Figur, nackt oder
bekleidet. Wie
kann er nur das
nichtfühlen. Wenn
er dann für jede
Ausstellung etwas
weniger Leinwand brauchte, das wäre kein Ver-
lust. Er müßte freilich, wenn er sich auf die
Figur einließe, eine harte Probe bestehen, die
ich nicht näher andeuten wifl, die ihm aber
nur gesund sein könnte. Er wird aber meinen,
man merke es nicht, daß seine heutigen Effekte
oft recht billig sind und nur allzuoft an die
Theaterkulisse denken lassen.
Unendlich erfreulichere Erscheinungen sind
die beiden Landschaften, besonders die eine,
die Flußlandschaft von Raoul Frank. Darin ist
Stilgefühl, darin herrscht ein Bedürfnis nach
großer rhythmischer Linie und einheitlich vor-
nehmem Ton, das von Lokaltönen streng ab-
weist, was die gewollte Musik des Bildes nur
im leisesten stören könnte. Gegen den Mann
ist Urban, seiner gelegentlichen Phantastik zu
Trotz, fast ein Naturalist.
Und das ist auch, nur ehrlicher und auf-
richtiger, Fritz Bär, der übrigens dieses Jahr zum
erstenmal in seinen herkömmlichen Hochgebirgs-
landschaften Töne anstimmt, die nicht direkt der
Natur abgelauscht sind. Man kann begierig sein,
ob er auf diesem Weg weiter zu gehen vermag
ohne Schaden zu
nehmen.
Einganzliebens-
würdiger Künstler
ist Rudolf Sieck.
Er sieht die Natur
mit Poetenaugen,
mit den Augen
eines Poeten, heißt
das, der mit Far-
ben dichtet. Und
zwar ist das auch
nicht so gemeint,
als ob sich ihm
die Natur in seiner
Phantasie in wun-
derbarer Verwand-
lung darstellte.
Nicht die Spur.
Nicht im Schaffen
von Phantasie-
welten besteht
seine poetisch
künstlerische Tat,
sondern daß er uns
aus der wilden
wirren Fülle der
Natur nur das her-
ausnimmt und vor-
weist, womit er
uns zwingt, ihm
die Stimmung, die
er selber emp-
funden hat, vor
dem Bild unge-
schwächt nachzu-
empfinden. Das
eben ist Poetenvermögen. Seine Mittel sind
die einfachsten. Wasserfarben sind ihm lieber
als Öl. Seine Formate sind die kleinsten,
aber seine Wirkung, hoff ich, soll noch groß
sein. Diese Bildchen von Rudolf Sieck hängen
in bescheidenen Hinterzimmerchen. Neben den
schweren und festgemauerten Hochgebirgs-
stücken Bärs wären sie ja auch schlecht am
Platz. Aber die Zeit hat längst das Urteil ge-
fällt, daß das kleinste Liedchen von Eichendorff
ein größeres Kunstwerk ist und eine reichere
Fülle poetisches Leben in sich schließt als etwa
Raffael Schuster-Woldan. Bildnis der Frau Harriet Friedeberg.
378
Lippen. Das Mädchenbildnis seines Bruders
Georg (ich denke mir, daß es Brüder sind) nähert
sich der bezeichneten Grenze erst von weitem.
An so was kann man noch seine Freude haben.
Ganz frisch und durchaus als mit selbständigen
Augen gesehen wirkt sein Jägersmann.
Mit einem uneingestandenen Porträt — sein
,,Am See“ ist wohl nichts anderes — tritt dies-
mal auch der Landschafter Franz Hoch auf.
Zwei lebensgroße Figuren, Dame und Kind,
stehen im Vordergrund einer ruhigen Land-
schaft; das Ganze ist von einheitlicher sympa-
thischer Wirkung.
Hoffentlich fühlt
sich Hoch durch
den glücklichen
Versuch ermutigt,
in Zukunft seinen
meisterlichen
Landschaften
durch die mensch-
liche Gestalt in be-
deutender Erschei-
nung ein neues,
höheres Interesse
zu verleihen. Je
schwieriger er sich
die Aufgabe stellt,
um so besser. Um
so sicherer wird
er der Gefahr,
dem Handwerks-
mäßigen zu ver-
fallen, entgehen.
Manch einLand-
schaftsmaler dürfte
sich das gesagt sein
lassen. Die immer
größer werdenden
Leinwände von Ur-
ban z. B. schreien
oft geradezu nach
der lebensgroßen
Figur, nackt oder
bekleidet. Wie
kann er nur das
nichtfühlen. Wenn
er dann für jede
Ausstellung etwas
weniger Leinwand brauchte, das wäre kein Ver-
lust. Er müßte freilich, wenn er sich auf die
Figur einließe, eine harte Probe bestehen, die
ich nicht näher andeuten wifl, die ihm aber
nur gesund sein könnte. Er wird aber meinen,
man merke es nicht, daß seine heutigen Effekte
oft recht billig sind und nur allzuoft an die
Theaterkulisse denken lassen.
Unendlich erfreulichere Erscheinungen sind
die beiden Landschaften, besonders die eine,
die Flußlandschaft von Raoul Frank. Darin ist
Stilgefühl, darin herrscht ein Bedürfnis nach
großer rhythmischer Linie und einheitlich vor-
nehmem Ton, das von Lokaltönen streng ab-
weist, was die gewollte Musik des Bildes nur
im leisesten stören könnte. Gegen den Mann
ist Urban, seiner gelegentlichen Phantastik zu
Trotz, fast ein Naturalist.
Und das ist auch, nur ehrlicher und auf-
richtiger, Fritz Bär, der übrigens dieses Jahr zum
erstenmal in seinen herkömmlichen Hochgebirgs-
landschaften Töne anstimmt, die nicht direkt der
Natur abgelauscht sind. Man kann begierig sein,
ob er auf diesem Weg weiter zu gehen vermag
ohne Schaden zu
nehmen.
Einganzliebens-
würdiger Künstler
ist Rudolf Sieck.
Er sieht die Natur
mit Poetenaugen,
mit den Augen
eines Poeten, heißt
das, der mit Far-
ben dichtet. Und
zwar ist das auch
nicht so gemeint,
als ob sich ihm
die Natur in seiner
Phantasie in wun-
derbarer Verwand-
lung darstellte.
Nicht die Spur.
Nicht im Schaffen
von Phantasie-
welten besteht
seine poetisch
künstlerische Tat,
sondern daß er uns
aus der wilden
wirren Fülle der
Natur nur das her-
ausnimmt und vor-
weist, womit er
uns zwingt, ihm
die Stimmung, die
er selber emp-
funden hat, vor
dem Bild unge-
schwächt nachzu-
empfinden. Das
eben ist Poetenvermögen. Seine Mittel sind
die einfachsten. Wasserfarben sind ihm lieber
als Öl. Seine Formate sind die kleinsten,
aber seine Wirkung, hoff ich, soll noch groß
sein. Diese Bildchen von Rudolf Sieck hängen
in bescheidenen Hinterzimmerchen. Neben den
schweren und festgemauerten Hochgebirgs-
stücken Bärs wären sie ja auch schlecht am
Platz. Aber die Zeit hat längst das Urteil ge-
fällt, daß das kleinste Liedchen von Eichendorff
ein größeres Kunstwerk ist und eine reichere
Fülle poetisches Leben in sich schließt als etwa
Raffael Schuster-Woldan. Bildnis der Frau Harriet Friedeberg.
378