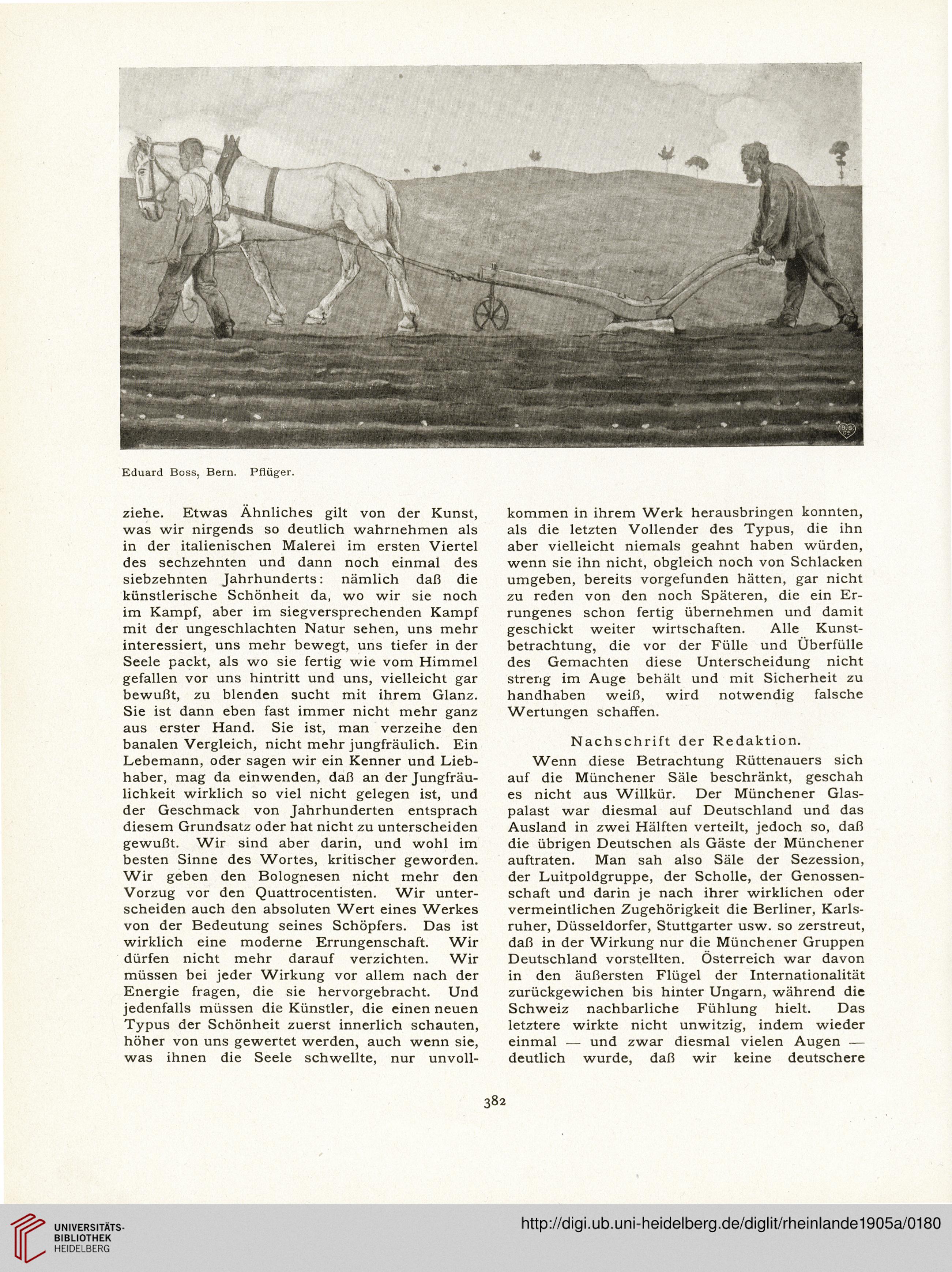Eduard Boss, Bern. Pflüger.
ziehe. Etwas Ähnliches gilt von der Kunst,
was wir nirgends so deutlich wahrnehmen als
in der italienischen Malerei im ersten Viertel
des sechzehnten und dann noch einmal des
siebzehnten Jahrhunderts: nämlich dafi die
künstlerische Schönheit da, wo wir sie noch
im Kampf, aber im siegversprechenden Kampf
mit der ungeschlachten Natur sehen, uns mehr
interessiert, uns mehr bewegt, uns tiefer in der
Seele packt, als wo sie fertig wie vom Himmel
gefallen vor uns hintritt und uns, vielleicht gar
bewußt, zu blenden sucht mit ihrem Glanz.
Sie ist dann eben fast immer nicht mehr ganz
aus erster Hand. Sie ist, man verzeihe den
banalen Vergleich, nicht mehr jungfräulich. Ein
Lebemann, oder sagen wir ein Kenner und Lieb-
haber, mag da einwenden, daß an der Jungfräu-
lichkeit wirklich so viel nicht gelegen ist, und
der Geschmack von Jahrhunderten entsprach
diesem Grundsatz oder hat nicht zu unterscheiden
gewußt. Wir sind aber darin, und wohl im
besten Sinne des Wortes, kritischer geworden.
Wir geben den Bolognesen nicht mehr den
Vorzug vor den Quattrocentisten. Wir unter-
scheiden auch den absoluten Wert eines Werkes
von der Bedeutung seines Schöpfers. Das ist
wirklich eine moderne Errungenschaft. Wir
dürfen nicht mehr darauf verzichten. Wir
müssen bei jeder Wirkung vor allem nach der
Energie fragen, die sie hervorgebracht. Und
jedenfalls müssen die Künstler, die einen neuen
Typus der Schönheit zuerst innerlich schauten,
höher von uns gewertet werden, auch wenn sie,
was ihnen die Seele schwellte, nur unvoll-
kommen in ihrem Werk herausbringen konnten,
als die letzten Vollender des Typus, die ihn
aber vielleicht niemals geahnt haben würden,
wenn sie ihn nicht, obgleich noch von Schlacken
umgeben, bereits vorgefunden hätten, gar nicht
zu reden von den noch Späteren, die ein Er-
rungenes schon fertig übernehmen und damit
geschickt weiter wirtschaften. Alle Kunst-
betrachtung, die vor der Fülle und Überfülle
des Gemachten diese Unterscheidung nicht
streng im Auge behält und mit Sicherheit zu
handhaben weiß, wird notwendig falsche
Wertungen schaffen.
Nachschrift der Redaktion.
Wenn diese Betrachtung Rüttenauers sich
auf die Münchener Säle beschränkt, geschah
es nicht aus Willkür. Der Münchener Glas-
palast war diesmal auf Deutschland und das
Ausland in zwei Hälften verteilt, jedoch so, daß
die übrigen Deutschen als Gäste der Münchener
auftraten. Man sah also Säle der Sezession,
der Luitpoldgruppe, der Scholle, der Genossen-
schaft und darin je nach ihrer wirklichen oder
vermeintlichen Zugehörigkeit die Berliner, Karls-
ruher, Düsseldorfer, Stuttgarter usw. so zerstreut,
daß in der Wirkung nur die Münchener Gruppen
Deutschland vorstellten. Österreich war davon
in den äußersten Flügel der Internationalität
zurückgewichen bis hinter Ungarn, während die
Schweiz nachbarliche Fühlung hielt. Das
letztere wirkte nicht unwitzig, indem wieder
einmal — und zwar diesmal vielen Augen —
deutlich wurde, daß wir keine deutschere
382
ziehe. Etwas Ähnliches gilt von der Kunst,
was wir nirgends so deutlich wahrnehmen als
in der italienischen Malerei im ersten Viertel
des sechzehnten und dann noch einmal des
siebzehnten Jahrhunderts: nämlich dafi die
künstlerische Schönheit da, wo wir sie noch
im Kampf, aber im siegversprechenden Kampf
mit der ungeschlachten Natur sehen, uns mehr
interessiert, uns mehr bewegt, uns tiefer in der
Seele packt, als wo sie fertig wie vom Himmel
gefallen vor uns hintritt und uns, vielleicht gar
bewußt, zu blenden sucht mit ihrem Glanz.
Sie ist dann eben fast immer nicht mehr ganz
aus erster Hand. Sie ist, man verzeihe den
banalen Vergleich, nicht mehr jungfräulich. Ein
Lebemann, oder sagen wir ein Kenner und Lieb-
haber, mag da einwenden, daß an der Jungfräu-
lichkeit wirklich so viel nicht gelegen ist, und
der Geschmack von Jahrhunderten entsprach
diesem Grundsatz oder hat nicht zu unterscheiden
gewußt. Wir sind aber darin, und wohl im
besten Sinne des Wortes, kritischer geworden.
Wir geben den Bolognesen nicht mehr den
Vorzug vor den Quattrocentisten. Wir unter-
scheiden auch den absoluten Wert eines Werkes
von der Bedeutung seines Schöpfers. Das ist
wirklich eine moderne Errungenschaft. Wir
dürfen nicht mehr darauf verzichten. Wir
müssen bei jeder Wirkung vor allem nach der
Energie fragen, die sie hervorgebracht. Und
jedenfalls müssen die Künstler, die einen neuen
Typus der Schönheit zuerst innerlich schauten,
höher von uns gewertet werden, auch wenn sie,
was ihnen die Seele schwellte, nur unvoll-
kommen in ihrem Werk herausbringen konnten,
als die letzten Vollender des Typus, die ihn
aber vielleicht niemals geahnt haben würden,
wenn sie ihn nicht, obgleich noch von Schlacken
umgeben, bereits vorgefunden hätten, gar nicht
zu reden von den noch Späteren, die ein Er-
rungenes schon fertig übernehmen und damit
geschickt weiter wirtschaften. Alle Kunst-
betrachtung, die vor der Fülle und Überfülle
des Gemachten diese Unterscheidung nicht
streng im Auge behält und mit Sicherheit zu
handhaben weiß, wird notwendig falsche
Wertungen schaffen.
Nachschrift der Redaktion.
Wenn diese Betrachtung Rüttenauers sich
auf die Münchener Säle beschränkt, geschah
es nicht aus Willkür. Der Münchener Glas-
palast war diesmal auf Deutschland und das
Ausland in zwei Hälften verteilt, jedoch so, daß
die übrigen Deutschen als Gäste der Münchener
auftraten. Man sah also Säle der Sezession,
der Luitpoldgruppe, der Scholle, der Genossen-
schaft und darin je nach ihrer wirklichen oder
vermeintlichen Zugehörigkeit die Berliner, Karls-
ruher, Düsseldorfer, Stuttgarter usw. so zerstreut,
daß in der Wirkung nur die Münchener Gruppen
Deutschland vorstellten. Österreich war davon
in den äußersten Flügel der Internationalität
zurückgewichen bis hinter Ungarn, während die
Schweiz nachbarliche Fühlung hielt. Das
letztere wirkte nicht unwitzig, indem wieder
einmal — und zwar diesmal vielen Augen —
deutlich wurde, daß wir keine deutschere
382