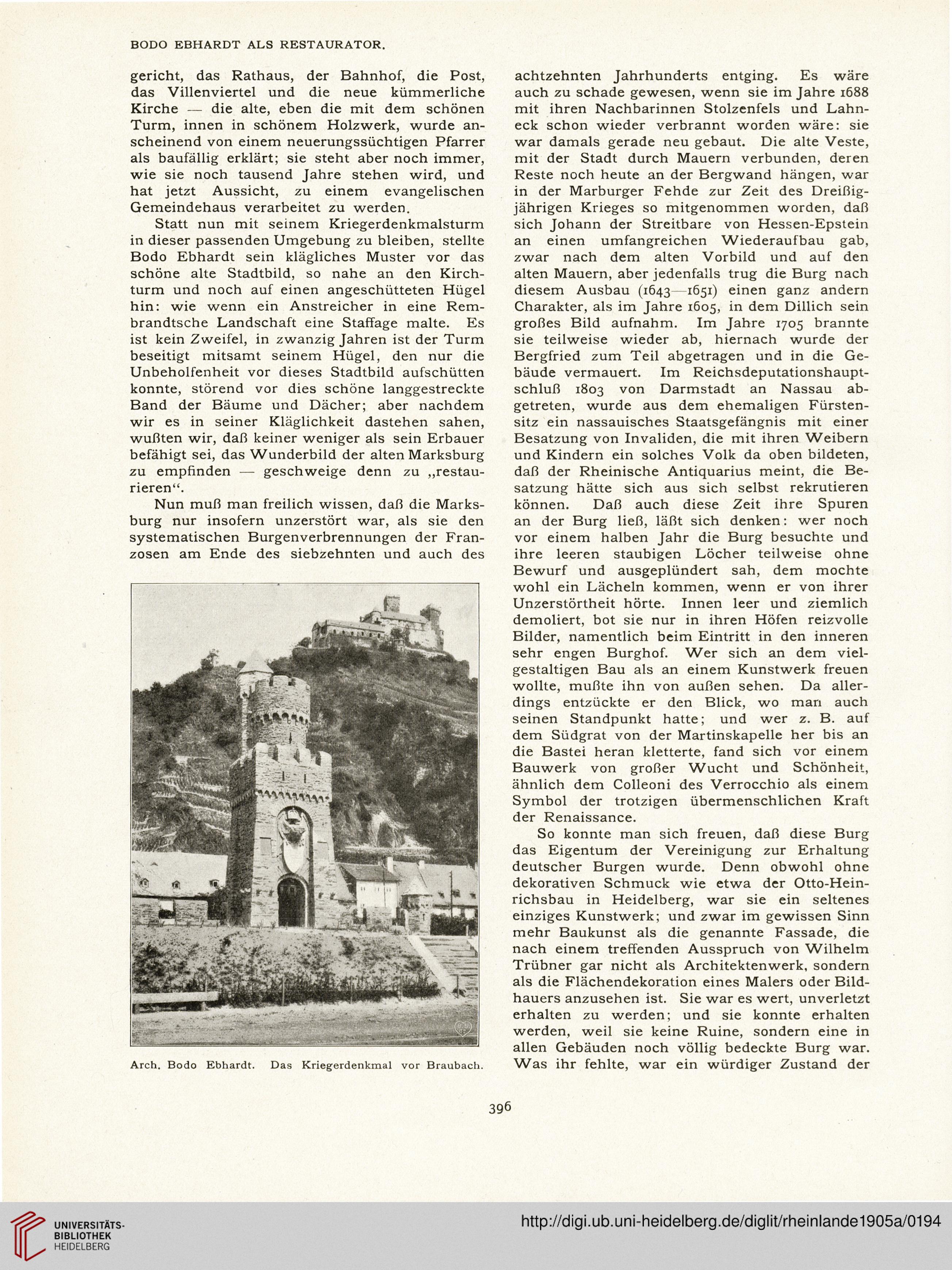BODO EBHARDT ALS RESTAURATOR.
gericht, das Rathaus, der Bahnhof, die Post,
das Villenviertel und die neue kümmerliche
Kirche — die alte, eben die mit dem schönen
Turm, innen in schönem Holzwerk, wurde an-
scheinend von einem neuerungssüchtigen Pfarrer
als baufällig erklärt; sie steht aber noch immer,
wie sie noch tausend Jahre stehen wird, und
hat jetzt Aussicht, zu einem evangelischen
Gemeindehaus verarbeitet zu werden.
Statt nun mit seinem Kriegerdenkmalsturm
in dieser passenden Umgebung zu bleiben, stellte
Bodo Ebhardt sein klägliches Muster vor das
schöne alte Stadtbild, so nahe an den Kirch-
turm und noch auf einen angeschütteten Hügel
hin: wie wenn ein Anstreicher in eine Rem-
brandtsche Landschaft eine Staffage malte. Es
ist kein Zweifel, in zwanzig Jahren ist der Turm
beseitigt mitsamt seinem Hügel, den nur die
Unbeholfenheit vor dieses Stadtbild aufschütten
konnte, störend vor dies schöne langgestreckte
Band der Bäume und Dächer; aber nachdem
wir es in seiner Kläglichkeit dastehen sahen,
wußten wir, daß keiner weniger als sein Erbauer
befähigt sei, das Wunderbild der alten Marksburg
zu empfinden — geschweige denn zu „restau-
rieren“.
Nun muß man freilich wissen, daß die Marks-
burg nur insofern unzerstört war, als sie den
systematischen Burgenverbrennungen der Fran-
zosen am Ende des siebzehnten und auch des
Arch. Bodo Ebhardt. Das Kriegerdenkmal vor Braubach.
achtzehnten Jahrhunderts entging. Es wäre
auch zu schade gewesen, wenn sie im Jahre 1688
mit ihren Nachbarinnen Stolzenfels und Lahn-
eck schon wieder verbrannt worden wäre: sie
war damals gerade neu gebaut. Die alte Veste,
mit der Stadt durch Mauern verbunden, deren
Reste noch heute an der Bergwand hängen, war
in der Marburger Fehde zur Zeit des Dreißig-
jährigen Krieges so mitgenommen worden, daß
sich Johann der Streitbare von Hessen-Epstein
an einen umfangreichen Wiederaufbau gab,
zwar nach dem alten Vorbild und auf den
alten Mauern, aber jedenfalls trug die Burg nach
diesem Ausbau (1643- 1651) einen ganz andern
Charakter, als im Jahre 1605, in dem Dillich sein
großes Bild aufnahm. Im Jahre 1705 brannte
sie teilweise wieder ab, hiernach wurde der
Bergfried zum Teil abgetragen und in die Ge-
bäude vermauert. Im Reichsdeputationshaupt-
schluß 1803 von Darmstadt an Nassau ab-
getreten, wurde aus dem ehemaligen Fürsten-
sitz ein nassauisches Staatsgefängnis mit einer
Besatzung von Invaliden, die mit ihren Weibern
und Kindern ein solches Volk da oben bildeten,
daß der Rheinische Antiquarius meint, die Be-
satzung hätte sich aus sich selbst rekrutieren
können. Daß auch diese Zeit ihre Spuren
an der Burg ließ, läßt sich denken: wer noch
vor einem halben Jahr die Burg besuchte und
ihre leeren staubigen Löcher teilweise ohne
Bewurf und ausgeplündert sah, dem mochte
wohl ein Lächeln kommen, wenn er von ihrer
Unzerstörtheit hörte. Innen leer und ziemlich
demoliert, bot sie nur in ihren Höfen reizvolle
Bilder, namentlich beim Eintritt in den inneren
sehr engen Burghof. Wer sich an dem viel-
gestaltigen Bau als an einem Kunstwerk freuen
wollte, mußte ihn von außen sehen. Da aller-
dings entzückte er den Blick, wo man auch
seinen Standpunkt hatte; und wer z. B. auf
dem Südgrat von der Martinskapelle her bis an
die Bastei heran kletterte, fand sich vor einem
Bauwerk von großer Wucht und Schönheit,
ähnlich dem Colleoni des Verrocchio als einem
Symbol der trotzigen übermenschlichen Kraft
der Renaissance.
So konnte man sich freuen, daß diese Burg
das Eigentum der Vereinigung zur Erhaltung
deutscher Burgen wurde. Denn obwohl ohne
dekorativen Schmuck wie etwa der Otto-Hein-
richsbau in Heidelberg, war sie ein seltenes
einziges Kunstwerk; und zwar im gewissen Sinn
mehr Baukunst als die genannte Fassade, die
nach einem treffenden Ausspruch von Wilhelm
Trübner gar nicht als Architektenwerk, sondern
als die Flächendekoration eines Malers oder Bild-
hauers anzusehen ist. Sie war es wert, unverletzt
erhalten zu werden; und sie konnte erhalten
werden, weil sie keine Ruine, sondern eine in
allen Gebäuden noch völlig bedeckte Burg war.
Was ihr fehlte, war ein würdiger Zustand der
396
gericht, das Rathaus, der Bahnhof, die Post,
das Villenviertel und die neue kümmerliche
Kirche — die alte, eben die mit dem schönen
Turm, innen in schönem Holzwerk, wurde an-
scheinend von einem neuerungssüchtigen Pfarrer
als baufällig erklärt; sie steht aber noch immer,
wie sie noch tausend Jahre stehen wird, und
hat jetzt Aussicht, zu einem evangelischen
Gemeindehaus verarbeitet zu werden.
Statt nun mit seinem Kriegerdenkmalsturm
in dieser passenden Umgebung zu bleiben, stellte
Bodo Ebhardt sein klägliches Muster vor das
schöne alte Stadtbild, so nahe an den Kirch-
turm und noch auf einen angeschütteten Hügel
hin: wie wenn ein Anstreicher in eine Rem-
brandtsche Landschaft eine Staffage malte. Es
ist kein Zweifel, in zwanzig Jahren ist der Turm
beseitigt mitsamt seinem Hügel, den nur die
Unbeholfenheit vor dieses Stadtbild aufschütten
konnte, störend vor dies schöne langgestreckte
Band der Bäume und Dächer; aber nachdem
wir es in seiner Kläglichkeit dastehen sahen,
wußten wir, daß keiner weniger als sein Erbauer
befähigt sei, das Wunderbild der alten Marksburg
zu empfinden — geschweige denn zu „restau-
rieren“.
Nun muß man freilich wissen, daß die Marks-
burg nur insofern unzerstört war, als sie den
systematischen Burgenverbrennungen der Fran-
zosen am Ende des siebzehnten und auch des
Arch. Bodo Ebhardt. Das Kriegerdenkmal vor Braubach.
achtzehnten Jahrhunderts entging. Es wäre
auch zu schade gewesen, wenn sie im Jahre 1688
mit ihren Nachbarinnen Stolzenfels und Lahn-
eck schon wieder verbrannt worden wäre: sie
war damals gerade neu gebaut. Die alte Veste,
mit der Stadt durch Mauern verbunden, deren
Reste noch heute an der Bergwand hängen, war
in der Marburger Fehde zur Zeit des Dreißig-
jährigen Krieges so mitgenommen worden, daß
sich Johann der Streitbare von Hessen-Epstein
an einen umfangreichen Wiederaufbau gab,
zwar nach dem alten Vorbild und auf den
alten Mauern, aber jedenfalls trug die Burg nach
diesem Ausbau (1643- 1651) einen ganz andern
Charakter, als im Jahre 1605, in dem Dillich sein
großes Bild aufnahm. Im Jahre 1705 brannte
sie teilweise wieder ab, hiernach wurde der
Bergfried zum Teil abgetragen und in die Ge-
bäude vermauert. Im Reichsdeputationshaupt-
schluß 1803 von Darmstadt an Nassau ab-
getreten, wurde aus dem ehemaligen Fürsten-
sitz ein nassauisches Staatsgefängnis mit einer
Besatzung von Invaliden, die mit ihren Weibern
und Kindern ein solches Volk da oben bildeten,
daß der Rheinische Antiquarius meint, die Be-
satzung hätte sich aus sich selbst rekrutieren
können. Daß auch diese Zeit ihre Spuren
an der Burg ließ, läßt sich denken: wer noch
vor einem halben Jahr die Burg besuchte und
ihre leeren staubigen Löcher teilweise ohne
Bewurf und ausgeplündert sah, dem mochte
wohl ein Lächeln kommen, wenn er von ihrer
Unzerstörtheit hörte. Innen leer und ziemlich
demoliert, bot sie nur in ihren Höfen reizvolle
Bilder, namentlich beim Eintritt in den inneren
sehr engen Burghof. Wer sich an dem viel-
gestaltigen Bau als an einem Kunstwerk freuen
wollte, mußte ihn von außen sehen. Da aller-
dings entzückte er den Blick, wo man auch
seinen Standpunkt hatte; und wer z. B. auf
dem Südgrat von der Martinskapelle her bis an
die Bastei heran kletterte, fand sich vor einem
Bauwerk von großer Wucht und Schönheit,
ähnlich dem Colleoni des Verrocchio als einem
Symbol der trotzigen übermenschlichen Kraft
der Renaissance.
So konnte man sich freuen, daß diese Burg
das Eigentum der Vereinigung zur Erhaltung
deutscher Burgen wurde. Denn obwohl ohne
dekorativen Schmuck wie etwa der Otto-Hein-
richsbau in Heidelberg, war sie ein seltenes
einziges Kunstwerk; und zwar im gewissen Sinn
mehr Baukunst als die genannte Fassade, die
nach einem treffenden Ausspruch von Wilhelm
Trübner gar nicht als Architektenwerk, sondern
als die Flächendekoration eines Malers oder Bild-
hauers anzusehen ist. Sie war es wert, unverletzt
erhalten zu werden; und sie konnte erhalten
werden, weil sie keine Ruine, sondern eine in
allen Gebäuden noch völlig bedeckte Burg war.
Was ihr fehlte, war ein würdiger Zustand der
396