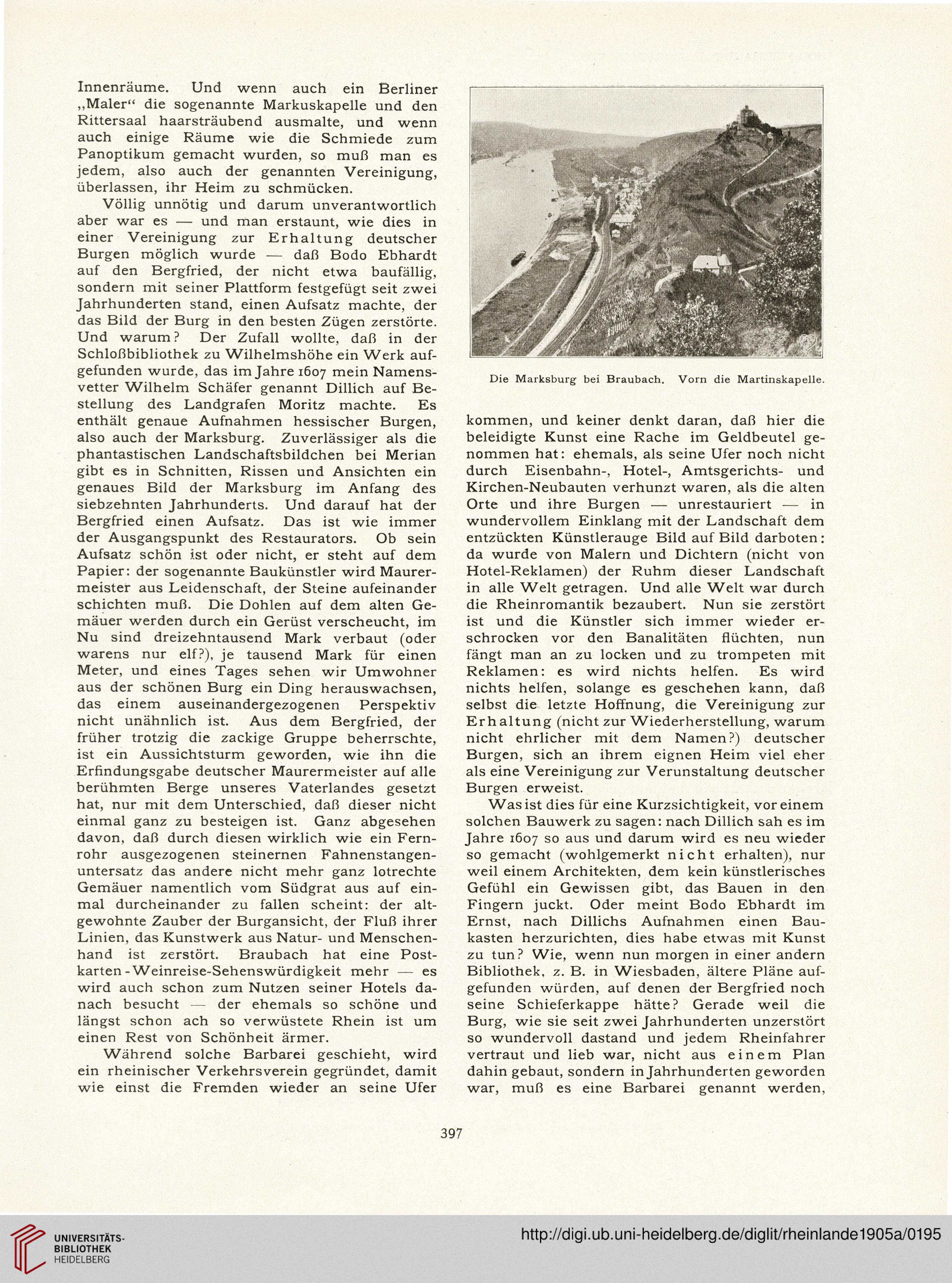Innenräume. Und wenn auch ein Berliner
„Maler“ die sogenannte Markuskapelle und den
Rittersaal haarsträubend ausmalte, und wenn
auch einige Räume wie die Schmiede zum
Panoptikum gemacht wurden, so muß man es
jedem, also auch der genannten Vereinigung,
überlassen, ihr Heim zu schmücken.
Völlig unnötig und darum unverantwortlich
aber war es — und man erstaunt, wie dies in
einer Vereinigung zur Erhaltung deutscher
Burgen möglich wurde — daß Bodo Ebhardt
auf den Bergfried, der nicht etwa baufällig,
sondern mit seiner Plattform festgefügt seit zwei
Jahrhunderten stand, einen Aufsatz machte, der
das Bild der Burg in den besten Zügen zerstörte.
Und warum? Der Zufall wollte, daß in der
Schloßbibliothek zu Wilhelmshöhe ein Werk auf-
gefunden wurde, das im Jahre 1607 mein Namens-
vetter Wilhelm Schäfer genannt Dillich auf Be-
stellung des Landgrafen Moritz machte. Es
enthält genaue Aufnahmen hessischer Burgen,
also auch der Marksburg. Zuverlässiger als die
phantastischen Landschaftsbildchen bei Merian
gibt es in Schnitten, Rissen und Ansichten ein
genaues Bild der Marksburg im Anfang des
siebzehnten Jahrhunderts. Und darauf hat der
Bergfried einen Aufsatz. Das ist wie immer
der Ausgangspunkt des Restaurators. Ob sein
Aufsatz schön ist oder nicht, er steht auf dem
Papier: der sogenannte Baukünstler wird Maurer-
meister aus Leidenschaft, der Steine aufeinander
schichten muß. Die Dohlen auf dem alten Ge-
mäuer werden durch ein Gerüst verscheucht, im
Nu sind dreizehntausend Mark verbaut (oder
warens nur elf?), je tausend Mark für einen
Meter, und eines Tages sehen wir Umwohner
aus der schönen Burg ein Ding herauswachsen,
das einem auseinandergezogenen Perspektiv
nicht unähnlich ist. Aus dem Bergfried, der
früher trotzig die zackige Gruppe beherrschte,
ist ein Aussichtsturm geworden, wie ihn die
Erfindungsgabe deutscher Maurermeister auf alle
berühmten Berge unseres Vaterlandes gesetzt
hat, nur mit dem Unterschied, daß dieser nicht
einmal ganz zu besteigen ist. Ganz abgesehen
davon, daß durch diesen wirklich wie ein Fern-
rohr ausgezogenen steinernen Fahnenstangen-
untersatz das andere nicht mehr ganz lotrechte
Gemäuer namentlich vom Südgrat aus auf ein-
mal durcheinander zu fallen scheint: der alt-
gewohnte Zauber der Burgansicht, der Fluß ihrer
Linien, das Kunstwerk aus Natur- und Menschen-
hand ist zerstört. Braubach hat eine Post-
karten - Weinreise-Sehenswürdigkeit mehr — es
wird auch schon zum Nutzen seiner Hotels da-
nach besucht — der ehemals so schöne und
längst schon ach so verwüstete Rhein ist um
einen Rest von Schönheit ärmer.
Während solche Barbarei geschieht, wird
ein rheinischer Verkehrsverein gegründet, damit
wie einst die Fremden wieder an seine Ufer
Die Marksburg bei Braubach. Vorn die Martinskapelle.
kommen, und keiner denkt daran, daß hier die
beleidigte Kunst eine Rache im Geldbeutel ge-
nommen hat: ehemals, als seine Ufer noch nicht
durch Eisenbahn-, Hotel-, Amtsgerichts- und
Kirchen-Neubauten verhunzt waren, als die alten
Orte und ihre Burgen — unrestauriert — in
wundervollem Einklang mit der Landschaft dem
entzückten Künstlerauge Bild auf Bild darboten:
da wurde von Malern und Dichtern (nicht von
Hotel-Reklamen) der Ruhm dieser Landschaft
in alle Welt getragen. Und alle Welt war durch
die Rheinromantik bezaubert. Nun sie zerstört
ist und die Künstler sich immer wieder er-
schrocken vor den Banalitäten flüchten, nun
fängt man an zu locken und zu trompeten mit
Reklamen: es wird nichts helfen. Es wird
nichts helfen, solange es geschehen kann, daß
selbst die letzte Hoffnung, die Vereinigung zur
Erhaltung (nicht zur Wiederherstellung, warum
nicht ehrlicher mit dem Namen?) deutscher
Burgen, sich an ihrem eignen Heim viel eher
als eine Vereinigung zur Verunstaltung deutscher
Burgen erweist.
Wasist dies für eine Kurzsichtigkeit, voreinem
solchen Bauwerk zu sagen: nach Dillich sah es im
Jahre 1607 so aus und darum wird es neu wieder
so gemacht (wohlgemerkt nicht erhalten), nur
weil einem Architekten, dem kein künstlerisches
Gefühl ein Gewissen gibt, das Bauen in den
Fingern juckt. Oder meint Bodo Ebhardt im
Ernst, nach Dillichs Aufnahmen einen Bau-
kasten herzurichten, dies habe etwas mit Kunst
zu tun? Wie, wenn nun morgen in einer andern
Bibliothek, z. B. in Wiesbaden, ältere Pläne auf-
gefunden würden, auf denen der Bergfried noch
seine Schieferkappe hätte? Gerade weil die
Burg, wie sie seit zwei Jahrhunderten unzerstört
so wundervoll dastand und jedem Rheinfahrer
vertraut und lieb war, nicht aus einem Plan
dahin gebaut, sondern in Jahrhunderten geworden
war, muß es eine Barbarei genannt werden,
397
„Maler“ die sogenannte Markuskapelle und den
Rittersaal haarsträubend ausmalte, und wenn
auch einige Räume wie die Schmiede zum
Panoptikum gemacht wurden, so muß man es
jedem, also auch der genannten Vereinigung,
überlassen, ihr Heim zu schmücken.
Völlig unnötig und darum unverantwortlich
aber war es — und man erstaunt, wie dies in
einer Vereinigung zur Erhaltung deutscher
Burgen möglich wurde — daß Bodo Ebhardt
auf den Bergfried, der nicht etwa baufällig,
sondern mit seiner Plattform festgefügt seit zwei
Jahrhunderten stand, einen Aufsatz machte, der
das Bild der Burg in den besten Zügen zerstörte.
Und warum? Der Zufall wollte, daß in der
Schloßbibliothek zu Wilhelmshöhe ein Werk auf-
gefunden wurde, das im Jahre 1607 mein Namens-
vetter Wilhelm Schäfer genannt Dillich auf Be-
stellung des Landgrafen Moritz machte. Es
enthält genaue Aufnahmen hessischer Burgen,
also auch der Marksburg. Zuverlässiger als die
phantastischen Landschaftsbildchen bei Merian
gibt es in Schnitten, Rissen und Ansichten ein
genaues Bild der Marksburg im Anfang des
siebzehnten Jahrhunderts. Und darauf hat der
Bergfried einen Aufsatz. Das ist wie immer
der Ausgangspunkt des Restaurators. Ob sein
Aufsatz schön ist oder nicht, er steht auf dem
Papier: der sogenannte Baukünstler wird Maurer-
meister aus Leidenschaft, der Steine aufeinander
schichten muß. Die Dohlen auf dem alten Ge-
mäuer werden durch ein Gerüst verscheucht, im
Nu sind dreizehntausend Mark verbaut (oder
warens nur elf?), je tausend Mark für einen
Meter, und eines Tages sehen wir Umwohner
aus der schönen Burg ein Ding herauswachsen,
das einem auseinandergezogenen Perspektiv
nicht unähnlich ist. Aus dem Bergfried, der
früher trotzig die zackige Gruppe beherrschte,
ist ein Aussichtsturm geworden, wie ihn die
Erfindungsgabe deutscher Maurermeister auf alle
berühmten Berge unseres Vaterlandes gesetzt
hat, nur mit dem Unterschied, daß dieser nicht
einmal ganz zu besteigen ist. Ganz abgesehen
davon, daß durch diesen wirklich wie ein Fern-
rohr ausgezogenen steinernen Fahnenstangen-
untersatz das andere nicht mehr ganz lotrechte
Gemäuer namentlich vom Südgrat aus auf ein-
mal durcheinander zu fallen scheint: der alt-
gewohnte Zauber der Burgansicht, der Fluß ihrer
Linien, das Kunstwerk aus Natur- und Menschen-
hand ist zerstört. Braubach hat eine Post-
karten - Weinreise-Sehenswürdigkeit mehr — es
wird auch schon zum Nutzen seiner Hotels da-
nach besucht — der ehemals so schöne und
längst schon ach so verwüstete Rhein ist um
einen Rest von Schönheit ärmer.
Während solche Barbarei geschieht, wird
ein rheinischer Verkehrsverein gegründet, damit
wie einst die Fremden wieder an seine Ufer
Die Marksburg bei Braubach. Vorn die Martinskapelle.
kommen, und keiner denkt daran, daß hier die
beleidigte Kunst eine Rache im Geldbeutel ge-
nommen hat: ehemals, als seine Ufer noch nicht
durch Eisenbahn-, Hotel-, Amtsgerichts- und
Kirchen-Neubauten verhunzt waren, als die alten
Orte und ihre Burgen — unrestauriert — in
wundervollem Einklang mit der Landschaft dem
entzückten Künstlerauge Bild auf Bild darboten:
da wurde von Malern und Dichtern (nicht von
Hotel-Reklamen) der Ruhm dieser Landschaft
in alle Welt getragen. Und alle Welt war durch
die Rheinromantik bezaubert. Nun sie zerstört
ist und die Künstler sich immer wieder er-
schrocken vor den Banalitäten flüchten, nun
fängt man an zu locken und zu trompeten mit
Reklamen: es wird nichts helfen. Es wird
nichts helfen, solange es geschehen kann, daß
selbst die letzte Hoffnung, die Vereinigung zur
Erhaltung (nicht zur Wiederherstellung, warum
nicht ehrlicher mit dem Namen?) deutscher
Burgen, sich an ihrem eignen Heim viel eher
als eine Vereinigung zur Verunstaltung deutscher
Burgen erweist.
Wasist dies für eine Kurzsichtigkeit, voreinem
solchen Bauwerk zu sagen: nach Dillich sah es im
Jahre 1607 so aus und darum wird es neu wieder
so gemacht (wohlgemerkt nicht erhalten), nur
weil einem Architekten, dem kein künstlerisches
Gefühl ein Gewissen gibt, das Bauen in den
Fingern juckt. Oder meint Bodo Ebhardt im
Ernst, nach Dillichs Aufnahmen einen Bau-
kasten herzurichten, dies habe etwas mit Kunst
zu tun? Wie, wenn nun morgen in einer andern
Bibliothek, z. B. in Wiesbaden, ältere Pläne auf-
gefunden würden, auf denen der Bergfried noch
seine Schieferkappe hätte? Gerade weil die
Burg, wie sie seit zwei Jahrhunderten unzerstört
so wundervoll dastand und jedem Rheinfahrer
vertraut und lieb war, nicht aus einem Plan
dahin gebaut, sondern in Jahrhunderten geworden
war, muß es eine Barbarei genannt werden,
397