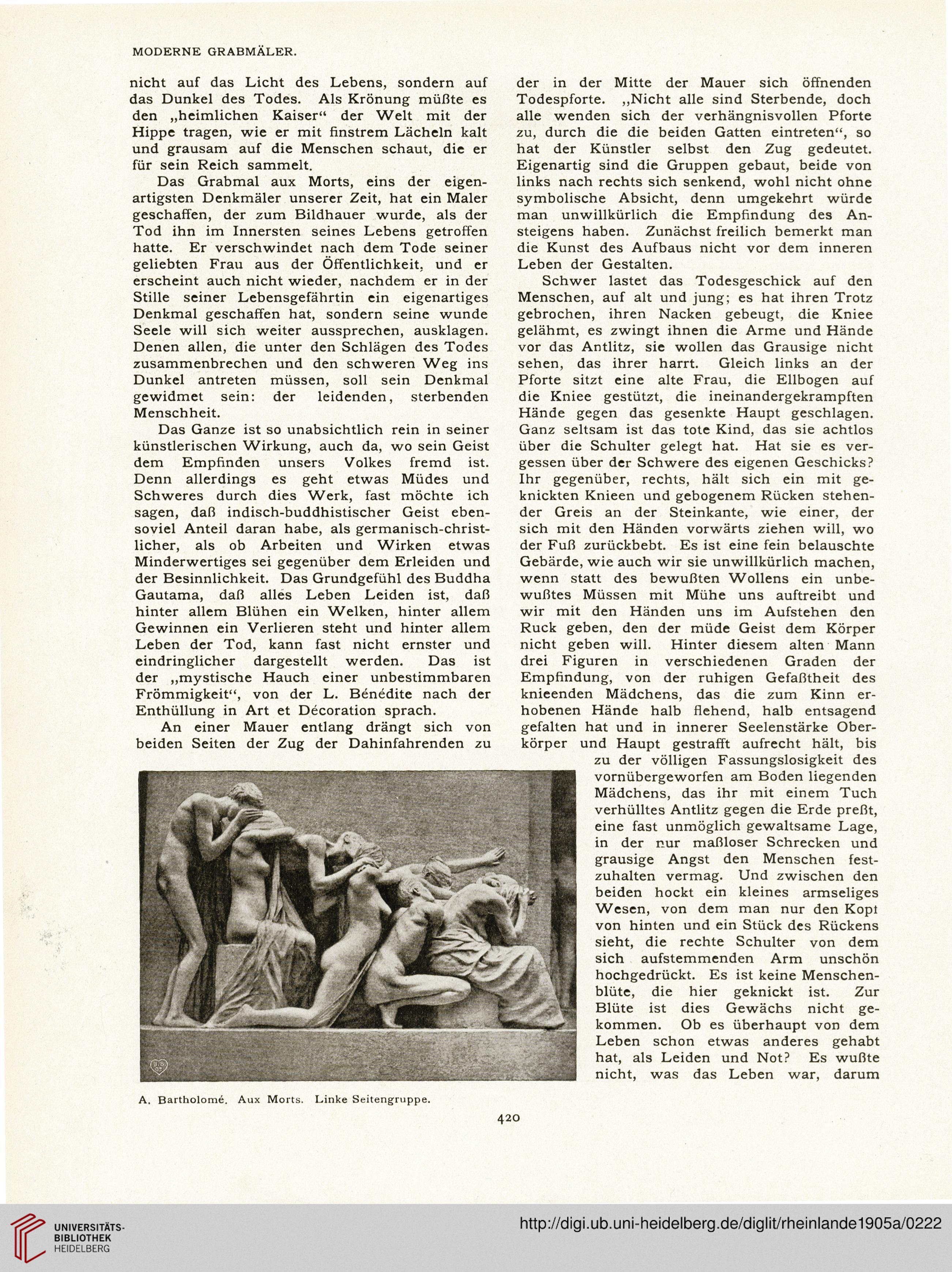MODERNE GRABMÄLER.
nicht auf das Licht des Lebens, sondern auf
das Dunkel des Todes. Als Krönung müßte es
den „heimlichen Kaiser“ der Welt mit der
Hippe tragen, wie er mit finstrem Lächeln kalt
und grausam auf die Menschen schaut, die er
für sein Reich sammelt.
Das Grabmal aux Morts, eins der eigen-
artigsten Denkmäler unserer Zeit, hat ein Maler
geschaffen, der zum Bildhauer wurde, als der
Tod ihn im Innersten seines Lebens getroffen
hatte. Er verschwindet nach dem Tode seiner
geliebten Frau aus der Öffentlichkeit, und er
erscheint auch nicht wieder, nachdem er in der
Stille seiner Lebensgefährtin ein eigenartiges
Denkmal geschaffen hat, sondern seine wunde
Seele will sich weiter aussprechen, ausklagen.
Denen allen, die unter den Schlägen des Todes
zusammenbrechen und den schweren Weg ins
Dunkel antreten müssen, soll sein Denkmal
gewidmet sein: der leidenden, sterbenden
Menschheit.
Das Ganze ist so unabsichtlich rein in seiner
künstlerischen Wirkung, auch da, wo sein Geist
dem Empfinden unsers Volkes fremd ist.
Denn allerdings es geht etwas Müdes und
Schweres durch dies Werk, fast möchte ich
sagen, daß indisch-buddhistischer Geist eben-
soviel Anteil daran habe, als germanisch-christ-
licher, als ob Arbeiten und Wirken etwas
Minderwertiges sei gegenüber dem Erleiden und
der Besinnlichkeit. Das Grundgefühl des Buddha
Gautama, daß alles Leben Leiden ist, daß
hinter allem Blühen ein Welken, hinter allem
Gewinnen ein Verlieren steht und hinter allem
Leben der Tod, kann fast nicht ernster und
eindringlicher dargestellt werden. Das ist
der „mystische Hauch einer unbestimmbaren
Frömmigkeit“, von der L. Benedite nach der
Enthüllung in Art et Decoration sprach.
An einer Mauer entlang drängt sich von
beiden Seiten der Zug der Dahinfahrenden zu
der in der Mitte der Mauer sich öffnenden
Todespforte. „Nicht alle sind Sterbende, doch
alle wenden sich der verhängnisvollen Pforte
zu, durch die die beiden Gatten eintreten“, so
hat der Künstler selbst den Zug gedeutet.
Eigenartig sind die Gruppen gebaut, beide von
links nach rechts sich senkend, wohl nicht ohne
symbolische Absicht, denn umgekehrt würde
man unwillkürlich die Empfindung des An-
steigens haben. Zunächst freilich bemerkt man
die Kunst des Aufbaus nicht vor dem inneren
Leben der Gestalten.
Schwer lastet das Todesgeschick auf den
Menschen, auf alt und jung; es hat ihren Trotz
gebrochen, ihren Nacken gebeugt, die Kniee
gelähmt, es zwingt ihnen die Arme und Hände
vor das Antlitz, sie wollen das Grausige nicht
sehen, das ihrer harrt. Gleich links an der
Pforte sitzt eine alte Frau, die Ellbogen auf
die Kniee gestützt, die ineinandergekrampften
Hände gegen das gesenkte Haupt geschlagen.
Ganz seltsam ist das tote Kind, das sie achtlos
über die Schulter gelegt hat. Hat sie es ver-
gessen über der Schwere des eigenen Geschicks?
Ihr gegenüber, rechts, hält sich ein mit ge-
knickten Knieen und gebogenem Rücken stehen-
der Greis an der Steinkante, wie einer, der
sich mit den Händen vorwärts ziehen will, wo
der Fuß zurückbebt. Es ist eine fein belauschte
Gebärde, wie auch wir sie unwillkürlich machen,
wenn statt des bewußten Wollens ein unbe-
wußtes Müssen mit Mühe uns auftreibt und
wir mit den Händen uns im Aufstehen den
Ruck geben, den der müde Geist dem Körper
nicht geben will. Hinter diesem alten Mann
drei Figuren in verschiedenen Graden der
Empfindung, von der ruhigen Gefaßtheit des
knieenden Mädchens, das die zum Kinn er-
hobenen Hände halb fiehend, halb entsagend
gefalten hat und in innerer Seelenstärke Ober-
körper und Haupt gestrafft aufrecht hält, bis
zu der völligen Fassungslosigkeit des
vornübergeworfen am Boden liegenden
Mädchens, das ihr mit einem Tuch
verhülltes Antlitz gegen die Erde preßt,
eine fast unmöglich gewaltsame Lage,
in der nur maßloser Schrecken und
grausige Angst den Menschen fest-
zuhalten vermag. Und zwischen den
beiden hockt ein kleines armseliges
Wesen, von dem man nur den Kopl
von hinten und ein Stück des Rückens
sieht, die rechte Schulter von dem
sich aufstemmenden Arm unschön
hochgedrückt. Es ist keine Menschen-
blüte, die hier geknickt ist. Zur
Blüte ist dies Gewächs nicht ge-
kommen. Ob es überhaupt von dem
Leben schon etwas anderes gehabt
hat, als Leiden und Not? Es wußte
nicht, was das Leben war, darum
A. Bartholome. Aux Morts. Linke Seitengruppe.
420
nicht auf das Licht des Lebens, sondern auf
das Dunkel des Todes. Als Krönung müßte es
den „heimlichen Kaiser“ der Welt mit der
Hippe tragen, wie er mit finstrem Lächeln kalt
und grausam auf die Menschen schaut, die er
für sein Reich sammelt.
Das Grabmal aux Morts, eins der eigen-
artigsten Denkmäler unserer Zeit, hat ein Maler
geschaffen, der zum Bildhauer wurde, als der
Tod ihn im Innersten seines Lebens getroffen
hatte. Er verschwindet nach dem Tode seiner
geliebten Frau aus der Öffentlichkeit, und er
erscheint auch nicht wieder, nachdem er in der
Stille seiner Lebensgefährtin ein eigenartiges
Denkmal geschaffen hat, sondern seine wunde
Seele will sich weiter aussprechen, ausklagen.
Denen allen, die unter den Schlägen des Todes
zusammenbrechen und den schweren Weg ins
Dunkel antreten müssen, soll sein Denkmal
gewidmet sein: der leidenden, sterbenden
Menschheit.
Das Ganze ist so unabsichtlich rein in seiner
künstlerischen Wirkung, auch da, wo sein Geist
dem Empfinden unsers Volkes fremd ist.
Denn allerdings es geht etwas Müdes und
Schweres durch dies Werk, fast möchte ich
sagen, daß indisch-buddhistischer Geist eben-
soviel Anteil daran habe, als germanisch-christ-
licher, als ob Arbeiten und Wirken etwas
Minderwertiges sei gegenüber dem Erleiden und
der Besinnlichkeit. Das Grundgefühl des Buddha
Gautama, daß alles Leben Leiden ist, daß
hinter allem Blühen ein Welken, hinter allem
Gewinnen ein Verlieren steht und hinter allem
Leben der Tod, kann fast nicht ernster und
eindringlicher dargestellt werden. Das ist
der „mystische Hauch einer unbestimmbaren
Frömmigkeit“, von der L. Benedite nach der
Enthüllung in Art et Decoration sprach.
An einer Mauer entlang drängt sich von
beiden Seiten der Zug der Dahinfahrenden zu
der in der Mitte der Mauer sich öffnenden
Todespforte. „Nicht alle sind Sterbende, doch
alle wenden sich der verhängnisvollen Pforte
zu, durch die die beiden Gatten eintreten“, so
hat der Künstler selbst den Zug gedeutet.
Eigenartig sind die Gruppen gebaut, beide von
links nach rechts sich senkend, wohl nicht ohne
symbolische Absicht, denn umgekehrt würde
man unwillkürlich die Empfindung des An-
steigens haben. Zunächst freilich bemerkt man
die Kunst des Aufbaus nicht vor dem inneren
Leben der Gestalten.
Schwer lastet das Todesgeschick auf den
Menschen, auf alt und jung; es hat ihren Trotz
gebrochen, ihren Nacken gebeugt, die Kniee
gelähmt, es zwingt ihnen die Arme und Hände
vor das Antlitz, sie wollen das Grausige nicht
sehen, das ihrer harrt. Gleich links an der
Pforte sitzt eine alte Frau, die Ellbogen auf
die Kniee gestützt, die ineinandergekrampften
Hände gegen das gesenkte Haupt geschlagen.
Ganz seltsam ist das tote Kind, das sie achtlos
über die Schulter gelegt hat. Hat sie es ver-
gessen über der Schwere des eigenen Geschicks?
Ihr gegenüber, rechts, hält sich ein mit ge-
knickten Knieen und gebogenem Rücken stehen-
der Greis an der Steinkante, wie einer, der
sich mit den Händen vorwärts ziehen will, wo
der Fuß zurückbebt. Es ist eine fein belauschte
Gebärde, wie auch wir sie unwillkürlich machen,
wenn statt des bewußten Wollens ein unbe-
wußtes Müssen mit Mühe uns auftreibt und
wir mit den Händen uns im Aufstehen den
Ruck geben, den der müde Geist dem Körper
nicht geben will. Hinter diesem alten Mann
drei Figuren in verschiedenen Graden der
Empfindung, von der ruhigen Gefaßtheit des
knieenden Mädchens, das die zum Kinn er-
hobenen Hände halb fiehend, halb entsagend
gefalten hat und in innerer Seelenstärke Ober-
körper und Haupt gestrafft aufrecht hält, bis
zu der völligen Fassungslosigkeit des
vornübergeworfen am Boden liegenden
Mädchens, das ihr mit einem Tuch
verhülltes Antlitz gegen die Erde preßt,
eine fast unmöglich gewaltsame Lage,
in der nur maßloser Schrecken und
grausige Angst den Menschen fest-
zuhalten vermag. Und zwischen den
beiden hockt ein kleines armseliges
Wesen, von dem man nur den Kopl
von hinten und ein Stück des Rückens
sieht, die rechte Schulter von dem
sich aufstemmenden Arm unschön
hochgedrückt. Es ist keine Menschen-
blüte, die hier geknickt ist. Zur
Blüte ist dies Gewächs nicht ge-
kommen. Ob es überhaupt von dem
Leben schon etwas anderes gehabt
hat, als Leiden und Not? Es wußte
nicht, was das Leben war, darum
A. Bartholome. Aux Morts. Linke Seitengruppe.
420