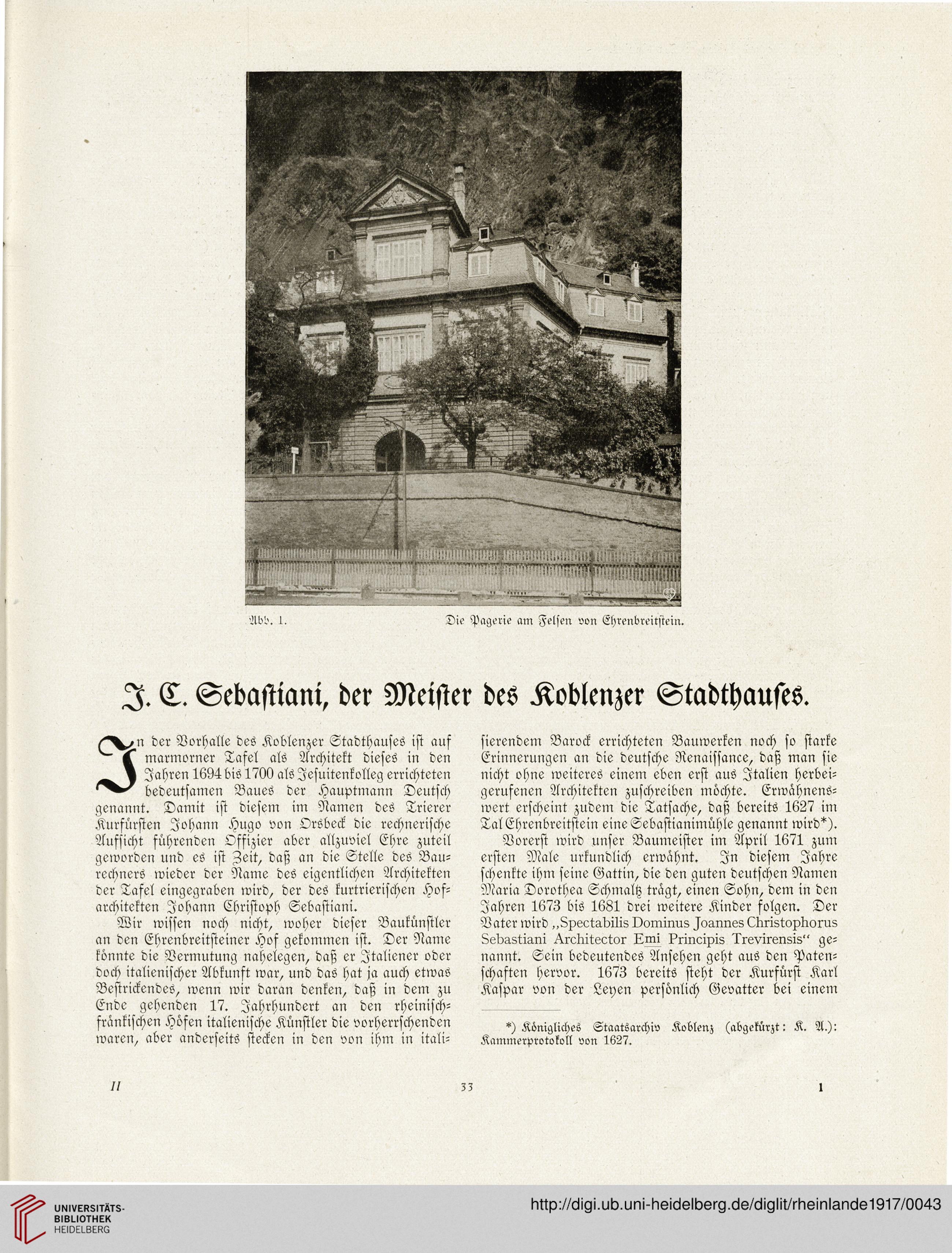Abb. 1.
Die Pagerie am Felsen von Chrenbreitstein.
I. L. Sebastiani, der Meister des Koblenzer Stadthauses.
n der Vorhalle des Koblenzer Stadthauses ist auf
marmorner Tafel als Architekt dieses in den
Jahren 1694 bis 1700 als Jesuitenkolleg errichteten
bedeutsamen Baues der Hauptmann Deutsch
genannt. Damit ist diesem im Namen des Trierer
Kurfürsten Johann Hugo von Orsbeck die rechnerische
Aufsicht führenden Offizier aber allzuviel Ehre zuteil
geworden und es ist Zeit, daß an die Stelle des Bau-
rechners wieder der Name des eigentlichen Architekten
der Tafel eingegraben wird, der des kurtrierischen Hof-
architekten Johann Christoph Sebastiani.
Wir wissen noch nicht, woher dieser Baukünstler
an den Ehrenbreitsteiner Hof gekommen ist. Der Name
könnte die Vermutung nahelegen, daß er Jtaliener oder
doch italienischer Abkunft war, und das hat ja auch etwas
Bestrickendes, wenn wir daran denken, daß in dem zu
Ende gehenden 17. Jahrhundert an den rheinisch-
frankischen Höfen italienische Künstler die vorherrschenden
waren, aber anderseits stecken in den von ihm in itali-
sierendem Barock errichteten Bauwerken noch so starke
Erinnerungen an die deutsche Renaissance, daß man sie
nicht ohne weiteres einem eben erst aus Jtalien herbei-
gerufenen Architekten zuschreiben möchte. Erwahnens-
wert erscheint zudem die Tatsache, daß bereits 1627 im
Tal Ehrenbreitstein eine Sebastianimühle genannt wird*).
Vorerst wird unser Baumeister im April 1671 zunr
ersten Male urkundlich erwähnt. Jn diesem Jahre
schenkte ihnr seine Gattin, die den guten deutschen Namen
Maria Dorothea Schmaltz trägt, einen Sohn, dem in den
Jahren 1673 bis 1681 drei weitere Kinder folgen. Der
Vater wird „8pectLl>i1i5 Oorninus stoLuucs Lkiristopkiorus
8e1>g,stig,ui tlrckiitector Omi k'riucipis Drsvireusis" ge-
nannt. Sein bedeutendes Ansehen geht aus den Paten-
schaften hervor. 1673 bereits steht der Kurfürst Karl
Kaspar von der Leyen persönlich Gevatter bei einem
*) Königliches Staatsarchiv Koblenz (abgekürzt: K. A.):
Kammerprotokoll von 1627.
//
l
Die Pagerie am Felsen von Chrenbreitstein.
I. L. Sebastiani, der Meister des Koblenzer Stadthauses.
n der Vorhalle des Koblenzer Stadthauses ist auf
marmorner Tafel als Architekt dieses in den
Jahren 1694 bis 1700 als Jesuitenkolleg errichteten
bedeutsamen Baues der Hauptmann Deutsch
genannt. Damit ist diesem im Namen des Trierer
Kurfürsten Johann Hugo von Orsbeck die rechnerische
Aufsicht führenden Offizier aber allzuviel Ehre zuteil
geworden und es ist Zeit, daß an die Stelle des Bau-
rechners wieder der Name des eigentlichen Architekten
der Tafel eingegraben wird, der des kurtrierischen Hof-
architekten Johann Christoph Sebastiani.
Wir wissen noch nicht, woher dieser Baukünstler
an den Ehrenbreitsteiner Hof gekommen ist. Der Name
könnte die Vermutung nahelegen, daß er Jtaliener oder
doch italienischer Abkunft war, und das hat ja auch etwas
Bestrickendes, wenn wir daran denken, daß in dem zu
Ende gehenden 17. Jahrhundert an den rheinisch-
frankischen Höfen italienische Künstler die vorherrschenden
waren, aber anderseits stecken in den von ihm in itali-
sierendem Barock errichteten Bauwerken noch so starke
Erinnerungen an die deutsche Renaissance, daß man sie
nicht ohne weiteres einem eben erst aus Jtalien herbei-
gerufenen Architekten zuschreiben möchte. Erwahnens-
wert erscheint zudem die Tatsache, daß bereits 1627 im
Tal Ehrenbreitstein eine Sebastianimühle genannt wird*).
Vorerst wird unser Baumeister im April 1671 zunr
ersten Male urkundlich erwähnt. Jn diesem Jahre
schenkte ihnr seine Gattin, die den guten deutschen Namen
Maria Dorothea Schmaltz trägt, einen Sohn, dem in den
Jahren 1673 bis 1681 drei weitere Kinder folgen. Der
Vater wird „8pectLl>i1i5 Oorninus stoLuucs Lkiristopkiorus
8e1>g,stig,ui tlrckiitector Omi k'riucipis Drsvireusis" ge-
nannt. Sein bedeutendes Ansehen geht aus den Paten-
schaften hervor. 1673 bereits steht der Kurfürst Karl
Kaspar von der Leyen persönlich Gevatter bei einem
*) Königliches Staatsarchiv Koblenz (abgekürzt: K. A.):
Kammerprotokoll von 1627.
//
l