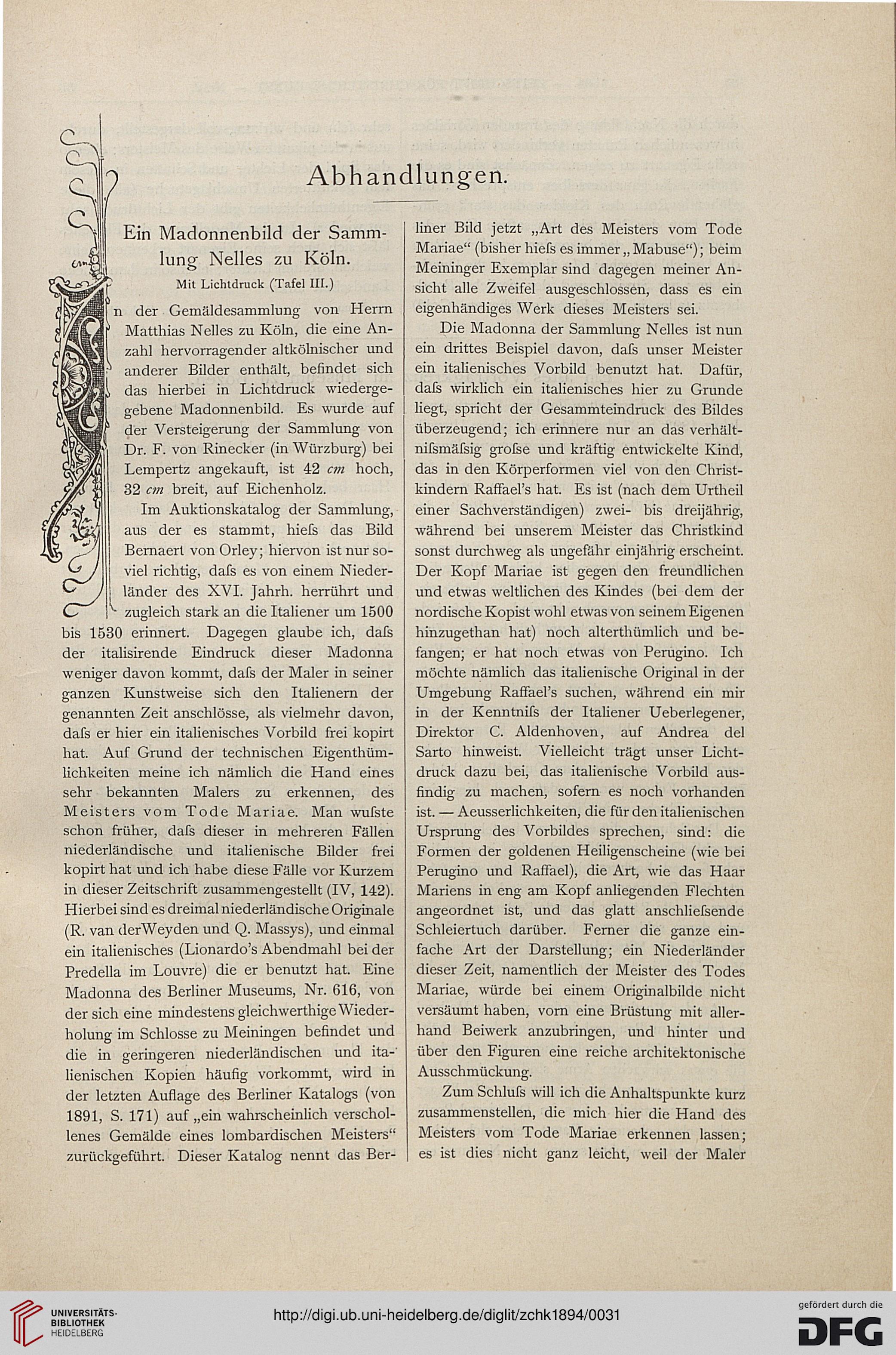c_
Abhandlungen.-
Ol»
Ein Madonnenbild der Samm-
lung Nelles zu Köln.
Mit Lichtdruck (Tafel III.)
n der Gemäldesammlung von Herrn
Matthias Nelles zu Köln, die eine An-
zahl hervorragender altkölnischer und
anderer Bilder enthält, befindet sich
das hierbei in Lichtdruck wiederge-
gebene Madonnenbild. Es wurde auf
der Versteigerung der Sammlung von
Dr. F. von Rinecker (in Würzburg) bei
Lempertz angekauft, ist 42 c?n hoch,
32 cm breit, auf Eichenholz.
Im Auktionskatalog der Sammlung,
aus der es stammt, hiefs das Bild
Bemaert von Orley; hiervon ist nur so-
viel richtig, dafs es von einem Nieder-
*"* J I länder des XVI. Jahrh. herrührt und
C ^ zugleich stark an die Italiener um 1500
bis 1530 erinnert. Dagegen glaube ich, dafs
der italisirende Eindruck dieser Madonna
weniger davon kommt, dafs der Maler in seiner
ganzen Kunstweise sich den Italienern der
genannten Zeit anschlösse, als vielmehr davon,
dafs er hier ein italienisches Vorbild frei kopirt
hat. Auf Grund der technischen Eigenthüm-
lichkeiten meine ich nämlich die Hand eines
sehr bekannten Malers zu erkennen, des
Meisters vom Tode Mariae. Man wufste
schon früher, dafs dieser in mehreren Fällen
niederländische und italienische Bilder frei
kopirt hat und ich habe diese Fälle vor Kurzem
in dieser Zeitschrift zusammengestellt (IV, 142).
Hierbei sind es dreimal niederländische Originale
(R. van derWeyden und Q. Massys), und einmal
ein italienisches (Lionardo's Abendmahl bei der
Predella im Louvre) die er benutzt hat. Eine
Madonna des Berliner Museums, Nr. 616, von
der sich eine mindestens gleichwerthige Wieder-
holung im Schlosse zu Meiningen befindet und
die in geringeren niederländischen und ita-
lienischen Kopien häufig vorkommt, wird in
der letzten Auflage des Berliner Katalogs (von
1891, S. 171) auf „ein wahrscheinlich verschol-
lenes Gemälde eines lombardischen Meisters"
zurückgeführt. Dieser Katalog nennt das Ber-
liner Bild jetzt „Art des Meisters vom Tode
Mariae" (bisher hiefs es immer „ Mabuse"); beim
Meininger Exemplar sind dagegen meiner An-
sicht alle Zweifel ausgeschlossen, dass es ein
eigenhändiges Werk dieses Meisters sei.
Die Madonna der Sammlung Nelles ist nun
ein drittes Beispiel davon, dafs unser Meister
ein italienisches Vorbild benutzt hat. Dafür,
dafs wirklich ein italienisches hier zu Grunde
liegt, spricht der Gesammteindruck des Bildes
überzeugend; ich erinnere nur an das verhält-
nifsmäfsig grofse und kräftig entwickelte Kind,
das in den Körperformen viel von den Christ-
kindern Rafläel's hat. Es ist (nach dem Urtheil
einer Sachverständigen) zwei- bis dreijährig,
während bei unserem Meister das Christkind
sonst durchweg als ungefähr einjährig erscheint.
Der Kopf Mariae ist gegen den freundlichen
und etwas weltlichen des Kindes (bei dem der
nordische Kopist wohl etwas von seinem Eigenen
hinzugethan hat) noch alterthümlich und be-
fangen; er hat noch etwas von Perugino. Ich
möchte nämlich das italienische Original in der
Umgebung Raffael's suchen, während ein mir
in der Kenntnifs der Italiener Ueberlegener,
Direktor C. Aldenhoven, auf Andrea del
Sarto hinweist. Vielleicht trägt unser Licht-
druck dazu bei, das italienische Vorbild aus-
findig zu machen, sofern es noch vorhanden
ist. — Aeusserlichkeiten, die für den italienischen
Ursprung des Vorbildes sprechen, sind: die
Formen der goldenen Heiligenscheine (wie bei
Perugino und Raffael), die Art, wie das Haar
Mariens in eng am Kopf anliegenden Flechten
angeordnet ist, und das glatt anschliefsende
Schleiertuch darüber. Ferner die ganze ein-
fache Art der Darstellung; ein Niederländer
dieser Zeit, namentlich der Meister des Todes
Mariae, würde bei einem Originalbilde nicht
versäumt haben, vorn eine Brüstung mit aller-
hand Beiwerk anzubringen, und hinter und
über den Figuren eine reiche architektonische
Ausschmückung.
Zum Schlufs will ich die Anhaltspunkte kurz
zusammenstellen, die mich hier die Hand des
Meisters vom Tode Mariae erkennen lassen;
es ist dies nicht ganz leicht, weil der Maler
Abhandlungen.-
Ol»
Ein Madonnenbild der Samm-
lung Nelles zu Köln.
Mit Lichtdruck (Tafel III.)
n der Gemäldesammlung von Herrn
Matthias Nelles zu Köln, die eine An-
zahl hervorragender altkölnischer und
anderer Bilder enthält, befindet sich
das hierbei in Lichtdruck wiederge-
gebene Madonnenbild. Es wurde auf
der Versteigerung der Sammlung von
Dr. F. von Rinecker (in Würzburg) bei
Lempertz angekauft, ist 42 c?n hoch,
32 cm breit, auf Eichenholz.
Im Auktionskatalog der Sammlung,
aus der es stammt, hiefs das Bild
Bemaert von Orley; hiervon ist nur so-
viel richtig, dafs es von einem Nieder-
*"* J I länder des XVI. Jahrh. herrührt und
C ^ zugleich stark an die Italiener um 1500
bis 1530 erinnert. Dagegen glaube ich, dafs
der italisirende Eindruck dieser Madonna
weniger davon kommt, dafs der Maler in seiner
ganzen Kunstweise sich den Italienern der
genannten Zeit anschlösse, als vielmehr davon,
dafs er hier ein italienisches Vorbild frei kopirt
hat. Auf Grund der technischen Eigenthüm-
lichkeiten meine ich nämlich die Hand eines
sehr bekannten Malers zu erkennen, des
Meisters vom Tode Mariae. Man wufste
schon früher, dafs dieser in mehreren Fällen
niederländische und italienische Bilder frei
kopirt hat und ich habe diese Fälle vor Kurzem
in dieser Zeitschrift zusammengestellt (IV, 142).
Hierbei sind es dreimal niederländische Originale
(R. van derWeyden und Q. Massys), und einmal
ein italienisches (Lionardo's Abendmahl bei der
Predella im Louvre) die er benutzt hat. Eine
Madonna des Berliner Museums, Nr. 616, von
der sich eine mindestens gleichwerthige Wieder-
holung im Schlosse zu Meiningen befindet und
die in geringeren niederländischen und ita-
lienischen Kopien häufig vorkommt, wird in
der letzten Auflage des Berliner Katalogs (von
1891, S. 171) auf „ein wahrscheinlich verschol-
lenes Gemälde eines lombardischen Meisters"
zurückgeführt. Dieser Katalog nennt das Ber-
liner Bild jetzt „Art des Meisters vom Tode
Mariae" (bisher hiefs es immer „ Mabuse"); beim
Meininger Exemplar sind dagegen meiner An-
sicht alle Zweifel ausgeschlossen, dass es ein
eigenhändiges Werk dieses Meisters sei.
Die Madonna der Sammlung Nelles ist nun
ein drittes Beispiel davon, dafs unser Meister
ein italienisches Vorbild benutzt hat. Dafür,
dafs wirklich ein italienisches hier zu Grunde
liegt, spricht der Gesammteindruck des Bildes
überzeugend; ich erinnere nur an das verhält-
nifsmäfsig grofse und kräftig entwickelte Kind,
das in den Körperformen viel von den Christ-
kindern Rafläel's hat. Es ist (nach dem Urtheil
einer Sachverständigen) zwei- bis dreijährig,
während bei unserem Meister das Christkind
sonst durchweg als ungefähr einjährig erscheint.
Der Kopf Mariae ist gegen den freundlichen
und etwas weltlichen des Kindes (bei dem der
nordische Kopist wohl etwas von seinem Eigenen
hinzugethan hat) noch alterthümlich und be-
fangen; er hat noch etwas von Perugino. Ich
möchte nämlich das italienische Original in der
Umgebung Raffael's suchen, während ein mir
in der Kenntnifs der Italiener Ueberlegener,
Direktor C. Aldenhoven, auf Andrea del
Sarto hinweist. Vielleicht trägt unser Licht-
druck dazu bei, das italienische Vorbild aus-
findig zu machen, sofern es noch vorhanden
ist. — Aeusserlichkeiten, die für den italienischen
Ursprung des Vorbildes sprechen, sind: die
Formen der goldenen Heiligenscheine (wie bei
Perugino und Raffael), die Art, wie das Haar
Mariens in eng am Kopf anliegenden Flechten
angeordnet ist, und das glatt anschliefsende
Schleiertuch darüber. Ferner die ganze ein-
fache Art der Darstellung; ein Niederländer
dieser Zeit, namentlich der Meister des Todes
Mariae, würde bei einem Originalbilde nicht
versäumt haben, vorn eine Brüstung mit aller-
hand Beiwerk anzubringen, und hinter und
über den Figuren eine reiche architektonische
Ausschmückung.
Zum Schlufs will ich die Anhaltspunkte kurz
zusammenstellen, die mich hier die Hand des
Meisters vom Tode Mariae erkennen lassen;
es ist dies nicht ganz leicht, weil der Maler