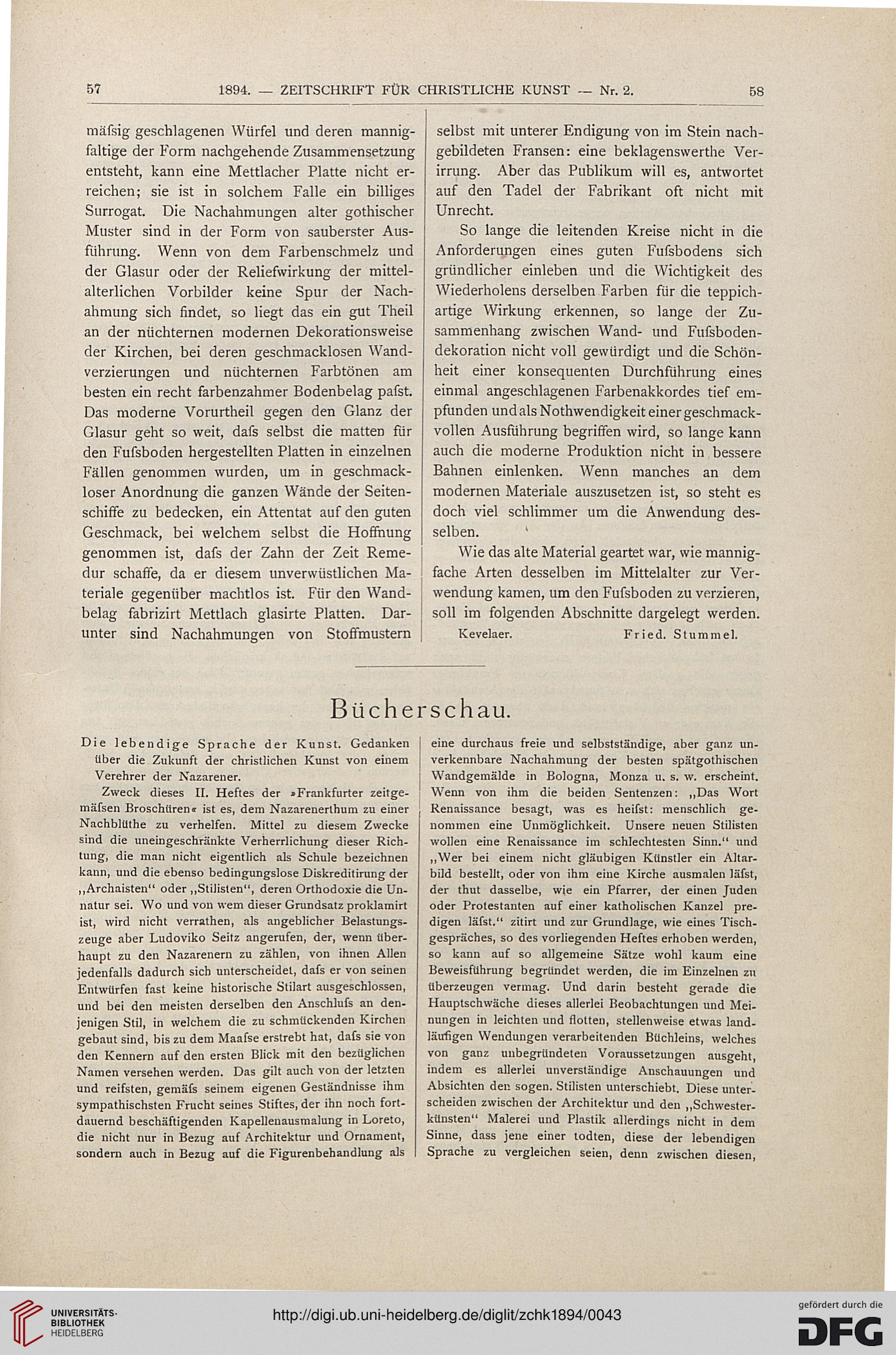57
1894.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST
Nr. 2.
58
mäfsig geschlagenen Würfel und deren mannig-
faltige der Form nachgehende Zusammensetzung
entsteht, kann eine Mettlacher Platte nicht er-
reichen; sie ist in solchem Falle ein billiges
Surrogat. Die Nachahmungen alter gothischer
Muster sind in der Form von sauberster Aus-
führung. Wenn von dem Farbenschmelz und
der Glasur oder der Reliefwirkung der mittel-
alterlichen Vorbilder keine Spur der Nach-
ahmung sich findet, so liegt das ein gut Theil
an der nüchternen modernen Dekorationsweise
der Kirchen, bei deren geschmacklosen Wand-
verzierungen und nüchternen Farbtönen am
besten ein recht farbenzahmer Bodenbelag pafst.
Das moderne Vorurtheil gegen den Glanz der
Glasur geht so weit, dafs selbst die matten für
den Fufsboden hergestellten Platten in einzelnen
Fällen genommen wurden, um in geschmack-
loser Anordnung die ganzen Wände der Seiten-
schiffe zu bedecken, ein Attentat auf den guten
Geschmack, bei welchem selbst die Hoffnung
genommen ist, dafs der Zahn der Zeit Reme-
dur schaffe, da er diesem unverwüstlichen Ma-
teriale gegenüber machtlos ist. Für den Wand-
belag fabrizirt Mettlach glasirte Platten. Dar-
unter sind Nachahmungen von Stoffmustern
selbst mit unterer Endigung von im Stein nach-
gebildeten Fransen: eine beklagenswerthe Ver-
irrung. Aber das Publikum will es, antwortet
auf den Tadel der Fabrikant oft nicht mit
Unrecht.
So lange die leitenden Kreise nicht in die
Anforderungen eines guten Fufsbodens sich
gründlicher einleben und die Wichtigkeit des
Wiederholens derselben Farben für die teppich-
artige Wirkung erkennen, so lange der Zu-
sammenhang zwischen Wand- und Fufsboden-
dekoration nicht voll gewürdigt und die Schön-
heit einer konsequenten Durchführung eines
einmal angeschlagenen Farbenakkordes tief em-
pfunden und als Nothwendigkeit einer geschmack-
vollen Ausführung begriffen wird, so lange kann
auch die moderne Produktion nicht in bessere
Bahnen einlenken. Wenn manches an dem
modernen Materiale auszusetzen ist, so steht es
doch viel schlimmer um die Anwendung des-
selben. l
Wie das alte Material geartet war, wie mannig-
fache Arten desselben im Mittelalter zur Ver-
wendung kamen, um den Fufsboden zu verzieren,
soll im folgenden Abschnitte dargelegt werden.
Kevelaer. Fried. Stummel.
Bücherschau.
Die lebendige Sprache der Kunst. Gedanken
über die Zukunft der christlichen Kunst von einem
Verehrer der Nazarener.
Zweck dieses II. Heftes der »Frankfurter zeitge-
mäfsen Broschüren« ist es, dem Nazarenerthum zu einer
Nachblilthe zu verhelfen. Mittel zu diesem Zwecke
sind die uneingeschränkte Verherrlichung dieser Rich-
tung, die man nicht eigentlich als Schule bezeichnen
kann, und die ebenso bedingungslose Diskreditirung der
„Archaisten" oder „Stilisten", deren Orthodoxie die Un-
natur sei. Wo und von wem dieser Grundsatz proklamirt
ist, wird nicht verrathen, als angeblicher Belastungs-
zeuge aber Ludoviko Seitz angerufen, der, wenn über-
haupt zu den Nazarenern zu zählen, von ihnen Allen
jedenfalls dadurch sich unterscheidet, dafs er von seinen
Entwürfen fast keine historische Stilart ausgeschlossen,
und bei den meisten derselben den Anschlufs an den-
jenigen Stil, in welchem die zu schmückenden Kirchen
gebaut sind, bis zu dem Maafse erstrebt hat, dafs sie von
den Kennern auf den ersten Blick mit den bezüglichen
Namen versehen werden. Das gilt auch von der letzten
und reifsten, gemäfs seinem eigenen Geständnisse ihm
sympathischsten Frucht seines Stiftes, der ihn noch fort-
dauernd beschäftigenden Kapellenausmalung in Loreto,
die nicht nur in Bezug auf Architektur und Ornament,
sondern auch in Bezug auf die Figurenbehandlung als
[ eine durchaus freie und selbstständige, aber ganz un-
verkennbare Nachahmung der besten spätgothischen
i Wandgemälde in Bologna, Monza u. s. w. erscheint.
Wenn von ihm die beiden Sentenzen: „Das Wort
Renaissance besagt, was es heifst: menschlich ge-
nommen eine Unmöglichkeit. Unsere neuen Stilisten
wollen eine Renaissance im schlechtesten Sinn." und
„Wer bei einem nicht gläubigen Künstler ein Altar-
bild bestellt, oder von ihm eine Kirche ausmalen läfst,
der thut dasselbe, wie ein Pfarrer, der einen Juden
oder Protestanten auf einer katholischen Kanzel pre-
digen läfst." zitirt und zur Grundlage, wie eines Tisch-
gespräches, so des vorliegenden Heftes erhoben werden,
so kann auf so allgemeine Sätze wohl kaum eine
Beweisführung begründet werden, die im Einzelnen zu
überzeugen vermag. Und darin besteht gerade die
Hauptschwäche dieses allerlei Beobachtungen und Mei-
nungen in leichten und flotten, stellenweise etwas land-
läufigen Wendungen verarbeitenden Büchleins, welches
von ganz unbegründeten Voraussetzungen ausgeht,
indem es allerlei unverständige Anschauungen und
Absichten den sogen. Stilisten unterschiebt. Diese unter-
scheiden zwischen der Architektur und den „Schwester-
küusten" Malerei und Plastik allerdings nicht in dem
Sinne, dass jene einer lodten, diese der lebendigen
Sprache zu vergleichen seien, denn zwischen diesen,
1894.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST
Nr. 2.
58
mäfsig geschlagenen Würfel und deren mannig-
faltige der Form nachgehende Zusammensetzung
entsteht, kann eine Mettlacher Platte nicht er-
reichen; sie ist in solchem Falle ein billiges
Surrogat. Die Nachahmungen alter gothischer
Muster sind in der Form von sauberster Aus-
führung. Wenn von dem Farbenschmelz und
der Glasur oder der Reliefwirkung der mittel-
alterlichen Vorbilder keine Spur der Nach-
ahmung sich findet, so liegt das ein gut Theil
an der nüchternen modernen Dekorationsweise
der Kirchen, bei deren geschmacklosen Wand-
verzierungen und nüchternen Farbtönen am
besten ein recht farbenzahmer Bodenbelag pafst.
Das moderne Vorurtheil gegen den Glanz der
Glasur geht so weit, dafs selbst die matten für
den Fufsboden hergestellten Platten in einzelnen
Fällen genommen wurden, um in geschmack-
loser Anordnung die ganzen Wände der Seiten-
schiffe zu bedecken, ein Attentat auf den guten
Geschmack, bei welchem selbst die Hoffnung
genommen ist, dafs der Zahn der Zeit Reme-
dur schaffe, da er diesem unverwüstlichen Ma-
teriale gegenüber machtlos ist. Für den Wand-
belag fabrizirt Mettlach glasirte Platten. Dar-
unter sind Nachahmungen von Stoffmustern
selbst mit unterer Endigung von im Stein nach-
gebildeten Fransen: eine beklagenswerthe Ver-
irrung. Aber das Publikum will es, antwortet
auf den Tadel der Fabrikant oft nicht mit
Unrecht.
So lange die leitenden Kreise nicht in die
Anforderungen eines guten Fufsbodens sich
gründlicher einleben und die Wichtigkeit des
Wiederholens derselben Farben für die teppich-
artige Wirkung erkennen, so lange der Zu-
sammenhang zwischen Wand- und Fufsboden-
dekoration nicht voll gewürdigt und die Schön-
heit einer konsequenten Durchführung eines
einmal angeschlagenen Farbenakkordes tief em-
pfunden und als Nothwendigkeit einer geschmack-
vollen Ausführung begriffen wird, so lange kann
auch die moderne Produktion nicht in bessere
Bahnen einlenken. Wenn manches an dem
modernen Materiale auszusetzen ist, so steht es
doch viel schlimmer um die Anwendung des-
selben. l
Wie das alte Material geartet war, wie mannig-
fache Arten desselben im Mittelalter zur Ver-
wendung kamen, um den Fufsboden zu verzieren,
soll im folgenden Abschnitte dargelegt werden.
Kevelaer. Fried. Stummel.
Bücherschau.
Die lebendige Sprache der Kunst. Gedanken
über die Zukunft der christlichen Kunst von einem
Verehrer der Nazarener.
Zweck dieses II. Heftes der »Frankfurter zeitge-
mäfsen Broschüren« ist es, dem Nazarenerthum zu einer
Nachblilthe zu verhelfen. Mittel zu diesem Zwecke
sind die uneingeschränkte Verherrlichung dieser Rich-
tung, die man nicht eigentlich als Schule bezeichnen
kann, und die ebenso bedingungslose Diskreditirung der
„Archaisten" oder „Stilisten", deren Orthodoxie die Un-
natur sei. Wo und von wem dieser Grundsatz proklamirt
ist, wird nicht verrathen, als angeblicher Belastungs-
zeuge aber Ludoviko Seitz angerufen, der, wenn über-
haupt zu den Nazarenern zu zählen, von ihnen Allen
jedenfalls dadurch sich unterscheidet, dafs er von seinen
Entwürfen fast keine historische Stilart ausgeschlossen,
und bei den meisten derselben den Anschlufs an den-
jenigen Stil, in welchem die zu schmückenden Kirchen
gebaut sind, bis zu dem Maafse erstrebt hat, dafs sie von
den Kennern auf den ersten Blick mit den bezüglichen
Namen versehen werden. Das gilt auch von der letzten
und reifsten, gemäfs seinem eigenen Geständnisse ihm
sympathischsten Frucht seines Stiftes, der ihn noch fort-
dauernd beschäftigenden Kapellenausmalung in Loreto,
die nicht nur in Bezug auf Architektur und Ornament,
sondern auch in Bezug auf die Figurenbehandlung als
[ eine durchaus freie und selbstständige, aber ganz un-
verkennbare Nachahmung der besten spätgothischen
i Wandgemälde in Bologna, Monza u. s. w. erscheint.
Wenn von ihm die beiden Sentenzen: „Das Wort
Renaissance besagt, was es heifst: menschlich ge-
nommen eine Unmöglichkeit. Unsere neuen Stilisten
wollen eine Renaissance im schlechtesten Sinn." und
„Wer bei einem nicht gläubigen Künstler ein Altar-
bild bestellt, oder von ihm eine Kirche ausmalen läfst,
der thut dasselbe, wie ein Pfarrer, der einen Juden
oder Protestanten auf einer katholischen Kanzel pre-
digen läfst." zitirt und zur Grundlage, wie eines Tisch-
gespräches, so des vorliegenden Heftes erhoben werden,
so kann auf so allgemeine Sätze wohl kaum eine
Beweisführung begründet werden, die im Einzelnen zu
überzeugen vermag. Und darin besteht gerade die
Hauptschwäche dieses allerlei Beobachtungen und Mei-
nungen in leichten und flotten, stellenweise etwas land-
läufigen Wendungen verarbeitenden Büchleins, welches
von ganz unbegründeten Voraussetzungen ausgeht,
indem es allerlei unverständige Anschauungen und
Absichten den sogen. Stilisten unterschiebt. Diese unter-
scheiden zwischen der Architektur und den „Schwester-
küusten" Malerei und Plastik allerdings nicht in dem
Sinne, dass jene einer lodten, diese der lebendigen
Sprache zu vergleichen seien, denn zwischen diesen,