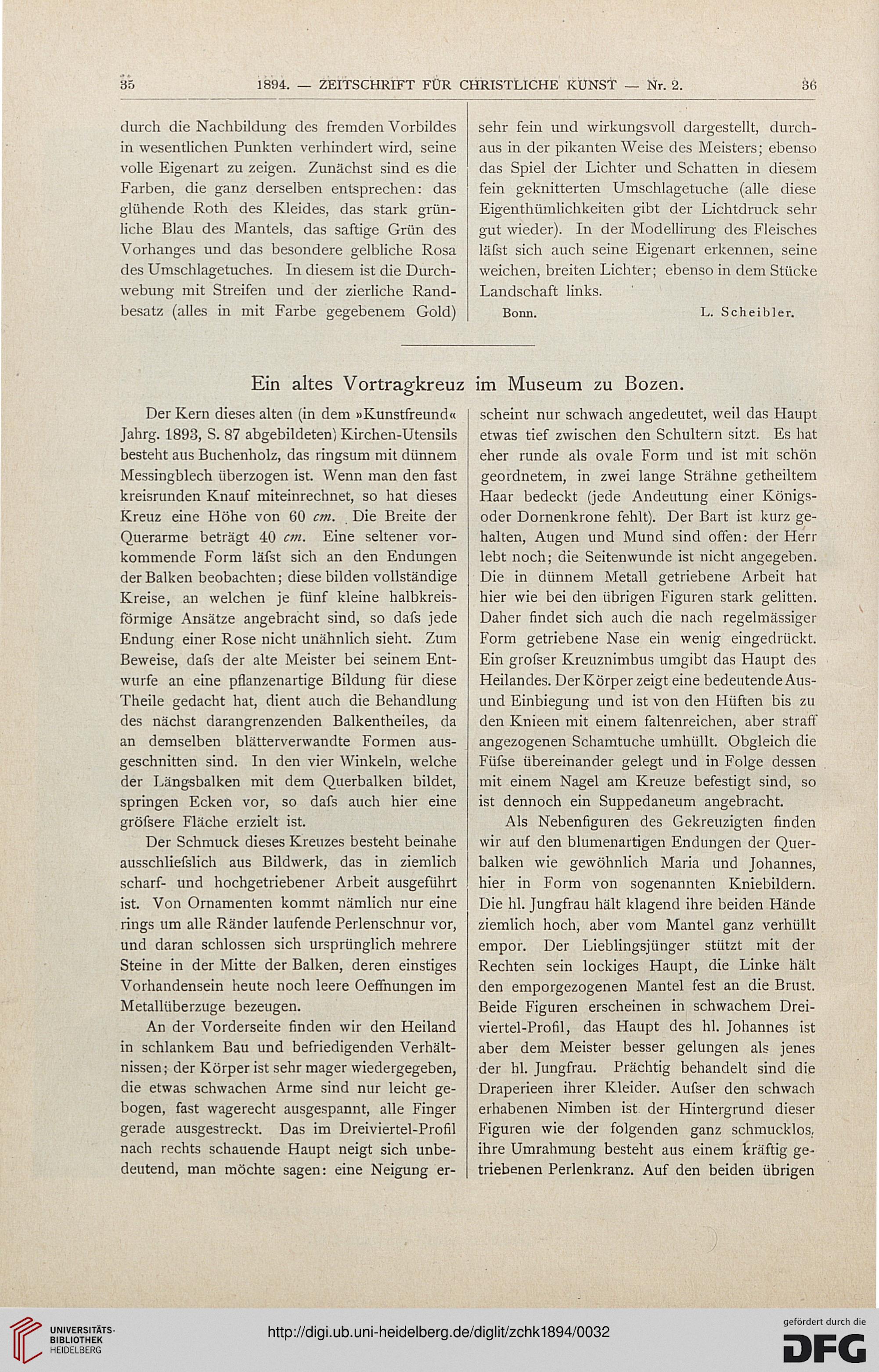35
1894. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST _ Nr. 2.
36
durch die Nachbildung des fremden Vorbildes
in wesentlichen Punkten verhindert wird, seine
volle Eigenart zu zeigen. Zunächst sind es die
Farben, die ganz derselben entsprechen: das
glühende Roth des Kleides, das stark grün-
liche Blau des Mantels, das saftige Grün des
Vorhanges und das besondere gelbliche Rosa
des Umschlagetuches. In diesem ist die Durch-
webung mit Streifen und der zierliche Rand-
besatz (alles in mit Farbe gegebenem Gold)
sehr fein und wirkungsvoll dargestellt, durch-
aus in der pikanten Weise des Meisters; ebenso
das Spiel der Lichter und Schatten in diesem
fein geknitterten Umschlagetuche (alle diese
Eigenthümlichkeiten gibt der Lichtdruck sehr
gut wieder). In der Modellirung des Fleisches
Iäfst sich auch seine Eigenart erkennen, seine
weichen, breiten Lichter; ebenso in dem Stücke
Landschaft links.
Bonn. L. Scheibler.
Ein altes Vortragkreuz im Museum zu Bozen.
Der Kern dieses alten (in dem »Kunstfreund«
Jahrg. 1893, S. 87 abgebildeten) Kirchen-Utensils
besteht aus Buchenholz, das ringsum mit dünnem
Messingblech überzogen ist. Wenn man den fast
kreisrunden Knauf miteinrechnet, so hat dieses
Kreuz eine Höhe von 60 cm. Die Breite der
Querarme beträgt 40 cm. Eine seltener vor-
kommende Form läfst sich an den Endungen
der Balken beobachten; diese bilden vollständige
Kreise, an welchen je fünf kleine halbkreis-
förmige Ansätze angebracht sind, so dafs jede
Endung einer Rose nicht unähnlich sieht. Zum
Beweise, dafs der alte Meister bei seinem Ent-
würfe an eine pflanzenartige Bildung für diese
Theile gedacht hat, dient auch die Behandlung
des nächst darangrenzenden Balkentheiles, da
an demselben blätterverwandte Formen aus-
geschnitten sind. In den vier Winkeln, welche
der Längsbalken mit dem Querbalken bildet,
springen Ecken vor, so dafs auch hier eine
gröfsere Fläche erzielt ist.
Der Schmuck dieses Kreuzes besteht beinahe
ausschliefslich aus Bildwerk, das in ziemlich
scharf- und hochgetriebener Arbeit ausgeführt
ist. Von Ornamenten kommt nämlich nur eine
rings um alle Ränder laufende Perlenschnur vor,
und daran schlössen sich ursprünglich mehrere
Steine in der Mitte der Balken, deren einstiges
Vorhandensein heute noch leere Oeffhungen im
Metallüberzuge bezeugen.
An der Vorderseite finden wir den Heiland
in schlankem Bau und befriedigenden Verhält-
nissen; der Körper ist sehr mager wiedergegeben,
die etwas schwachen Arme sind nur leicht ge-
bogen, fast wagerecht ausgespannt, alle Finger
gerade ausgestreckt. Das im Dreiviertel-Profil
nach rechts schauende Haupt neigt sich unbe-
deutend, man möchte sagen: eine Neigung er-
scheint nur schwach angedeutet, weil das Haupt
etwas tief zwischen den Schultern sitzt. Es hat
eher runde als ovale Form und ist mit schön
geordnetem, in zwei lange Strähne getheiltem
Haar bedeckt (jede Andeutung einer Königs-
oder Dornenkrone fehlt). Der Bart ist kurz ge-
halten, Augen und Mund sind offen: der Herr
lebt noch; die Seitenwunde ist nicht angegeben.
Die in dünnem Metall getriebene Arbeit hat
hier wie bei den übrigen Figuren stark gelitten.
Daher findet sich auch die nach regelmässiger
Form getriebene Nase ein wenig eingedrückt.
Ein grofser Kreuznimbus umgibt das Haupt des
Heilandes. Der Körper zeigt eine bedeutende Aus-
und Einbiegung und ist von den Hüften bis zu
den Knieen mit einem faltenreichen, aber straf!'
angezogenen Schamtuche umhüllt. Obgleich die
Füfse übereinander gelegt und in Folge dessen
mit einem Nagel am Kreuze befestigt sind, so
ist dennoch ein Suppedaneum angebracht.
Als Nebenfiguren des Gekreuzigten finden
wir auf den blumenartigen Endungen der Quer-
balken wie gewöhnlich Maria und Johannes,
hier in Form von sogenannten Kniebildern.
Die hl. Jungfrau hält klagend ihre beiden Hände
ziemlich hoch, aber vom Mantel ganz verhüllt
empor. Der Lieblingsjünger stützt mit der
Rechten sein lockiges Haupt, die Linke hält
den emporgezogenen Mantel fest an die Brust.
Beide Figuren erscheinen in schwachem Drei-
viertel-Profil, das Haupt des hl. Johannes ist
aber dem Meister besser gelungen als jenes
der hl. Jungfrau. Prächtig behandelt sind die
Draperieen ihrer Kleider. Aufser den schwach
erhabenen Nimben ist der Hintergrund dieser
Figuren wie der folgenden ganz schmucklos,
ihre Umrahmung besteht aus einem kräftig ge-
triebenen Perlenkranz. Auf den beiden übrigen
1894. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST _ Nr. 2.
36
durch die Nachbildung des fremden Vorbildes
in wesentlichen Punkten verhindert wird, seine
volle Eigenart zu zeigen. Zunächst sind es die
Farben, die ganz derselben entsprechen: das
glühende Roth des Kleides, das stark grün-
liche Blau des Mantels, das saftige Grün des
Vorhanges und das besondere gelbliche Rosa
des Umschlagetuches. In diesem ist die Durch-
webung mit Streifen und der zierliche Rand-
besatz (alles in mit Farbe gegebenem Gold)
sehr fein und wirkungsvoll dargestellt, durch-
aus in der pikanten Weise des Meisters; ebenso
das Spiel der Lichter und Schatten in diesem
fein geknitterten Umschlagetuche (alle diese
Eigenthümlichkeiten gibt der Lichtdruck sehr
gut wieder). In der Modellirung des Fleisches
Iäfst sich auch seine Eigenart erkennen, seine
weichen, breiten Lichter; ebenso in dem Stücke
Landschaft links.
Bonn. L. Scheibler.
Ein altes Vortragkreuz im Museum zu Bozen.
Der Kern dieses alten (in dem »Kunstfreund«
Jahrg. 1893, S. 87 abgebildeten) Kirchen-Utensils
besteht aus Buchenholz, das ringsum mit dünnem
Messingblech überzogen ist. Wenn man den fast
kreisrunden Knauf miteinrechnet, so hat dieses
Kreuz eine Höhe von 60 cm. Die Breite der
Querarme beträgt 40 cm. Eine seltener vor-
kommende Form läfst sich an den Endungen
der Balken beobachten; diese bilden vollständige
Kreise, an welchen je fünf kleine halbkreis-
förmige Ansätze angebracht sind, so dafs jede
Endung einer Rose nicht unähnlich sieht. Zum
Beweise, dafs der alte Meister bei seinem Ent-
würfe an eine pflanzenartige Bildung für diese
Theile gedacht hat, dient auch die Behandlung
des nächst darangrenzenden Balkentheiles, da
an demselben blätterverwandte Formen aus-
geschnitten sind. In den vier Winkeln, welche
der Längsbalken mit dem Querbalken bildet,
springen Ecken vor, so dafs auch hier eine
gröfsere Fläche erzielt ist.
Der Schmuck dieses Kreuzes besteht beinahe
ausschliefslich aus Bildwerk, das in ziemlich
scharf- und hochgetriebener Arbeit ausgeführt
ist. Von Ornamenten kommt nämlich nur eine
rings um alle Ränder laufende Perlenschnur vor,
und daran schlössen sich ursprünglich mehrere
Steine in der Mitte der Balken, deren einstiges
Vorhandensein heute noch leere Oeffhungen im
Metallüberzuge bezeugen.
An der Vorderseite finden wir den Heiland
in schlankem Bau und befriedigenden Verhält-
nissen; der Körper ist sehr mager wiedergegeben,
die etwas schwachen Arme sind nur leicht ge-
bogen, fast wagerecht ausgespannt, alle Finger
gerade ausgestreckt. Das im Dreiviertel-Profil
nach rechts schauende Haupt neigt sich unbe-
deutend, man möchte sagen: eine Neigung er-
scheint nur schwach angedeutet, weil das Haupt
etwas tief zwischen den Schultern sitzt. Es hat
eher runde als ovale Form und ist mit schön
geordnetem, in zwei lange Strähne getheiltem
Haar bedeckt (jede Andeutung einer Königs-
oder Dornenkrone fehlt). Der Bart ist kurz ge-
halten, Augen und Mund sind offen: der Herr
lebt noch; die Seitenwunde ist nicht angegeben.
Die in dünnem Metall getriebene Arbeit hat
hier wie bei den übrigen Figuren stark gelitten.
Daher findet sich auch die nach regelmässiger
Form getriebene Nase ein wenig eingedrückt.
Ein grofser Kreuznimbus umgibt das Haupt des
Heilandes. Der Körper zeigt eine bedeutende Aus-
und Einbiegung und ist von den Hüften bis zu
den Knieen mit einem faltenreichen, aber straf!'
angezogenen Schamtuche umhüllt. Obgleich die
Füfse übereinander gelegt und in Folge dessen
mit einem Nagel am Kreuze befestigt sind, so
ist dennoch ein Suppedaneum angebracht.
Als Nebenfiguren des Gekreuzigten finden
wir auf den blumenartigen Endungen der Quer-
balken wie gewöhnlich Maria und Johannes,
hier in Form von sogenannten Kniebildern.
Die hl. Jungfrau hält klagend ihre beiden Hände
ziemlich hoch, aber vom Mantel ganz verhüllt
empor. Der Lieblingsjünger stützt mit der
Rechten sein lockiges Haupt, die Linke hält
den emporgezogenen Mantel fest an die Brust.
Beide Figuren erscheinen in schwachem Drei-
viertel-Profil, das Haupt des hl. Johannes ist
aber dem Meister besser gelungen als jenes
der hl. Jungfrau. Prächtig behandelt sind die
Draperieen ihrer Kleider. Aufser den schwach
erhabenen Nimben ist der Hintergrund dieser
Figuren wie der folgenden ganz schmucklos,
ihre Umrahmung besteht aus einem kräftig ge-
triebenen Perlenkranz. Auf den beiden übrigen