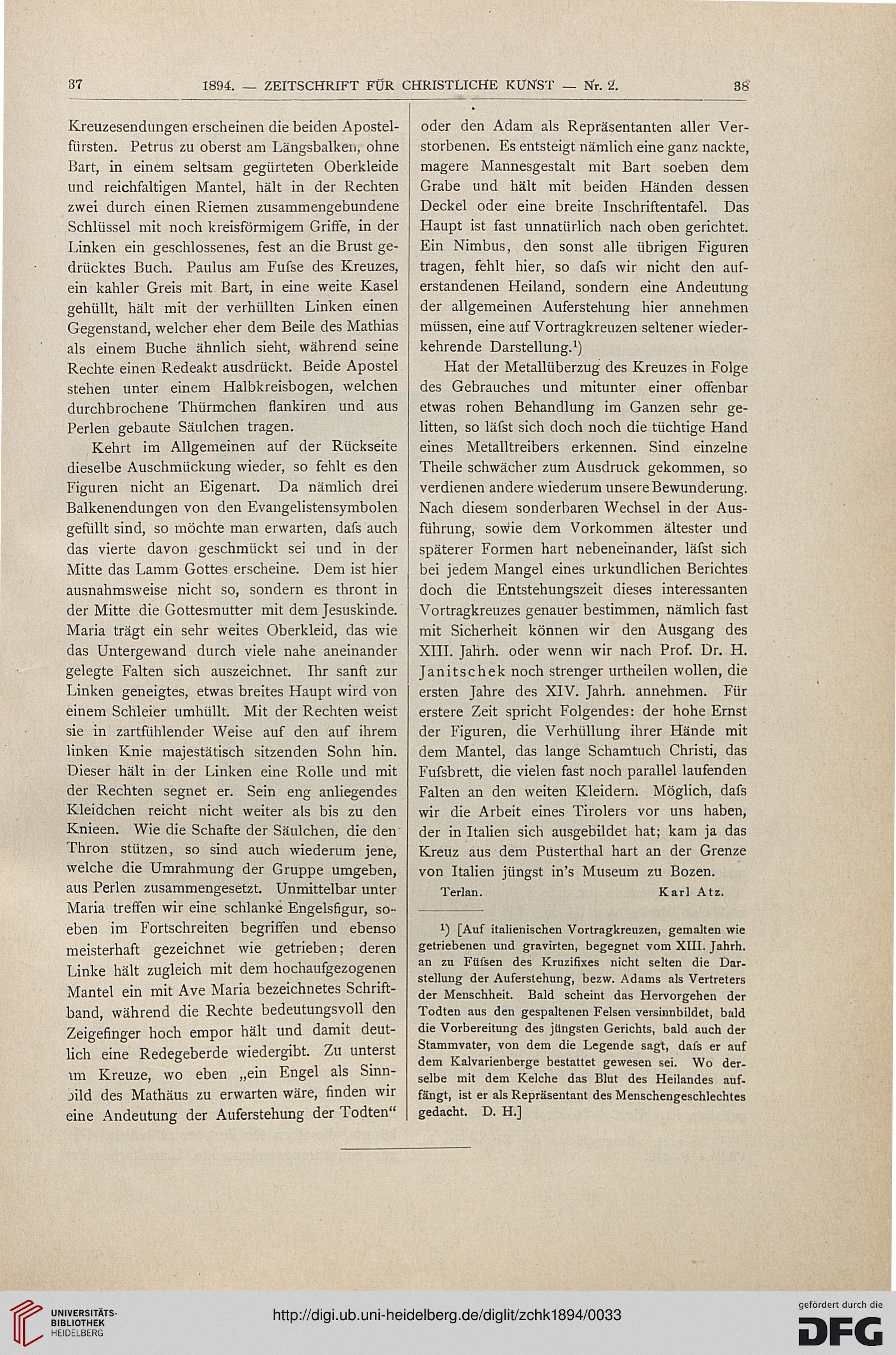37
1894. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 2.
88'
Kreuzesendungen erscheinen die beiden Apostel-
fürsten. Petrus zu oberst am Längsbalkeii, ohne
Bart, in einem seltsam gegürteten Oberkleide
und reichfaltigen Mantel, hält in der Rechten
zwei durch einen Riemen zusammengebundene
Schlüssel mit noch kreisförmigem Griffe, in der
Linken ein geschlossenes, fest an die Brust ge-
drücktes Buch. Paulus am Fufse des Kreuzes,
ein kahler Greis mit Bart, in eine weite Kasel
gehüllt, hält mit der verhüllten Linken einen
Gegenstand, welcher eher dem Beile des Mathias
als einem Buche ähnlich sieht, während seine
Rechte einen Redeakt ausdrückt. Beide Apostel
stehen unter einem Halbkreisbogen, welchen
durchbrochene Thürmchen flankiren und aus
Perlen gebaute Säulchen tragen.
Kehrt im Allgemeinen auf der Rückseite
dieselbe Auschmückung wieder, so fehlt es den
Figuren nicht an Eigenart. Da nämlich drei
Balkenendungen von den Evangelistensymbolen
gefüllt sind, so möchte man erwarten, dafs auch
das vierte davon geschmückt sei und in der
Mitte das Lamm Gottes erscheine. Dem ist hier
ausnahmsweise nicht so, sondern es thront in
der Mitte die Gottesmutter mit dem Jesuskinde.
Maria trägt ein sehr weites Oberkleid, das wie
das Untergewand durch viele nahe aneinander
gelegte Falten sich auszeichnet. Ihr sanft zur
Linken geneigtes, etwas breites Haupt wird von
einem Schleier umhüllt. Mit der Rechten weist
sie in zartfühlender Weise auf den auf ihrem
linken Knie majestätisch sitzenden Sohn hin.
Dieser hält in der Linken eine Rolle und mit
der Rechten segnet er. Sein eng anliegendes
Kleidchen reicht nicht weiter als bis zu den
Knieen. Wie die Schafte der Säulchen, die den
Thron stützen, so sind auch wiederum jene,
welche die Umrahmung der Gruppe umgeben,
aus Perlen zusammengesetzt. Unmittelbar unter
Maria treffen wir eine schlanke Engelsfigur, so-
eben im Fortschreiten begriffen und ebenso
meisterhaft gezeichnet wie getrieben; deren
Linke hält zugleich mit dem hochaufgezogenen
Mantel ein mit Ave Maria bezeichnetes Schrift-
band, während die Rechte bedeutungsvoll den
Zeigefinger hoch empor hält und damit deut-
lich eine Redegeberde wiedergibt. Zu unterst
im Kreuze, wo eben „ein Engel als Sinn-
jild des Mathäus zu erwarten wäre, finden wir
eine Andeutung der Auferstehung der Todten"
oder den Adam als Repräsentanten aller Ver-
storbenen. Es entsteigt nämlich eine ganz nackte,
magere Mannesgestalt mit Bart soeben dem
Grabe und hält mit beiden Händen dessen
Deckel oder eine breite Inschriftentafel. Das
Haupt ist fast unnatürlich nach oben gerichtet.
Ein Nimbus, den sonst alle übrigen Figuren
tragen, fehlt hier, so dafs wir nicht den auf-
erstandenen Heiland, sondern eine Andeutung
der allgemeinen Auferstehung hier annehmen
müssen, eine auf Vortragkreuzen seltener wieder-
kehrende Darstellung.1)
Hat der Metallüberzug des Kreuzes in Folge
des Gebrauches und mitunter einer offenbar
etwas rohen Behandlung im Ganzen sehr ge-
litten, so läfst sich doch noch die tüchtige Hand
eines Metalltreibers erkennen. Sind einzelne
Theile schwächer zum Ausdruck gekommen, so
verdienen andere wiederum unsere Bewunderung.
Nach diesem sonderbaren Wechsel in der Aus-
führung, sowie dem Vorkommen ältester und
späterer Formen hart nebeneinander, läfst sich
bei jedem Mangel eines urkundlichen Berichtes
doch die Entstehungszeit dieses interessanten
Vortragkreuzes genauer bestimmen, nämlich fast
mit Sicherheit können wir den Ausgang des
XIII. Jahrh. oder wenn wir nach Prof. Dr. H.
Janitschek noch strenger urtheilen wollen, die
ersten Jahre des XIV. Jahrh. annehmen. Für
erstere Zeit spricht Folgendes: der hohe Ernst
der Figuren, die Verhüllung ihrer Hände mit
dem Mantel, das lange Schamtuch Christi, das
Fufsbrett, die vielen fast noch parallel laufenden
Falten an den weiten Kleidern. Möglich, dafs
wir die Arbeit eines Tirolers vor uns haben,
der in Italien sich ausgebildet hat; kam ja das
Kreuz aus dem Pusterthal hart an der Grenze
von Italien jüngst in's Museum zu Bozen.
Terlan. Kar] Atz.
') [Auf italienischen Vortragkreuzen, gemalten wie
getriebenen und gravirten, begegnet vom XIII. Jahrh.
an zu Füfsen des Kruzifixes nicht selten die Dar-
stellung der Auferstehung, bezw. Adams als Vertreters
der Menschheit. Bald scheint das Hervorgehen der
Todten aus den gespaltenen Felsen versinnbildet, bald
die Vorbereitung des jüngsten Gerichts, bald auch der
Stammvater, von dem die Legende sagt, dafs er auf
dem Kalvarienberge bestattet gewesen sei. Wo der-
selbe mit dem Kelche das Blut des Heilandes auf-
fängt, ist er als Repräsentant des Menschengeschlechtes
gedacht. D. H.]
1894. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 2.
88'
Kreuzesendungen erscheinen die beiden Apostel-
fürsten. Petrus zu oberst am Längsbalkeii, ohne
Bart, in einem seltsam gegürteten Oberkleide
und reichfaltigen Mantel, hält in der Rechten
zwei durch einen Riemen zusammengebundene
Schlüssel mit noch kreisförmigem Griffe, in der
Linken ein geschlossenes, fest an die Brust ge-
drücktes Buch. Paulus am Fufse des Kreuzes,
ein kahler Greis mit Bart, in eine weite Kasel
gehüllt, hält mit der verhüllten Linken einen
Gegenstand, welcher eher dem Beile des Mathias
als einem Buche ähnlich sieht, während seine
Rechte einen Redeakt ausdrückt. Beide Apostel
stehen unter einem Halbkreisbogen, welchen
durchbrochene Thürmchen flankiren und aus
Perlen gebaute Säulchen tragen.
Kehrt im Allgemeinen auf der Rückseite
dieselbe Auschmückung wieder, so fehlt es den
Figuren nicht an Eigenart. Da nämlich drei
Balkenendungen von den Evangelistensymbolen
gefüllt sind, so möchte man erwarten, dafs auch
das vierte davon geschmückt sei und in der
Mitte das Lamm Gottes erscheine. Dem ist hier
ausnahmsweise nicht so, sondern es thront in
der Mitte die Gottesmutter mit dem Jesuskinde.
Maria trägt ein sehr weites Oberkleid, das wie
das Untergewand durch viele nahe aneinander
gelegte Falten sich auszeichnet. Ihr sanft zur
Linken geneigtes, etwas breites Haupt wird von
einem Schleier umhüllt. Mit der Rechten weist
sie in zartfühlender Weise auf den auf ihrem
linken Knie majestätisch sitzenden Sohn hin.
Dieser hält in der Linken eine Rolle und mit
der Rechten segnet er. Sein eng anliegendes
Kleidchen reicht nicht weiter als bis zu den
Knieen. Wie die Schafte der Säulchen, die den
Thron stützen, so sind auch wiederum jene,
welche die Umrahmung der Gruppe umgeben,
aus Perlen zusammengesetzt. Unmittelbar unter
Maria treffen wir eine schlanke Engelsfigur, so-
eben im Fortschreiten begriffen und ebenso
meisterhaft gezeichnet wie getrieben; deren
Linke hält zugleich mit dem hochaufgezogenen
Mantel ein mit Ave Maria bezeichnetes Schrift-
band, während die Rechte bedeutungsvoll den
Zeigefinger hoch empor hält und damit deut-
lich eine Redegeberde wiedergibt. Zu unterst
im Kreuze, wo eben „ein Engel als Sinn-
jild des Mathäus zu erwarten wäre, finden wir
eine Andeutung der Auferstehung der Todten"
oder den Adam als Repräsentanten aller Ver-
storbenen. Es entsteigt nämlich eine ganz nackte,
magere Mannesgestalt mit Bart soeben dem
Grabe und hält mit beiden Händen dessen
Deckel oder eine breite Inschriftentafel. Das
Haupt ist fast unnatürlich nach oben gerichtet.
Ein Nimbus, den sonst alle übrigen Figuren
tragen, fehlt hier, so dafs wir nicht den auf-
erstandenen Heiland, sondern eine Andeutung
der allgemeinen Auferstehung hier annehmen
müssen, eine auf Vortragkreuzen seltener wieder-
kehrende Darstellung.1)
Hat der Metallüberzug des Kreuzes in Folge
des Gebrauches und mitunter einer offenbar
etwas rohen Behandlung im Ganzen sehr ge-
litten, so läfst sich doch noch die tüchtige Hand
eines Metalltreibers erkennen. Sind einzelne
Theile schwächer zum Ausdruck gekommen, so
verdienen andere wiederum unsere Bewunderung.
Nach diesem sonderbaren Wechsel in der Aus-
führung, sowie dem Vorkommen ältester und
späterer Formen hart nebeneinander, läfst sich
bei jedem Mangel eines urkundlichen Berichtes
doch die Entstehungszeit dieses interessanten
Vortragkreuzes genauer bestimmen, nämlich fast
mit Sicherheit können wir den Ausgang des
XIII. Jahrh. oder wenn wir nach Prof. Dr. H.
Janitschek noch strenger urtheilen wollen, die
ersten Jahre des XIV. Jahrh. annehmen. Für
erstere Zeit spricht Folgendes: der hohe Ernst
der Figuren, die Verhüllung ihrer Hände mit
dem Mantel, das lange Schamtuch Christi, das
Fufsbrett, die vielen fast noch parallel laufenden
Falten an den weiten Kleidern. Möglich, dafs
wir die Arbeit eines Tirolers vor uns haben,
der in Italien sich ausgebildet hat; kam ja das
Kreuz aus dem Pusterthal hart an der Grenze
von Italien jüngst in's Museum zu Bozen.
Terlan. Kar] Atz.
') [Auf italienischen Vortragkreuzen, gemalten wie
getriebenen und gravirten, begegnet vom XIII. Jahrh.
an zu Füfsen des Kruzifixes nicht selten die Dar-
stellung der Auferstehung, bezw. Adams als Vertreters
der Menschheit. Bald scheint das Hervorgehen der
Todten aus den gespaltenen Felsen versinnbildet, bald
die Vorbereitung des jüngsten Gerichts, bald auch der
Stammvater, von dem die Legende sagt, dafs er auf
dem Kalvarienberge bestattet gewesen sei. Wo der-
selbe mit dem Kelche das Blut des Heilandes auf-
fängt, ist er als Repräsentant des Menschengeschlechtes
gedacht. D. H.]