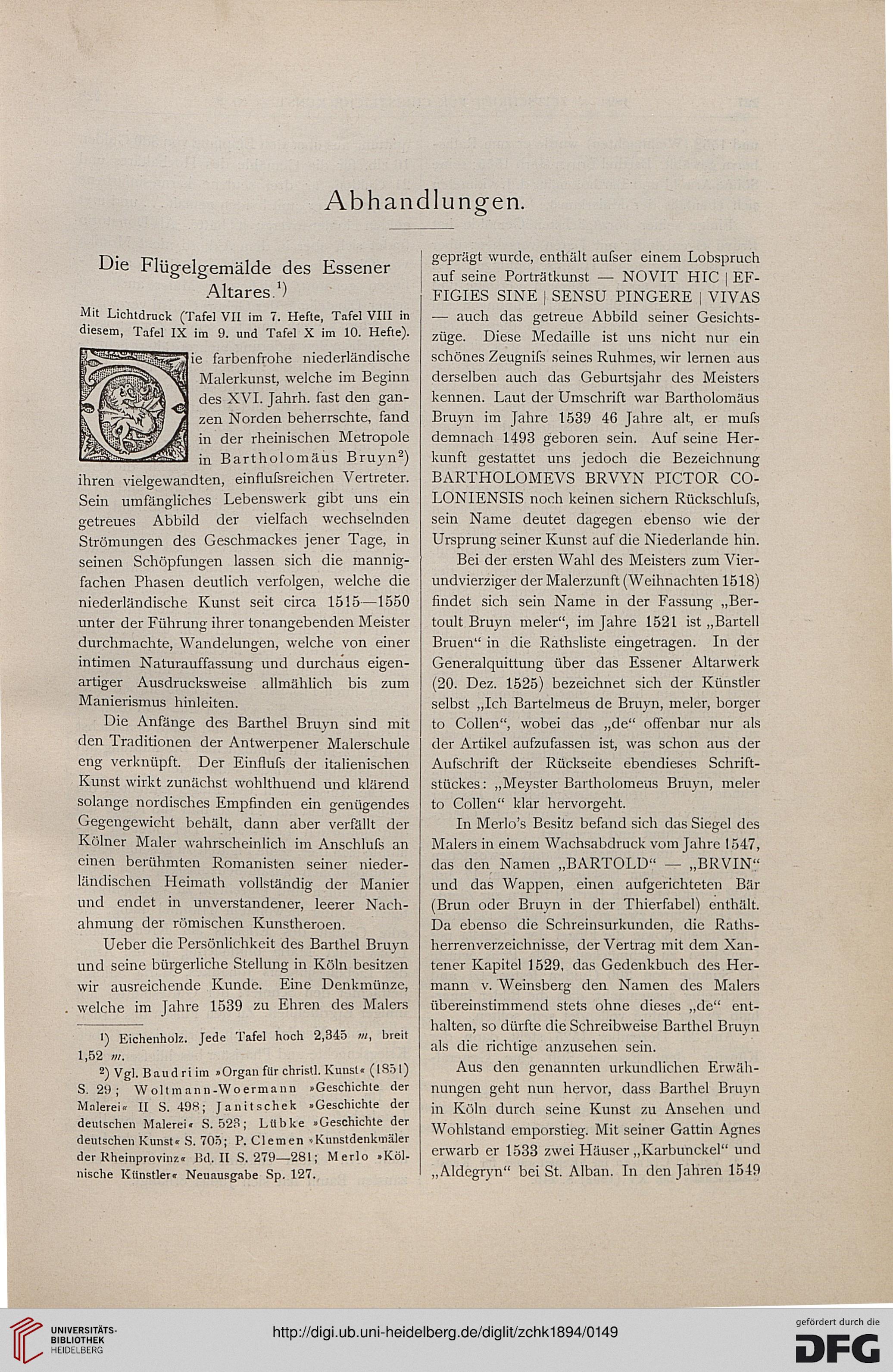Abhandlungen.
Die Flügelgemälde des Essener
Altares.1)
Mit Lichtdruck (Tafel VII im 7. Hefte, Tafel VIII in
diesem, Tafel IX im 9. und Tafel X im 10. Hefle).
ie farbenfrohe niederländische
Malerkunst, welche im Beginn
des XVI. Jahrh. fast den gan-
zen Norden beherrschte, fand
in der rheinischen Metropole
in Bartholomäus Bruyn2)
ihren vielgewandten, einflußreichen Vertreter.
Sein umfängliches Lebenswerk gibt uns ein
getreues Abbild der vielfach wechselnden
Strömungen des Geschmackes jener Tage, in
seinen Schöpfungen lassen sich die mannig-
fachen Phasen deutlich verfolgen, welche die
niederländische Kunst seit circa 1515—1550
unter der Führung ihrer tonangebenden Meister
durchmachte, Wandelungen, welche von einer
intimen Naturauffassung und durchaus eigen-
artiger Ausdrucksweise allmählich bis zum
Manierismus hinleiten.
Die Anfänge des Barthel Bruyn sind mit
den Traditionen der Antwerpener Malerschule
eng verknüpft. Der Einfluß der italienischen
Kunst wirkt zunächst wohlthuend und klärend
solange nordisches Empfinden ein genügendes
Gegengewicht behält, dann aber verfällt der
Kölner Maler wahrscheinlich im Anschlufs an
einen berühmten Romanisten seiner nieder-
ländischen Heimath vollständig der Manier
und endet in unverstandener, leerer Nach-
ahmung der römischen Kunstheroen.
Ueber die Persönlichkeit des Barthel Bruyn
und seine bürgerliche Stellung in Köln besitzen
wir ausreichende Kunde. Eine Denkmünze,
welche im Jahre 1539 zu Ehren des Malers
') Eichenholz. Jede Tafel hoch 2,345 m, breit
1,52 in.
2) Vgl. B a u d r i im » Organ für christl. Kunst <t (1851)
S. 29 ; Woltmann-Woermaun «Geschichte der
Malerei« II S. 49«; Janitschek »Geschichte der
deutschen Malerei« S. 523; Lübke »Geschichte der
deutschen Kunst« S. 705; P. Clemen »Kunstdenkmäler
der Rheinprovinz« Bd. II S. 279—281; Merlo »Köl-
nische Künstler« Neuausgabe Sp. 127.
geprägt wurde, enthält außer einem Lobspruch
auf seine Porträtkunst — NOVIT HIC | EF-
FIGIES SINE | SENSU PINGERE | VIVAS
— auch das getreue Abbild seiner Gesichts-
züge. Diese Medaille ist uns nicht nur ein
schönes Zeugnifs seines Ruhmes, wir lernen aus
derselben auch das Geburtsjahr des Meisters
kennen. Laut der Umschrift war Bartholomäus
Bruyn im Jahre 1539 46 Jahre alt, er muß
demnach 1493 geboren sein. Auf seine Her-
kunft gestattet uns jedoch die Bezeichnung
BARTHOLOMEVS BRVYN PICTOR CO-
LONIENSIS noch keinen sichern Rückschluß,
sein Name deutet dagegen ebenso wie der
Ursprung seiner Kunst auf die Niederlande hin.
Bei der ersten Wahl des Meisters zum Vier-
undvierziger der Malerzunft (Weihnachten 1518)
findet sich sein Name in der Fassung „Ber-
toult Bruyn meler", im Jahre 1521 ist „Bartell
Bruen" in die Rathsliste eingetragen. In der
Generalquittung über das Essener Altarwerk
(20. Dez. 1525) bezeichnet sich der Künstler
selbst „Ich Bartelmeus de Bruyn, meler, borger
to Collen", wobei das „de" offenbar nur als
der Artikel aufzufassen ist, was schon aus der
Aufschrift der Rückseite ebendieses Schrift-
stückes : „Meyster Bartholomeus Bruyn, meler
to Collen" klar hervorgeht.
In Merlo's Besitz befand sich das Siegel des
Malers in einem Wachsabdruck vom Jahre 1547,
das den Namen „BARTOLD" — „BRVIN"
und das Wappen, einen aufgerichteten Bär
(Brun oder Bruyn in der Thierfabel) enthält.
Da ebenso die Schreinsurkunden, die Raths-
herrenverzeichnisse, der Vertrag mit dem Xan-
tener Kapitel 1529, das Gedenkbuch des Her-
mann v. Weinsberg den Namen des Malers
übereinstimmend stets ohne dieses „de" ent-
halten, so dürfte die Schreibweise Barthel Bruyn
als die richtige anzusehen sein.
Aus den genannten urkundlichen Erwäh-
nungen geht nun hervor, dass Barthel Bruyn
in Köln durch seine Kunst zu Ansehen und
Wohlstand emporstieg. Mit seiner Gattin Agnes
erwarb er 1533 zwei Häuser „Karbunckel" und
„Aldegryn" bei St. Alban. In den Jahren 1549
Die Flügelgemälde des Essener
Altares.1)
Mit Lichtdruck (Tafel VII im 7. Hefte, Tafel VIII in
diesem, Tafel IX im 9. und Tafel X im 10. Hefle).
ie farbenfrohe niederländische
Malerkunst, welche im Beginn
des XVI. Jahrh. fast den gan-
zen Norden beherrschte, fand
in der rheinischen Metropole
in Bartholomäus Bruyn2)
ihren vielgewandten, einflußreichen Vertreter.
Sein umfängliches Lebenswerk gibt uns ein
getreues Abbild der vielfach wechselnden
Strömungen des Geschmackes jener Tage, in
seinen Schöpfungen lassen sich die mannig-
fachen Phasen deutlich verfolgen, welche die
niederländische Kunst seit circa 1515—1550
unter der Führung ihrer tonangebenden Meister
durchmachte, Wandelungen, welche von einer
intimen Naturauffassung und durchaus eigen-
artiger Ausdrucksweise allmählich bis zum
Manierismus hinleiten.
Die Anfänge des Barthel Bruyn sind mit
den Traditionen der Antwerpener Malerschule
eng verknüpft. Der Einfluß der italienischen
Kunst wirkt zunächst wohlthuend und klärend
solange nordisches Empfinden ein genügendes
Gegengewicht behält, dann aber verfällt der
Kölner Maler wahrscheinlich im Anschlufs an
einen berühmten Romanisten seiner nieder-
ländischen Heimath vollständig der Manier
und endet in unverstandener, leerer Nach-
ahmung der römischen Kunstheroen.
Ueber die Persönlichkeit des Barthel Bruyn
und seine bürgerliche Stellung in Köln besitzen
wir ausreichende Kunde. Eine Denkmünze,
welche im Jahre 1539 zu Ehren des Malers
') Eichenholz. Jede Tafel hoch 2,345 m, breit
1,52 in.
2) Vgl. B a u d r i im » Organ für christl. Kunst <t (1851)
S. 29 ; Woltmann-Woermaun «Geschichte der
Malerei« II S. 49«; Janitschek »Geschichte der
deutschen Malerei« S. 523; Lübke »Geschichte der
deutschen Kunst« S. 705; P. Clemen »Kunstdenkmäler
der Rheinprovinz« Bd. II S. 279—281; Merlo »Köl-
nische Künstler« Neuausgabe Sp. 127.
geprägt wurde, enthält außer einem Lobspruch
auf seine Porträtkunst — NOVIT HIC | EF-
FIGIES SINE | SENSU PINGERE | VIVAS
— auch das getreue Abbild seiner Gesichts-
züge. Diese Medaille ist uns nicht nur ein
schönes Zeugnifs seines Ruhmes, wir lernen aus
derselben auch das Geburtsjahr des Meisters
kennen. Laut der Umschrift war Bartholomäus
Bruyn im Jahre 1539 46 Jahre alt, er muß
demnach 1493 geboren sein. Auf seine Her-
kunft gestattet uns jedoch die Bezeichnung
BARTHOLOMEVS BRVYN PICTOR CO-
LONIENSIS noch keinen sichern Rückschluß,
sein Name deutet dagegen ebenso wie der
Ursprung seiner Kunst auf die Niederlande hin.
Bei der ersten Wahl des Meisters zum Vier-
undvierziger der Malerzunft (Weihnachten 1518)
findet sich sein Name in der Fassung „Ber-
toult Bruyn meler", im Jahre 1521 ist „Bartell
Bruen" in die Rathsliste eingetragen. In der
Generalquittung über das Essener Altarwerk
(20. Dez. 1525) bezeichnet sich der Künstler
selbst „Ich Bartelmeus de Bruyn, meler, borger
to Collen", wobei das „de" offenbar nur als
der Artikel aufzufassen ist, was schon aus der
Aufschrift der Rückseite ebendieses Schrift-
stückes : „Meyster Bartholomeus Bruyn, meler
to Collen" klar hervorgeht.
In Merlo's Besitz befand sich das Siegel des
Malers in einem Wachsabdruck vom Jahre 1547,
das den Namen „BARTOLD" — „BRVIN"
und das Wappen, einen aufgerichteten Bär
(Brun oder Bruyn in der Thierfabel) enthält.
Da ebenso die Schreinsurkunden, die Raths-
herrenverzeichnisse, der Vertrag mit dem Xan-
tener Kapitel 1529, das Gedenkbuch des Her-
mann v. Weinsberg den Namen des Malers
übereinstimmend stets ohne dieses „de" ent-
halten, so dürfte die Schreibweise Barthel Bruyn
als die richtige anzusehen sein.
Aus den genannten urkundlichen Erwäh-
nungen geht nun hervor, dass Barthel Bruyn
in Köln durch seine Kunst zu Ansehen und
Wohlstand emporstieg. Mit seiner Gattin Agnes
erwarb er 1533 zwei Häuser „Karbunckel" und
„Aldegryn" bei St. Alban. In den Jahren 1549