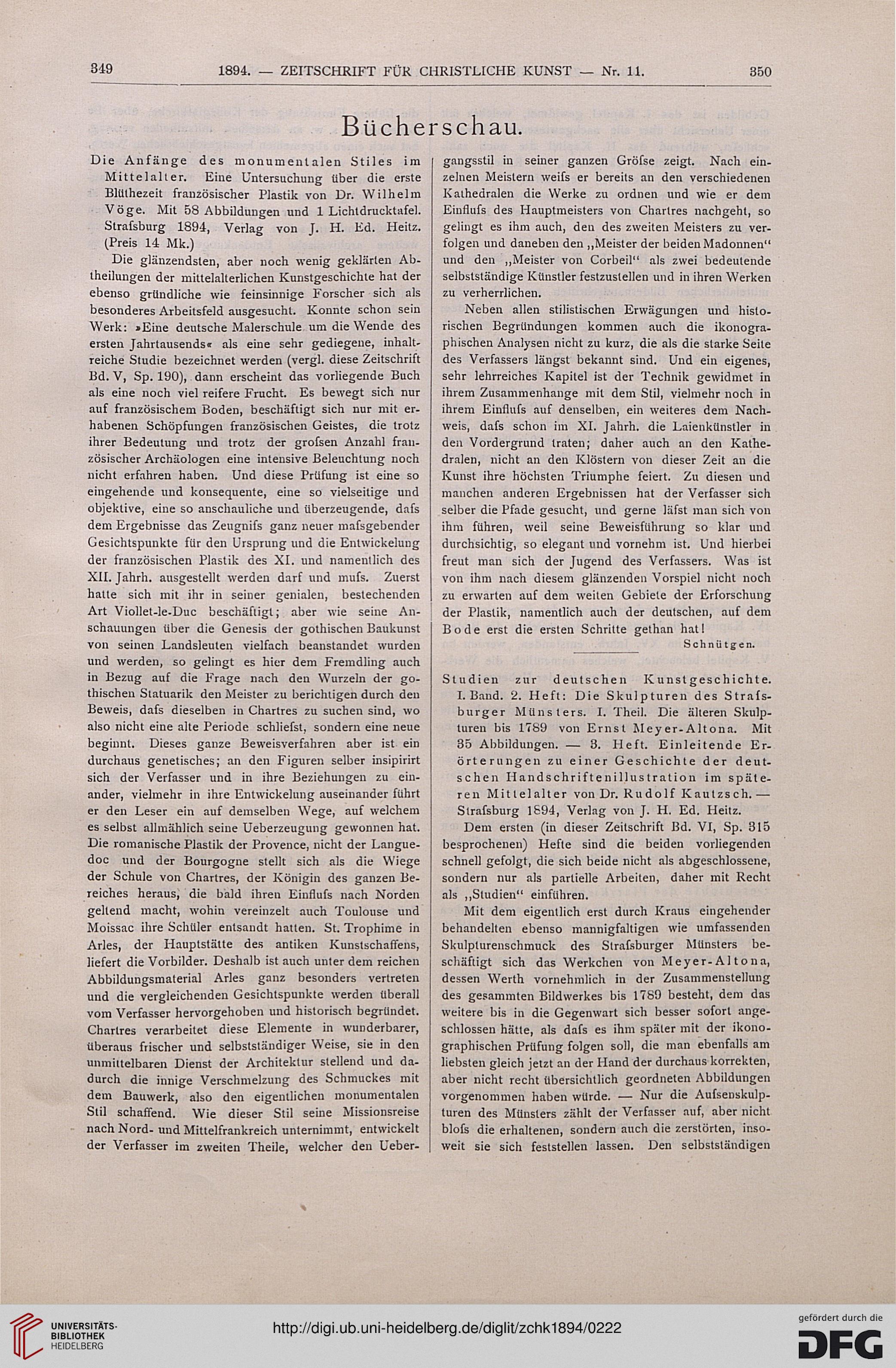349
1894. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 11.
350
Bücherschau.
Die Anfänge des monumentalen Stiles im
Mittelalter. Eine Untersuchung über die erste
Blülhezeit französischer Plastik von Dr. Wilhelm
Vöge. Mit 58 Abbildungen und 1 Lichldrucktafel.
Strafsburg 1894, Verlag von J. H. Ed. Heilz.
(Preis 14 Mk.)
Die glänzendsten, aber noch wenig geklärten Ab-
theilungen der mittelalterlichen Kunstgeschichte hat der
ebenso gründliche wie feinsinnige Forscher sich als
besonderes Arbeitsfeld ausgesucht. Konnte schon sein
Werk: »Eine deutsche Malerschule um die Wende des
ersten Jahrtausends« als eine sehr gediegene, inhalt-
reiche Studie bezeichnet werden (vergl. diese Zeitschrift
Bd. V, Sp. 190), dann erscheint das vorliegende Buch
als eine noch viel reifere Frucht. Es bewegt sich nur
auf französischem Boden, beschäftigt sich nur mit er-
habenen Schöpfungen französischen Ceistes, die trotz
ihrer Bedeutung und trotz der grofsen Anzahl fran-
zösischer Archäologen eine intensive Beleuchtung noch
nicht erfahren haben. Und diese Prüfung ist eine so
eingehende und konsequente, eine so vielseitige und
objektive, eine so anschauliche und überzeugende, dafs
dem Ergebnisse das Zeugnifs ganz neuer mafsgebender
Gesichtspunkte für den Ursprung und die Entwickelung
der französischen Plastik des XI. und namentlich des
XII. Jahrh. ausgestellt werden darf und mufs. Zuerst
hatte sich mit ihr in seiner genialen, bestechenden
Art Viollet-le-Duc beschäftigt; aber wie seine An-
schauungen über die Genesis der gothischen Baukunst
von seinen Landsleuten vielfach beanstandet wurden
und werden, so gelingt es hier dem Fremdling auch
in Bezug auf die Frage nach den Wurzeln der go-
thischen Statuarik den Meister zu berichtigen durch den
Beweis, dafs dieselben in Chartres zu suchen sind, wo
also nicht eine alte Periode schliefst, sondern eine neue
beginnt. Dieses ganze Beweisverfahren aber ist ein
durchaus genetisches; an den Figuren selber insipirirt
sich der Verfasser und in ihre Beziehungen zu ein-
ander, vielmehr in ihre Entwickelung auseinander führt
er den Leser ein auf demselben Wege, auf welchem
es selbst allmählich seine Ueberzeugung gewonnen hat.
Die romanische Plastik der Provence, nicht der Langue-
doc und der Bourgogne stellt sich als die Wiege
der Schule von Chartres, der Königin des ganzen Be-
reiches heraus, die bald ihren Einflufs nach Norden
geltend macht, wohin vereinzelt auch Toulouse und
Moissac ihre Schüler entsandt hatten. St. Trophime in
Arles, der Hauptstätte des antiken Kunstschaffens,
liefert die Vorbilder. Deshalb ist auch unter dem reichen
Abbildungsmaterial Arles ganz besonders vertreten
und die vergleichenden Gesichtspunkte werden überall
vom Verfasser hervorgehoben und historisch begründet.
Chartres verarbeitet diese Elemente in wunderbarer,
überaus frischer und selbständiger Weise, sie in den
unmittelbaren Dienst der Architektur stellend und da-
durch die innige Verschmelzung des Schmuckes mit
dem Bauwerk, also den eigentlichen monumentalen
Stil schaffend. Wie dieser Stil seine Missionsreise
nach Nord- und Mittelfrankreich unternimmt, entwickelt
der Verfasser im zweiten Theile, welcher den Ueber-
gangsstil in seiner ganzen Gröfse zeigt. Nach ein-
zelnen Meistern weifs er bereits an den verschiedenen
Kathedralen die Werke zu ordnen und wie er dem
Einflufs des Hauptmeisters von Chartres nachgeht, so
gelingt es ihm auch, den des zweiten Meisters zu ver-
folgen und daneben den „Meister der beiden Madonnen"
und den „Meister von Corbeil" als zwei bedeutende
selbstständige Künstler festzustellen und in ihren Werken
zu verherrlichen.
Neben allen stilistischen Erwägungen und histo-
rischen Begründungen kommen auch die ikonogra-
phischen Analysen nicht zu kurz, die als die starke Seile
des Verfassers längst bekannt sind. Und ein eigenes,
sehr lehrreiches Kapitel ist der Technik gewidmet in
ihrem Zusammenhange mit dem Stil, vielmehr noch in
ihrem Einflufs auf denselben, ein weiteres dem Nach-
weis, dafs schon im XI. Jahrh. die Laienkünstler in
den Vordergrund traten; daher auch an den Kathe-
dralen, nicht an den Klöstern von dieser Zeit an die
Kunst ihre höchsten Triumphe feiert. Zu diesen und
manchen anderen Ergebnissen hat der Verfasser sich
selber die Pfade gesucht, und gerne läfst man sich von
ihm führen, weil seine Beweisführung so klar und
durchsichtig, so elegant und vornehm ist. Und hierbei
freut man sich der Jugend des Verfassers. Was ist
von ihm nach diesem glänzenden Vorspiel nicht noch
zu erwarten auf dem weiten Gebiete der Erforschung
der Plastik, namentlich auch der deutschen, auf dem
Bode erst die ersten Schritte gethan hat!
Schniltgen.
Studien zur deutschen Kunstgeschichte.
I.Band. 2. Heft: Die Skulpturen des Strafs-
burger Münsters. I. Theil. Die älteren Skulp-
turen bis 1789 von Ernst Meyer-Altona. Mit
35 Abbildungen. — 3. Heft. Einleitende Er-
örterungen zu einer Geschichte der deut-
schen Handschriftenillustration im späte-
ren Mittelalter von Dr. Rudolf Kautzsch. —■
Slrafsburg 1894, Verlag von J. H. Ed. Heitz.
Dem ersten (in dieser Zeitschrift Bd. VI, Sp. 315
besprochenen) Hefte sind die beiden vorliegenden
schnell gefolgt, die sich beide nicht als abgeschlossene,
sondern nur als partielle Arbeiten, daher mit Recht
als „Studien" einfuhren.
Mit dem eigentlich erst durch Kraus eingehender
behandelten ebenso mannigfaltigen wie umfassenden
Skulpturenschmuck des Strafsburger Münsters be-
schäftigt sich das Werkchen von Meyer-AI tona,
dessen Werth vornehmlich in der Zusammenstellung
des gesammten Bildwerkes bis 1789 besteht, dem das
weitere bis in die Gegenwart sich besser sofort ange-
schlossen hätte, als dafs es ihm später mit der ikono-
graphischen Prüfung folgen soll, die man ebenfalls am
liebsten gleich jetzt an der Hand der durchaus korrekten,
aber nicht recht übersichtlich geordneten Abbildungen
vorgenommen haben würde. — Nur die Aufsenskulp-
turen des Münsters zählt der Verfasser auf, aber nicht
blofs die erhaltenen, sondern auch die zerstörten, inso-
weit sie sich feststellen lassen. Den selbstständigen
1894. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 11.
350
Bücherschau.
Die Anfänge des monumentalen Stiles im
Mittelalter. Eine Untersuchung über die erste
Blülhezeit französischer Plastik von Dr. Wilhelm
Vöge. Mit 58 Abbildungen und 1 Lichldrucktafel.
Strafsburg 1894, Verlag von J. H. Ed. Heilz.
(Preis 14 Mk.)
Die glänzendsten, aber noch wenig geklärten Ab-
theilungen der mittelalterlichen Kunstgeschichte hat der
ebenso gründliche wie feinsinnige Forscher sich als
besonderes Arbeitsfeld ausgesucht. Konnte schon sein
Werk: »Eine deutsche Malerschule um die Wende des
ersten Jahrtausends« als eine sehr gediegene, inhalt-
reiche Studie bezeichnet werden (vergl. diese Zeitschrift
Bd. V, Sp. 190), dann erscheint das vorliegende Buch
als eine noch viel reifere Frucht. Es bewegt sich nur
auf französischem Boden, beschäftigt sich nur mit er-
habenen Schöpfungen französischen Ceistes, die trotz
ihrer Bedeutung und trotz der grofsen Anzahl fran-
zösischer Archäologen eine intensive Beleuchtung noch
nicht erfahren haben. Und diese Prüfung ist eine so
eingehende und konsequente, eine so vielseitige und
objektive, eine so anschauliche und überzeugende, dafs
dem Ergebnisse das Zeugnifs ganz neuer mafsgebender
Gesichtspunkte für den Ursprung und die Entwickelung
der französischen Plastik des XI. und namentlich des
XII. Jahrh. ausgestellt werden darf und mufs. Zuerst
hatte sich mit ihr in seiner genialen, bestechenden
Art Viollet-le-Duc beschäftigt; aber wie seine An-
schauungen über die Genesis der gothischen Baukunst
von seinen Landsleuten vielfach beanstandet wurden
und werden, so gelingt es hier dem Fremdling auch
in Bezug auf die Frage nach den Wurzeln der go-
thischen Statuarik den Meister zu berichtigen durch den
Beweis, dafs dieselben in Chartres zu suchen sind, wo
also nicht eine alte Periode schliefst, sondern eine neue
beginnt. Dieses ganze Beweisverfahren aber ist ein
durchaus genetisches; an den Figuren selber insipirirt
sich der Verfasser und in ihre Beziehungen zu ein-
ander, vielmehr in ihre Entwickelung auseinander führt
er den Leser ein auf demselben Wege, auf welchem
es selbst allmählich seine Ueberzeugung gewonnen hat.
Die romanische Plastik der Provence, nicht der Langue-
doc und der Bourgogne stellt sich als die Wiege
der Schule von Chartres, der Königin des ganzen Be-
reiches heraus, die bald ihren Einflufs nach Norden
geltend macht, wohin vereinzelt auch Toulouse und
Moissac ihre Schüler entsandt hatten. St. Trophime in
Arles, der Hauptstätte des antiken Kunstschaffens,
liefert die Vorbilder. Deshalb ist auch unter dem reichen
Abbildungsmaterial Arles ganz besonders vertreten
und die vergleichenden Gesichtspunkte werden überall
vom Verfasser hervorgehoben und historisch begründet.
Chartres verarbeitet diese Elemente in wunderbarer,
überaus frischer und selbständiger Weise, sie in den
unmittelbaren Dienst der Architektur stellend und da-
durch die innige Verschmelzung des Schmuckes mit
dem Bauwerk, also den eigentlichen monumentalen
Stil schaffend. Wie dieser Stil seine Missionsreise
nach Nord- und Mittelfrankreich unternimmt, entwickelt
der Verfasser im zweiten Theile, welcher den Ueber-
gangsstil in seiner ganzen Gröfse zeigt. Nach ein-
zelnen Meistern weifs er bereits an den verschiedenen
Kathedralen die Werke zu ordnen und wie er dem
Einflufs des Hauptmeisters von Chartres nachgeht, so
gelingt es ihm auch, den des zweiten Meisters zu ver-
folgen und daneben den „Meister der beiden Madonnen"
und den „Meister von Corbeil" als zwei bedeutende
selbstständige Künstler festzustellen und in ihren Werken
zu verherrlichen.
Neben allen stilistischen Erwägungen und histo-
rischen Begründungen kommen auch die ikonogra-
phischen Analysen nicht zu kurz, die als die starke Seile
des Verfassers längst bekannt sind. Und ein eigenes,
sehr lehrreiches Kapitel ist der Technik gewidmet in
ihrem Zusammenhange mit dem Stil, vielmehr noch in
ihrem Einflufs auf denselben, ein weiteres dem Nach-
weis, dafs schon im XI. Jahrh. die Laienkünstler in
den Vordergrund traten; daher auch an den Kathe-
dralen, nicht an den Klöstern von dieser Zeit an die
Kunst ihre höchsten Triumphe feiert. Zu diesen und
manchen anderen Ergebnissen hat der Verfasser sich
selber die Pfade gesucht, und gerne läfst man sich von
ihm führen, weil seine Beweisführung so klar und
durchsichtig, so elegant und vornehm ist. Und hierbei
freut man sich der Jugend des Verfassers. Was ist
von ihm nach diesem glänzenden Vorspiel nicht noch
zu erwarten auf dem weiten Gebiete der Erforschung
der Plastik, namentlich auch der deutschen, auf dem
Bode erst die ersten Schritte gethan hat!
Schniltgen.
Studien zur deutschen Kunstgeschichte.
I.Band. 2. Heft: Die Skulpturen des Strafs-
burger Münsters. I. Theil. Die älteren Skulp-
turen bis 1789 von Ernst Meyer-Altona. Mit
35 Abbildungen. — 3. Heft. Einleitende Er-
örterungen zu einer Geschichte der deut-
schen Handschriftenillustration im späte-
ren Mittelalter von Dr. Rudolf Kautzsch. —■
Slrafsburg 1894, Verlag von J. H. Ed. Heitz.
Dem ersten (in dieser Zeitschrift Bd. VI, Sp. 315
besprochenen) Hefte sind die beiden vorliegenden
schnell gefolgt, die sich beide nicht als abgeschlossene,
sondern nur als partielle Arbeiten, daher mit Recht
als „Studien" einfuhren.
Mit dem eigentlich erst durch Kraus eingehender
behandelten ebenso mannigfaltigen wie umfassenden
Skulpturenschmuck des Strafsburger Münsters be-
schäftigt sich das Werkchen von Meyer-AI tona,
dessen Werth vornehmlich in der Zusammenstellung
des gesammten Bildwerkes bis 1789 besteht, dem das
weitere bis in die Gegenwart sich besser sofort ange-
schlossen hätte, als dafs es ihm später mit der ikono-
graphischen Prüfung folgen soll, die man ebenfalls am
liebsten gleich jetzt an der Hand der durchaus korrekten,
aber nicht recht übersichtlich geordneten Abbildungen
vorgenommen haben würde. — Nur die Aufsenskulp-
turen des Münsters zählt der Verfasser auf, aber nicht
blofs die erhaltenen, sondern auch die zerstörten, inso-
weit sie sich feststellen lassen. Den selbstständigen