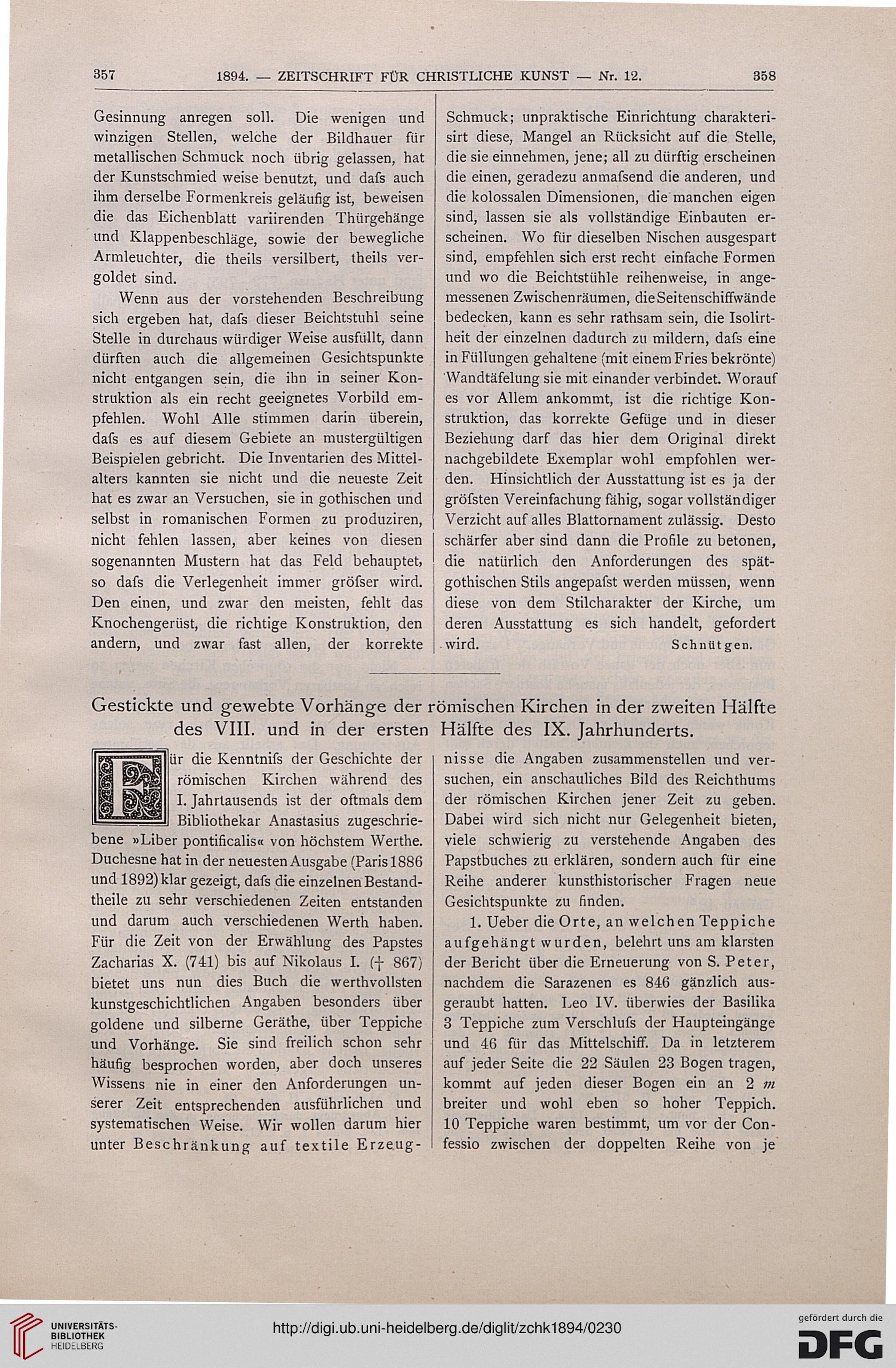357
1894. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 12.
358
Gesinnung anregen soll. Die wenigen und
winzigen Stellen, welche der Bildhauer für
metallischen Schmuck noch übrig gelassen, hat
der Kunstschmied weise benutzt, und dafs auch
ihm derselbe Formenkreis geläufig ist, beweisen
die das Eichenblatt variirenden Thürgehänge
und Klappenbeschläge, sowie der bewegliche
Armleuchter, die theils versilbert, theils ver-
goldet sind.
Wenn aus der vorstehenden Beschreibung
sich ergeben hat, dafs dieser Beichtstuhl seine
Stelle in durchaus würdiger Weise ausfüllt, dann
dürften auch die allgemeinen Gesichtspunkte
nicht entgangen sein, die ihn in seiner Kon-
struktion als ein recht geeignetes Vorbild em-
pfehlen. Wohl Alle stimmen darin überein,
dafs es auf diesem Gebiete an mustergültigen
Beispielen gebricht. Die Inventarien des Mittel-
alters kannten sie nicht und die neueste Zeit
hat es zwar an Versuchen, sie in gothischen und
selbst in romanischen Formen zu produziren,
nicht fehlen lassen, aber keines von diesen
sogenannten Mustern hat das Feld behauptet,
so dafs die Verlegenheit immer gröfser wird.
Den einen, und zwar den meisten, fehlt das
Knochengerüst, die richtige Konstruktion, den
andern, und zwar fast allen, der korrekte
Schmuck; unpraktische Einrichtung charakteri-
sirt diese, Mangel an Rücksicht auf die Stelle,
die sie einnehmen, jene; all zu dürftig erscheinen
die einen, geradezu anmafsend die anderen, und
die kolossalen Dimensionen, die manchen eigen
sind, lassen sie als vollständige Einbauten er-
scheinen. Wo für dieselben Nischen ausgespart
sind, empfehlen sich erst recht einfache Formen
und wo die Beichtstühle reihenweise, in ange-
messenen Zwischenräumen, dieSeitenschiffwände
bedecken, kann es sehr rathsam sein, die Isolirt-
heit der einzelnen dadurch zu mildern, dafs eine
in Füllungen gehaltene (mit einem Fries bekrönte)
Wandtäfelung sie mit einander verbindet. Worauf
es vor Allem ankommt, ist die richtige Kon-
struktion, das korrekte Gefüge und in dieser
Beziehung darf das hier dem Original direkt
nachgebildete Exemplar wohl empfohlen wer-
den. Hinsichtlich der Ausstattung ist es ja der
gröfsten Vereinfachung fähig, sogar vollständiger
Verzicht auf alles Blattornament zulässig. Desto
schärfer aber sind dann die Profile zu betonen,
die natürlich den Anforderungen des spät-
gothischen Stils angepafst werden müssen, wenn
diese von dem Stilcharakter der Kirche, um
deren Ausstattung es sich handelt, gefordert
wird. Schnütgeii.
Gestickte und gewebte Vorhänge der römischen Kirchen in der zweiten Hälfte
des VIII. und in der ersten Hälfte des IX. Jahrhunderts.
nisse die Angaben zusammenstellen und ver-
ür die Kenntnifs der Geschichte der
römischen Kirchen während des
I. Jahrtausends ist der oftmals dem
Bibliothekar Anastasius zugeschrie-
bene »Liber pontificalis« von höchstem Werthe.
Duchesne hat in der neuesten Ausgabe (Parisl886
und 1892) klar gezeigt, dafs die einzelnen Bestand-
theile zu sehr verschiedenen Zeiten entstanden
und darum auch verschiedenen Werth haben.
Für die Zeit von der Erwählung des Papstes
Zacharias X. (741) bis auf Nikolaus I. (f 867)
bietet uns nun dies Buch die werthvollsten
kunstgeschichtlichen Angaben besonders über
goldene und silberne Geräthe, über Teppiche
und Vorhänge. Sie sind freilich schon sehr
häufig besprochen worden, aber doch unseres
Wissens nie in einer den Anforderungen un-
serer Zeit entsprechenden ausführlichen und
systematischen Weise. Wir wollen darum hier
unter Beschränkung auf textile Erzeug-
suchen, ein anschauliches Bild des Reichthums
der römischen Kirchen jener Zeit zu geben.
Dabei wird sich nicht nur Gelegenheit bieten,
viele schwierig zu verstehende Angaben des
Papstbuches zu erklären, sondern auch für eine
Reihe anderer kunsthistorischer Fragen neue
Gesichtspunkte zu finden.
1. Ueber die Orte, an welchen Teppiche
aufgehängt wurden, belehrt uns am klarsten
der Bericht über die Erneuerung von S. Peter,
nachdem die Sarazenen es 846 gänzlich aus-
geraubt hatten. Leo IV. überwies der Basilika
3 Teppiche zum Verschlufs der Haupteingänge
und 46 für das Mittelschiff. Da in letzterem
auf jeder Seite die 22 Säulen 23 Bogen tragen,
kommt auf jeden dieser Bogen ein an 2 m
breiter und wohl eben so hoher Teppich.
10 Teppiche waren bestimmt, um vor der Con-
fessio zwischen der doppelten Reihe von je
1894. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 12.
358
Gesinnung anregen soll. Die wenigen und
winzigen Stellen, welche der Bildhauer für
metallischen Schmuck noch übrig gelassen, hat
der Kunstschmied weise benutzt, und dafs auch
ihm derselbe Formenkreis geläufig ist, beweisen
die das Eichenblatt variirenden Thürgehänge
und Klappenbeschläge, sowie der bewegliche
Armleuchter, die theils versilbert, theils ver-
goldet sind.
Wenn aus der vorstehenden Beschreibung
sich ergeben hat, dafs dieser Beichtstuhl seine
Stelle in durchaus würdiger Weise ausfüllt, dann
dürften auch die allgemeinen Gesichtspunkte
nicht entgangen sein, die ihn in seiner Kon-
struktion als ein recht geeignetes Vorbild em-
pfehlen. Wohl Alle stimmen darin überein,
dafs es auf diesem Gebiete an mustergültigen
Beispielen gebricht. Die Inventarien des Mittel-
alters kannten sie nicht und die neueste Zeit
hat es zwar an Versuchen, sie in gothischen und
selbst in romanischen Formen zu produziren,
nicht fehlen lassen, aber keines von diesen
sogenannten Mustern hat das Feld behauptet,
so dafs die Verlegenheit immer gröfser wird.
Den einen, und zwar den meisten, fehlt das
Knochengerüst, die richtige Konstruktion, den
andern, und zwar fast allen, der korrekte
Schmuck; unpraktische Einrichtung charakteri-
sirt diese, Mangel an Rücksicht auf die Stelle,
die sie einnehmen, jene; all zu dürftig erscheinen
die einen, geradezu anmafsend die anderen, und
die kolossalen Dimensionen, die manchen eigen
sind, lassen sie als vollständige Einbauten er-
scheinen. Wo für dieselben Nischen ausgespart
sind, empfehlen sich erst recht einfache Formen
und wo die Beichtstühle reihenweise, in ange-
messenen Zwischenräumen, dieSeitenschiffwände
bedecken, kann es sehr rathsam sein, die Isolirt-
heit der einzelnen dadurch zu mildern, dafs eine
in Füllungen gehaltene (mit einem Fries bekrönte)
Wandtäfelung sie mit einander verbindet. Worauf
es vor Allem ankommt, ist die richtige Kon-
struktion, das korrekte Gefüge und in dieser
Beziehung darf das hier dem Original direkt
nachgebildete Exemplar wohl empfohlen wer-
den. Hinsichtlich der Ausstattung ist es ja der
gröfsten Vereinfachung fähig, sogar vollständiger
Verzicht auf alles Blattornament zulässig. Desto
schärfer aber sind dann die Profile zu betonen,
die natürlich den Anforderungen des spät-
gothischen Stils angepafst werden müssen, wenn
diese von dem Stilcharakter der Kirche, um
deren Ausstattung es sich handelt, gefordert
wird. Schnütgeii.
Gestickte und gewebte Vorhänge der römischen Kirchen in der zweiten Hälfte
des VIII. und in der ersten Hälfte des IX. Jahrhunderts.
nisse die Angaben zusammenstellen und ver-
ür die Kenntnifs der Geschichte der
römischen Kirchen während des
I. Jahrtausends ist der oftmals dem
Bibliothekar Anastasius zugeschrie-
bene »Liber pontificalis« von höchstem Werthe.
Duchesne hat in der neuesten Ausgabe (Parisl886
und 1892) klar gezeigt, dafs die einzelnen Bestand-
theile zu sehr verschiedenen Zeiten entstanden
und darum auch verschiedenen Werth haben.
Für die Zeit von der Erwählung des Papstes
Zacharias X. (741) bis auf Nikolaus I. (f 867)
bietet uns nun dies Buch die werthvollsten
kunstgeschichtlichen Angaben besonders über
goldene und silberne Geräthe, über Teppiche
und Vorhänge. Sie sind freilich schon sehr
häufig besprochen worden, aber doch unseres
Wissens nie in einer den Anforderungen un-
serer Zeit entsprechenden ausführlichen und
systematischen Weise. Wir wollen darum hier
unter Beschränkung auf textile Erzeug-
suchen, ein anschauliches Bild des Reichthums
der römischen Kirchen jener Zeit zu geben.
Dabei wird sich nicht nur Gelegenheit bieten,
viele schwierig zu verstehende Angaben des
Papstbuches zu erklären, sondern auch für eine
Reihe anderer kunsthistorischer Fragen neue
Gesichtspunkte zu finden.
1. Ueber die Orte, an welchen Teppiche
aufgehängt wurden, belehrt uns am klarsten
der Bericht über die Erneuerung von S. Peter,
nachdem die Sarazenen es 846 gänzlich aus-
geraubt hatten. Leo IV. überwies der Basilika
3 Teppiche zum Verschlufs der Haupteingänge
und 46 für das Mittelschiff. Da in letzterem
auf jeder Seite die 22 Säulen 23 Bogen tragen,
kommt auf jeden dieser Bogen ein an 2 m
breiter und wohl eben so hoher Teppich.
10 Teppiche waren bestimmt, um vor der Con-
fessio zwischen der doppelten Reihe von je