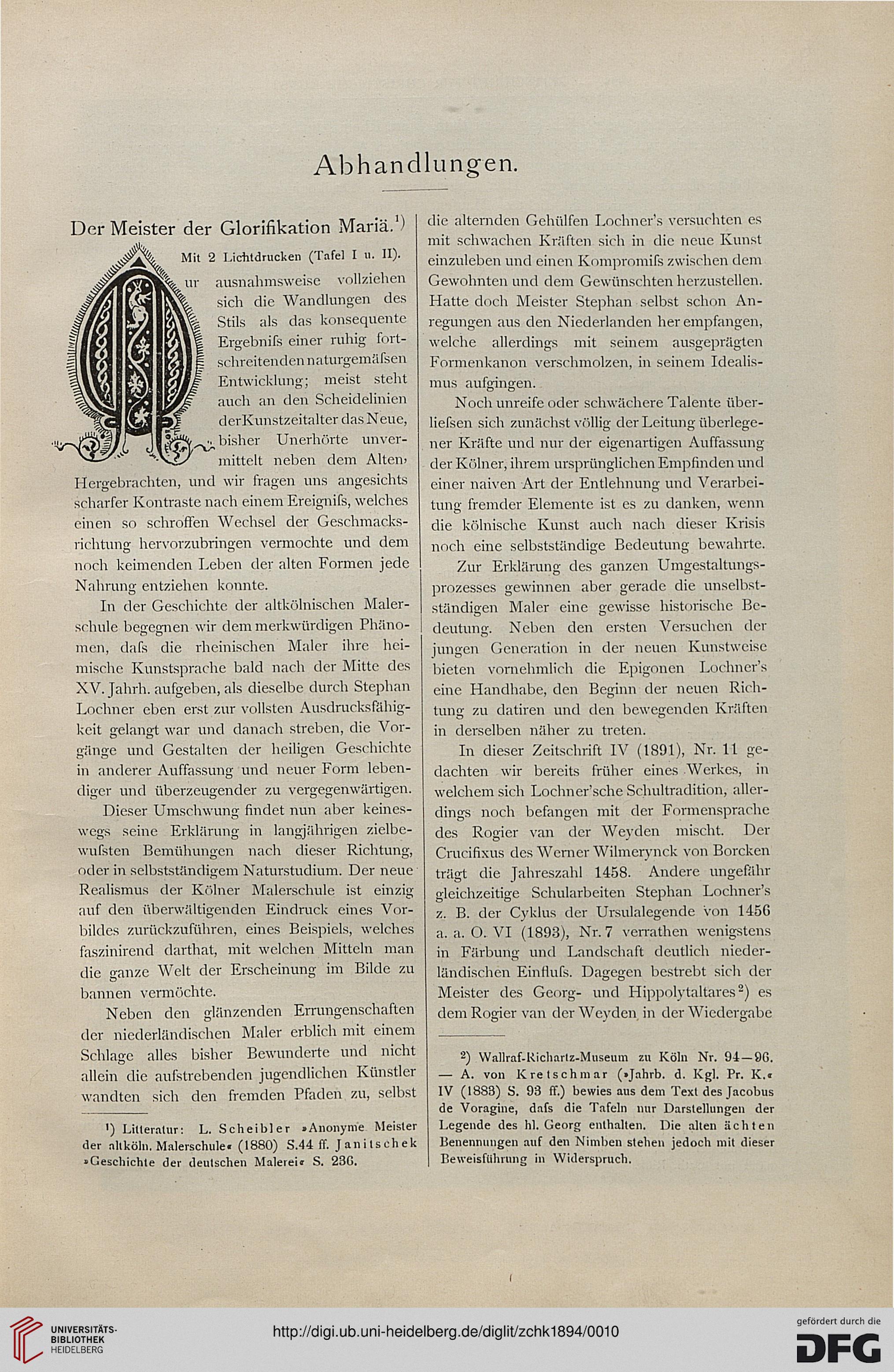Abhandlungen.
Der Meister der Glorifikation Maria.1)
Mit 2 Lichtdrucken (Tafel I u. II).
ausnahmsweise vollziehen
sich die Wandlungen des
Stils als das konsequente
Ergebnifs einer ruhig fort-
schreitenden naturgemafsen
Entwicklung; meist steht
auch an den Scheidelinien
derKunstzeitalter das Neue,
,; bisher Unerhörte unver-
^^^^^^^^^^^^ mittelt neben dem Alten»
Hergebrachten, und wir fragen uns angesichts
scharfer Kontraste nach einem Efeignifs, welches
einen so schroffen Wechsel der Geschmacks-
richtung hervorzubringen vermochte und dem
noch keimenden Leben der alten Formen jede
Nahrung entziehen konnte.
In der Geschichte der altkölnischen Maler-
schule begegnen wir dem merkwürdigen Phäno-
men, dafs die rheinischen Maler ihre hei-
mische Kunstsprache bald nach der Mitte des
XV. Jahrb. aufgeben, als dieselbe durch Stephan
Lochner eben erst zur vollsten Ausdrucksfähig-
keit gelangt war und danach streben, die Vor-
gänge und Gestalten der heiligen Geschichte
in anderer Auffassung und neuer Form leben-
diger und überzeugender zu vergegenwärtigen.
Dieser Umschwung findet nun aber keines-
wegs seine Erklärung in langjährigen zielbe-
wufsten Bemühungen nach dieser Richtung,
oder in selbstständigem Naturstudium. Der neue
Realismus der Kölner Malerschule ist einzig
auf den überwältigenden Eindruck eines Vor-
bildes zurückzuführen, eines Beispiels, welches
faszinirend darthat, mit welchen Mitteln man
die ganze Welt der Erscheinung im Bilde zu
bannen vermöchte.
Neben den glänzenden Errungenschaften
der niederländischen Maler erblich mit einem
Schlage alles bisher Bewunderte und nicht
allein die aufstrebenden jugendlichen Künstler
wandten sich den fremden Pfaden zu, selbst
') Litter.itur: L. Scheibler »Anonyme Meisler
der altköln. Malerschule« (1880) S.44 ff. Janitschek
»Geschichte der deutschen Malerei« S. 23G.
die alternden Gehülfen Lochner's versuchten es
mit schwachen Kräften sich in die neue Kunst
einzuleben und einen Kompromifs zwischen dem
Gewohnten und dem Gewünschten herzustellen.
Hatte doch Meister Stephan selbst schon An-
regungen aus den Niederlanden her empfangen,
welche allerdings mit seinem ausgeprägten
Formenkanon verschmolzen, in seinem Idealis-
mus aufgingen.
Noch unreife oder schwächere Talente über-
liefsen sich zunächst völlig der Leitung überlege-
ner Kräfte und nur der eigenartigen Auffassung
der Kölner, ihrem ursprünglichen Empfinden und
einer naiven Art der Entlehnung und Verarbei-
tung fremder Elemente ist es zu danken, wenn
die kölnische Kunst auch nach dieser Krisis
noch eine selbstständige Bedeutung bewahrte.
Zur Erklärung des ganzen Umgestaltungs-
prozesses gewinnen aber gerade die unselbst-
ständigen Maler eine gewisse historische Be-
deutung. Neben den ersten Versuchen der
jungen Generation in der neuen Kunstweise
bieten vornehmlich die Epigonen Lochner's
eine Handhabe, den Beginn der neuen Rich-
tung zu datiren und den bewegenden Kräften
in derselben näher zu treten.
In dieser Zeitschrift IV (1891), Nr. 11 ge-
dachten wir bereits früher eines Werkes, in
welchem sich Lochner'sche Schultradition, aller-
dings noch befangen mit der Formensprache
des Rogier van der Weyden mischt. Der
Crucifixus des Werner Wilmerynck von Boreken
trägt die Jahreszahl 1458. Andere ungefähr
gleichzeitige Schularbeiten Stephan Lochner's
z. B. der Cyklus der Ursulalegende von 1456
a. a. O. VI (1893), Nr. 7 verrathen wenigstens
in Färbung und Landschaft deutlich nieder-
ländischen EinHufs. Dagegen bestrebt sich der
Meister des Georg- und Hippolytaltares2) es
dem Rogier van der Weyden in der Wiedergabe
2) Wallraf-Kichartz-Museum zu Köln Nr. 94—9G.
— A. von Kretschmar (»Jahrb. d. Kgl. Pr. K.«
IV (1883) S. 93 ff.) bewies aus dem Text des Jacobus
de Voragine, dafs die Tafeln nur Darstellungen der
Legende des hl. Georg enthalten. Die alten ächten
Benennungen auf den Nimben stehen jedoch mit dieser
Beweisführung in Widerspruch.
Der Meister der Glorifikation Maria.1)
Mit 2 Lichtdrucken (Tafel I u. II).
ausnahmsweise vollziehen
sich die Wandlungen des
Stils als das konsequente
Ergebnifs einer ruhig fort-
schreitenden naturgemafsen
Entwicklung; meist steht
auch an den Scheidelinien
derKunstzeitalter das Neue,
,; bisher Unerhörte unver-
^^^^^^^^^^^^ mittelt neben dem Alten»
Hergebrachten, und wir fragen uns angesichts
scharfer Kontraste nach einem Efeignifs, welches
einen so schroffen Wechsel der Geschmacks-
richtung hervorzubringen vermochte und dem
noch keimenden Leben der alten Formen jede
Nahrung entziehen konnte.
In der Geschichte der altkölnischen Maler-
schule begegnen wir dem merkwürdigen Phäno-
men, dafs die rheinischen Maler ihre hei-
mische Kunstsprache bald nach der Mitte des
XV. Jahrb. aufgeben, als dieselbe durch Stephan
Lochner eben erst zur vollsten Ausdrucksfähig-
keit gelangt war und danach streben, die Vor-
gänge und Gestalten der heiligen Geschichte
in anderer Auffassung und neuer Form leben-
diger und überzeugender zu vergegenwärtigen.
Dieser Umschwung findet nun aber keines-
wegs seine Erklärung in langjährigen zielbe-
wufsten Bemühungen nach dieser Richtung,
oder in selbstständigem Naturstudium. Der neue
Realismus der Kölner Malerschule ist einzig
auf den überwältigenden Eindruck eines Vor-
bildes zurückzuführen, eines Beispiels, welches
faszinirend darthat, mit welchen Mitteln man
die ganze Welt der Erscheinung im Bilde zu
bannen vermöchte.
Neben den glänzenden Errungenschaften
der niederländischen Maler erblich mit einem
Schlage alles bisher Bewunderte und nicht
allein die aufstrebenden jugendlichen Künstler
wandten sich den fremden Pfaden zu, selbst
') Litter.itur: L. Scheibler »Anonyme Meisler
der altköln. Malerschule« (1880) S.44 ff. Janitschek
»Geschichte der deutschen Malerei« S. 23G.
die alternden Gehülfen Lochner's versuchten es
mit schwachen Kräften sich in die neue Kunst
einzuleben und einen Kompromifs zwischen dem
Gewohnten und dem Gewünschten herzustellen.
Hatte doch Meister Stephan selbst schon An-
regungen aus den Niederlanden her empfangen,
welche allerdings mit seinem ausgeprägten
Formenkanon verschmolzen, in seinem Idealis-
mus aufgingen.
Noch unreife oder schwächere Talente über-
liefsen sich zunächst völlig der Leitung überlege-
ner Kräfte und nur der eigenartigen Auffassung
der Kölner, ihrem ursprünglichen Empfinden und
einer naiven Art der Entlehnung und Verarbei-
tung fremder Elemente ist es zu danken, wenn
die kölnische Kunst auch nach dieser Krisis
noch eine selbstständige Bedeutung bewahrte.
Zur Erklärung des ganzen Umgestaltungs-
prozesses gewinnen aber gerade die unselbst-
ständigen Maler eine gewisse historische Be-
deutung. Neben den ersten Versuchen der
jungen Generation in der neuen Kunstweise
bieten vornehmlich die Epigonen Lochner's
eine Handhabe, den Beginn der neuen Rich-
tung zu datiren und den bewegenden Kräften
in derselben näher zu treten.
In dieser Zeitschrift IV (1891), Nr. 11 ge-
dachten wir bereits früher eines Werkes, in
welchem sich Lochner'sche Schultradition, aller-
dings noch befangen mit der Formensprache
des Rogier van der Weyden mischt. Der
Crucifixus des Werner Wilmerynck von Boreken
trägt die Jahreszahl 1458. Andere ungefähr
gleichzeitige Schularbeiten Stephan Lochner's
z. B. der Cyklus der Ursulalegende von 1456
a. a. O. VI (1893), Nr. 7 verrathen wenigstens
in Färbung und Landschaft deutlich nieder-
ländischen EinHufs. Dagegen bestrebt sich der
Meister des Georg- und Hippolytaltares2) es
dem Rogier van der Weyden in der Wiedergabe
2) Wallraf-Kichartz-Museum zu Köln Nr. 94—9G.
— A. von Kretschmar (»Jahrb. d. Kgl. Pr. K.«
IV (1883) S. 93 ff.) bewies aus dem Text des Jacobus
de Voragine, dafs die Tafeln nur Darstellungen der
Legende des hl. Georg enthalten. Die alten ächten
Benennungen auf den Nimben stehen jedoch mit dieser
Beweisführung in Widerspruch.