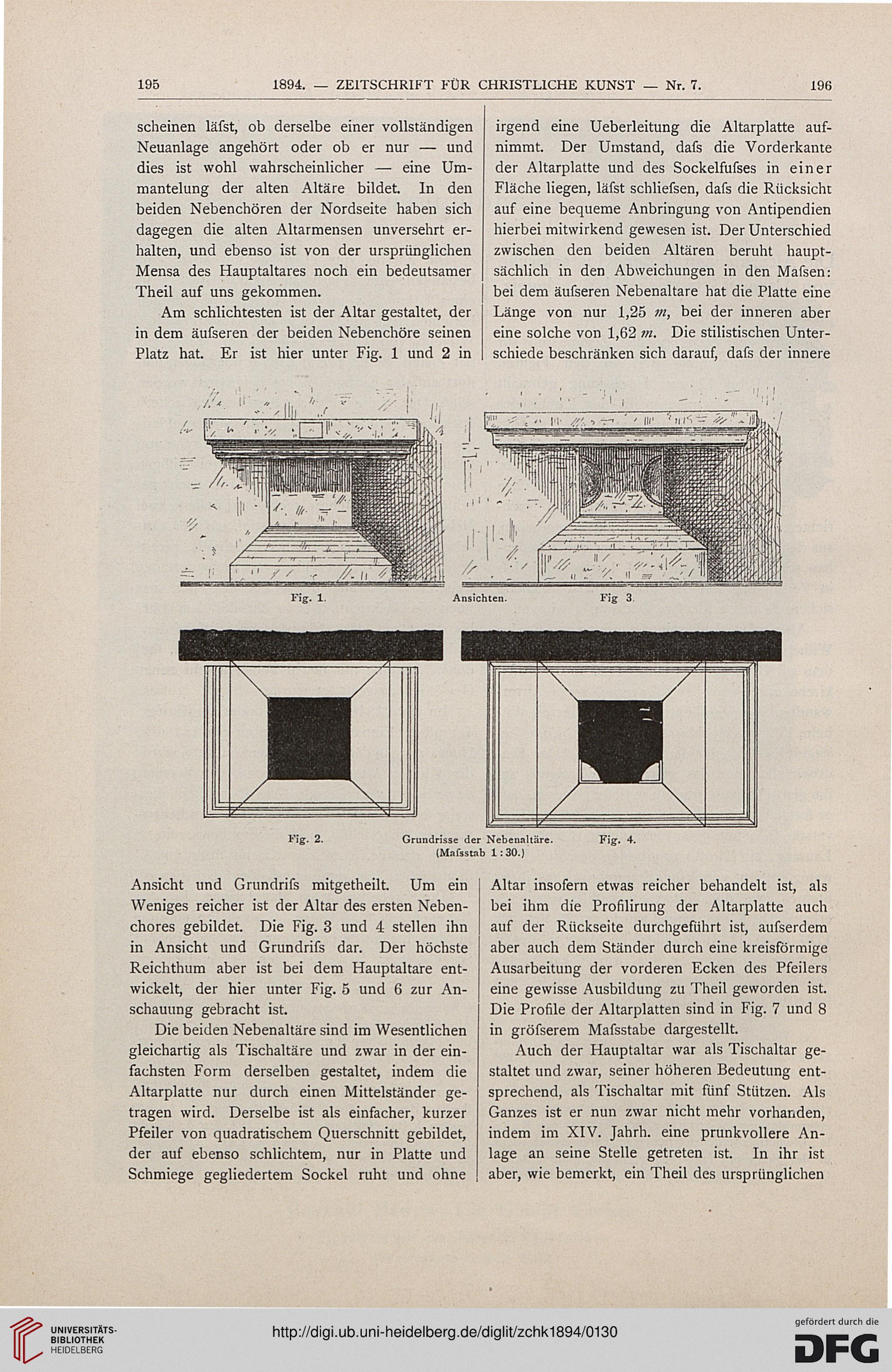195
1894. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.
196
scheinen läfst, ob derselbe einer vollständigen
Neuanlage angehört oder ob er nur — und
dies ist wohl wahrscheinlicher — eine Um-
mantelung der alten Altäre bildet. In den
beiden Nebenchören der Nordseite haben sich
dagegen die alten Altarmensen unversehrt er-
halten, und ebenso ist von der ursprünglichen
Mensa des Hauptaltares noch ein bedeutsamer
Theil auf uns gekommen.
Am schlichtesten ist der Altar gestaltet, der
in dem äufseren der beiden Nebenchöre seinen
Platz hat. Er ist hier unter Fig. 1 und 2 in
irgend eine Ueberleitung die Altarplatte auf-
nimmt. Der Umstand, dafs die Vorderkante
der Altarplatte und des Sockelfufses in einer
Fläche liegen, läfst schliefsen, dafs die Rücksicht
auf eine bequeme Anbringung von Antipendien
hierbei mitwirkend gewesen ist. Der Unterschied
zwischen den beiden Altären beruht haupt-
sächlich in den Abweichungen in den Mafsen:
bei dem äufseren Nebenaltare hat die Platte eine
Länge von nur 1,25 m, bei der inneren aber
eine solche von 1,62 m. Die stilistischen Unter-
schiede beschränken sich darauf, dafs der innere
Fig. i.
Ansichten.
Fig 3
Fig. 2.
Grundrisse der Nebenaltäre.
(Mafsstab 1: 30.)
Fig. 4.
Ansicht und Grundrifs mitgetheilt. Um ein
Weniges reicher ist der Altar des ersten Neben-
chores gebildet. Die Fig. 3 und 4 stellen ihn
in Ansicht und Grundrifs dar. Der höchste
Reichthum aber ist bei dem Hauptaltare ent-
wickelt, der hier unter Fig. 5 und 6 zur An-
schauung gebracht ist.
Die beiden Nebenaltäre sind im Wesentlichen
gleichartig als Tischaltäre und zwar in der ein-
fachsten Form derselben gestaltet, indem die
Altarplatte nur durch einen Mittelständer ge-
tragen wird. Derselbe ist als einfacher, kurzer
Pfeiler von quadratischem Querschnitt gebildet,
der auf ebenso schlichtem, nur in Platte und
Schmiege gegliedertem Sockel ruht und ohne
Altar insofern etwas reicher behandelt ist, als
bei ihm die Profilirung der Altarplatte auch
auf der Rückseite durchgeführt ist, aufserdem
aber auch dem Ständer durch eine kreisförmige
Ausarbeitung der vorderen Ecken des Pfeilers
eine gewisse Ausbildung zu Theil geworden ist.
Die Profile der Altarplatten sind in Fig. 7 und 8
in gröfserem Mafsstabe dargestellt.
Auch der Hauptaltar war als Tischaltar ge-
staltet und zwar, seiner höheren Bedeutung ent-
sprechend, als Tischaltar mit fünf Stützen. Als
Ganzes ist er nun zwar nicht mehr vorhanden,
indem im XIV. Jahrh. eine prunkvollere An-
lage an seine Stelle getreten ist. In ihr ist
aber, wie bemerkt, ein Theil des ursprünglichen
1894. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.
196
scheinen läfst, ob derselbe einer vollständigen
Neuanlage angehört oder ob er nur — und
dies ist wohl wahrscheinlicher — eine Um-
mantelung der alten Altäre bildet. In den
beiden Nebenchören der Nordseite haben sich
dagegen die alten Altarmensen unversehrt er-
halten, und ebenso ist von der ursprünglichen
Mensa des Hauptaltares noch ein bedeutsamer
Theil auf uns gekommen.
Am schlichtesten ist der Altar gestaltet, der
in dem äufseren der beiden Nebenchöre seinen
Platz hat. Er ist hier unter Fig. 1 und 2 in
irgend eine Ueberleitung die Altarplatte auf-
nimmt. Der Umstand, dafs die Vorderkante
der Altarplatte und des Sockelfufses in einer
Fläche liegen, läfst schliefsen, dafs die Rücksicht
auf eine bequeme Anbringung von Antipendien
hierbei mitwirkend gewesen ist. Der Unterschied
zwischen den beiden Altären beruht haupt-
sächlich in den Abweichungen in den Mafsen:
bei dem äufseren Nebenaltare hat die Platte eine
Länge von nur 1,25 m, bei der inneren aber
eine solche von 1,62 m. Die stilistischen Unter-
schiede beschränken sich darauf, dafs der innere
Fig. i.
Ansichten.
Fig 3
Fig. 2.
Grundrisse der Nebenaltäre.
(Mafsstab 1: 30.)
Fig. 4.
Ansicht und Grundrifs mitgetheilt. Um ein
Weniges reicher ist der Altar des ersten Neben-
chores gebildet. Die Fig. 3 und 4 stellen ihn
in Ansicht und Grundrifs dar. Der höchste
Reichthum aber ist bei dem Hauptaltare ent-
wickelt, der hier unter Fig. 5 und 6 zur An-
schauung gebracht ist.
Die beiden Nebenaltäre sind im Wesentlichen
gleichartig als Tischaltäre und zwar in der ein-
fachsten Form derselben gestaltet, indem die
Altarplatte nur durch einen Mittelständer ge-
tragen wird. Derselbe ist als einfacher, kurzer
Pfeiler von quadratischem Querschnitt gebildet,
der auf ebenso schlichtem, nur in Platte und
Schmiege gegliedertem Sockel ruht und ohne
Altar insofern etwas reicher behandelt ist, als
bei ihm die Profilirung der Altarplatte auch
auf der Rückseite durchgeführt ist, aufserdem
aber auch dem Ständer durch eine kreisförmige
Ausarbeitung der vorderen Ecken des Pfeilers
eine gewisse Ausbildung zu Theil geworden ist.
Die Profile der Altarplatten sind in Fig. 7 und 8
in gröfserem Mafsstabe dargestellt.
Auch der Hauptaltar war als Tischaltar ge-
staltet und zwar, seiner höheren Bedeutung ent-
sprechend, als Tischaltar mit fünf Stützen. Als
Ganzes ist er nun zwar nicht mehr vorhanden,
indem im XIV. Jahrh. eine prunkvollere An-
lage an seine Stelle getreten ist. In ihr ist
aber, wie bemerkt, ein Theil des ursprünglichen