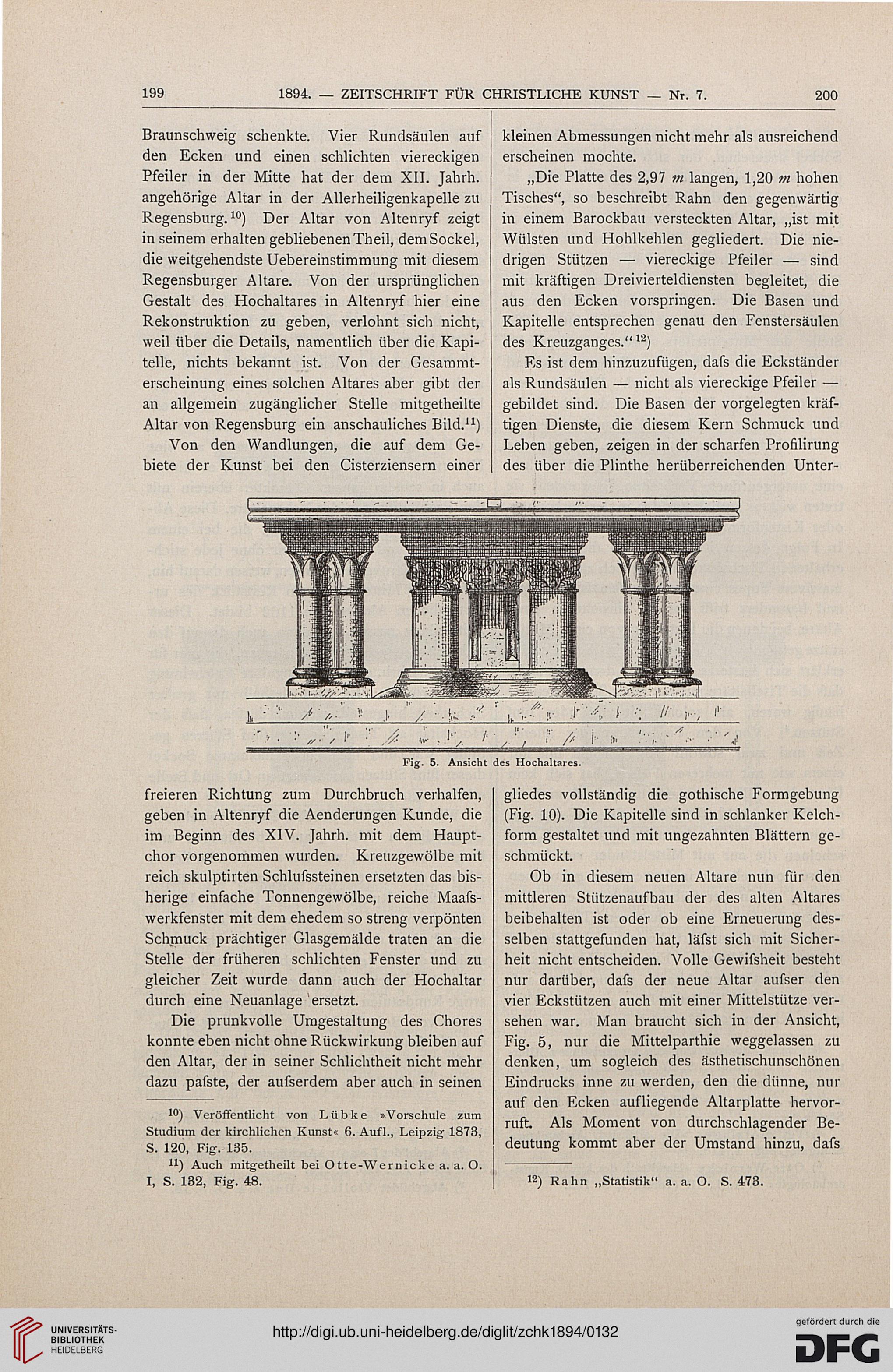199
1894.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.
200
Braunschweig schenkte. Vier Rundsäulen auf
den Ecken und einen schlichten viereckigen
Pfeiler in der Mitte hat der dem XII. Jahrh.
angehörige Altar in der Allerheiligenkapelle zu
Regensburg.10) Der Altar von Altenryf zeigt
in seinem erhalten gebliebenen Theil, dem Sockel,
die weitgehendste Uebereinstimmung mit diesem
Regensburger Altare. Von der ursprünglichen
Gestalt des Hochaltares in Altenryf hier eine
Rekonstruktion zu geben, verlohnt sich nicht,
weil über die Details, namentlich über die Kapi-
telle, nichts bekannt ist. Von der Gesammt-
erscheinung eines solchen Altares aber gibt der
an allgemein zugänglicher Stelle mitgetheilte
Altar von Regensburg ein anschauliches Bild.11)
Von den Wandlungen, die auf dem Ge-
biete der Kunst bei den Cisterziensern einer
kleinen Abmessungen nicht mehr als ausreichend
erscheinen mochte.
„Die Platte des 2,97 m langen, 1,20 m hohen
Tisches", so beschreibt Rahn den gegenwärtig
in einem Barockbau versteckten Altar, „ist mit
Wülsten und Hohlkehlen gegliedert. Die nie-
drigen Stützen — viereckige Pfeiler — sind
mit kräftigen Dreivierteldiensten begleitet, die
aus den Ecken vorspringen. Die Basen und
Kapitelle entsprechen genau den Fenstersäulen
des Kreuzganges."12)
Es ist dem hinzuzufügen, dafs die Eckständer
als Rundsäulen — nicht als viereckige Pfeiler —
gebildet sind. Die Basen der vorgelegten kräf-
tigen Dienste, die diesem Kern Schmuck und
Leben geben, zeigen in der scharfen Profilirung
des über die Plinthe herüberreichenden Unter-
\K.f 1^ ■',//■■'■■< ■
zs/^'iys : ~- :
-^$595«
ir^vj'S1
wi-i. itw.'i-:;. :.,il
\ ""' '
' A ■/,.' *
.]■ " / •
f,v
y
•'„• i
■•; //■ t-,
I1'
■■„"', 1'
■ ,£ w ■
!■'•
>■ /, :
/<
i- >
'■■■ . ^
.I!
Fig. 5. Ansicht des Hochaltares.
freieren Richtung zum Durchbruch verhalfen,
geben in Altenryf die Aenderungen Kunde, die
im Beginn des XIV. Jahrh. mit dem Haupt-
chor vorgenommen wurden. Kreuzgewölbe mit
reich skulptirten Schlufssteinen ersetzten das bis-
herige einfache Tonnengewölbe, reiche Maafs-
werkfenster mit dem ehedem so streng verpönten
Schmuck prächtiger Glasgemälde traten an die
Stelle der früheren schlichten Fenster und zu
gleicher Zeit wurde dann auch der Hochaltar
durch eine Neuanlage ersetzt.
Die prunkvolle Umgestaltung des Chores
konnte eben nicht ohne Rückwirkung bleiben auf
den Altar, der in seiner Schlichtheit nicht mehr
dazu pafste, der aufserdem aber auch in seinen
10) Veröffentlicht von Lübke »Vorschule zum
Studium der kirchlichen Kunst« 6. Aufl., Leipzig 1873,
S. 120, Fig. 135.
1J) Auch mitgetheilt bei Otte-Wernicke a. a. O.
I, S. 132, Fig. 48.
gliedes vollständig die gothische Formgebung
(Fig. 10). Die Kapitelle sind in schlanker Kelch-
form gestaltet und mit ungezahnten Blättern ge-
schmückt.
Ob in diesem neuen Altare nun für den
mittleren Stützenaufbau der des alten Altares
beibehalten ist oder ob eine Erneuerung des-
selben stattgefunden hat, läfst sich mit Sicher-
heit nicht entscheiden. Volle Gewifsheit besteht
nur darüber, dafs der neue Altar aufser den
vier Eckstützen auch mit einer Mittelstütze ver-
sehen war. Man braucht sich in der Ansicht,
Fig. 5, nur die Mittelparthie weggelassen zu
denken, um sogleich des ästhetischunschönen
Eindrucks inne zu werden, den die dünne, nur
auf den Ecken aufliegende Altarplatte hervor-
ruft. Als Moment von durchschlagender Be-
deutung kommt aber der Umstand hinzu, dafs
2) Rahn „Statistik" a. a. O. S. 473.
1894.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.
200
Braunschweig schenkte. Vier Rundsäulen auf
den Ecken und einen schlichten viereckigen
Pfeiler in der Mitte hat der dem XII. Jahrh.
angehörige Altar in der Allerheiligenkapelle zu
Regensburg.10) Der Altar von Altenryf zeigt
in seinem erhalten gebliebenen Theil, dem Sockel,
die weitgehendste Uebereinstimmung mit diesem
Regensburger Altare. Von der ursprünglichen
Gestalt des Hochaltares in Altenryf hier eine
Rekonstruktion zu geben, verlohnt sich nicht,
weil über die Details, namentlich über die Kapi-
telle, nichts bekannt ist. Von der Gesammt-
erscheinung eines solchen Altares aber gibt der
an allgemein zugänglicher Stelle mitgetheilte
Altar von Regensburg ein anschauliches Bild.11)
Von den Wandlungen, die auf dem Ge-
biete der Kunst bei den Cisterziensern einer
kleinen Abmessungen nicht mehr als ausreichend
erscheinen mochte.
„Die Platte des 2,97 m langen, 1,20 m hohen
Tisches", so beschreibt Rahn den gegenwärtig
in einem Barockbau versteckten Altar, „ist mit
Wülsten und Hohlkehlen gegliedert. Die nie-
drigen Stützen — viereckige Pfeiler — sind
mit kräftigen Dreivierteldiensten begleitet, die
aus den Ecken vorspringen. Die Basen und
Kapitelle entsprechen genau den Fenstersäulen
des Kreuzganges."12)
Es ist dem hinzuzufügen, dafs die Eckständer
als Rundsäulen — nicht als viereckige Pfeiler —
gebildet sind. Die Basen der vorgelegten kräf-
tigen Dienste, die diesem Kern Schmuck und
Leben geben, zeigen in der scharfen Profilirung
des über die Plinthe herüberreichenden Unter-
\K.f 1^ ■',//■■'■■< ■
zs/^'iys : ~- :
-^$595«
ir^vj'S1
wi-i. itw.'i-:;. :.,il
\ ""' '
' A ■/,.' *
.]■ " / •
f,v
y
•'„• i
■•; //■ t-,
I1'
■■„"', 1'
■ ,£ w ■
!■'•
>■ /, :
/<
i- >
'■■■ . ^
.I!
Fig. 5. Ansicht des Hochaltares.
freieren Richtung zum Durchbruch verhalfen,
geben in Altenryf die Aenderungen Kunde, die
im Beginn des XIV. Jahrh. mit dem Haupt-
chor vorgenommen wurden. Kreuzgewölbe mit
reich skulptirten Schlufssteinen ersetzten das bis-
herige einfache Tonnengewölbe, reiche Maafs-
werkfenster mit dem ehedem so streng verpönten
Schmuck prächtiger Glasgemälde traten an die
Stelle der früheren schlichten Fenster und zu
gleicher Zeit wurde dann auch der Hochaltar
durch eine Neuanlage ersetzt.
Die prunkvolle Umgestaltung des Chores
konnte eben nicht ohne Rückwirkung bleiben auf
den Altar, der in seiner Schlichtheit nicht mehr
dazu pafste, der aufserdem aber auch in seinen
10) Veröffentlicht von Lübke »Vorschule zum
Studium der kirchlichen Kunst« 6. Aufl., Leipzig 1873,
S. 120, Fig. 135.
1J) Auch mitgetheilt bei Otte-Wernicke a. a. O.
I, S. 132, Fig. 48.
gliedes vollständig die gothische Formgebung
(Fig. 10). Die Kapitelle sind in schlanker Kelch-
form gestaltet und mit ungezahnten Blättern ge-
schmückt.
Ob in diesem neuen Altare nun für den
mittleren Stützenaufbau der des alten Altares
beibehalten ist oder ob eine Erneuerung des-
selben stattgefunden hat, läfst sich mit Sicher-
heit nicht entscheiden. Volle Gewifsheit besteht
nur darüber, dafs der neue Altar aufser den
vier Eckstützen auch mit einer Mittelstütze ver-
sehen war. Man braucht sich in der Ansicht,
Fig. 5, nur die Mittelparthie weggelassen zu
denken, um sogleich des ästhetischunschönen
Eindrucks inne zu werden, den die dünne, nur
auf den Ecken aufliegende Altarplatte hervor-
ruft. Als Moment von durchschlagender Be-
deutung kommt aber der Umstand hinzu, dafs
2) Rahn „Statistik" a. a. O. S. 473.