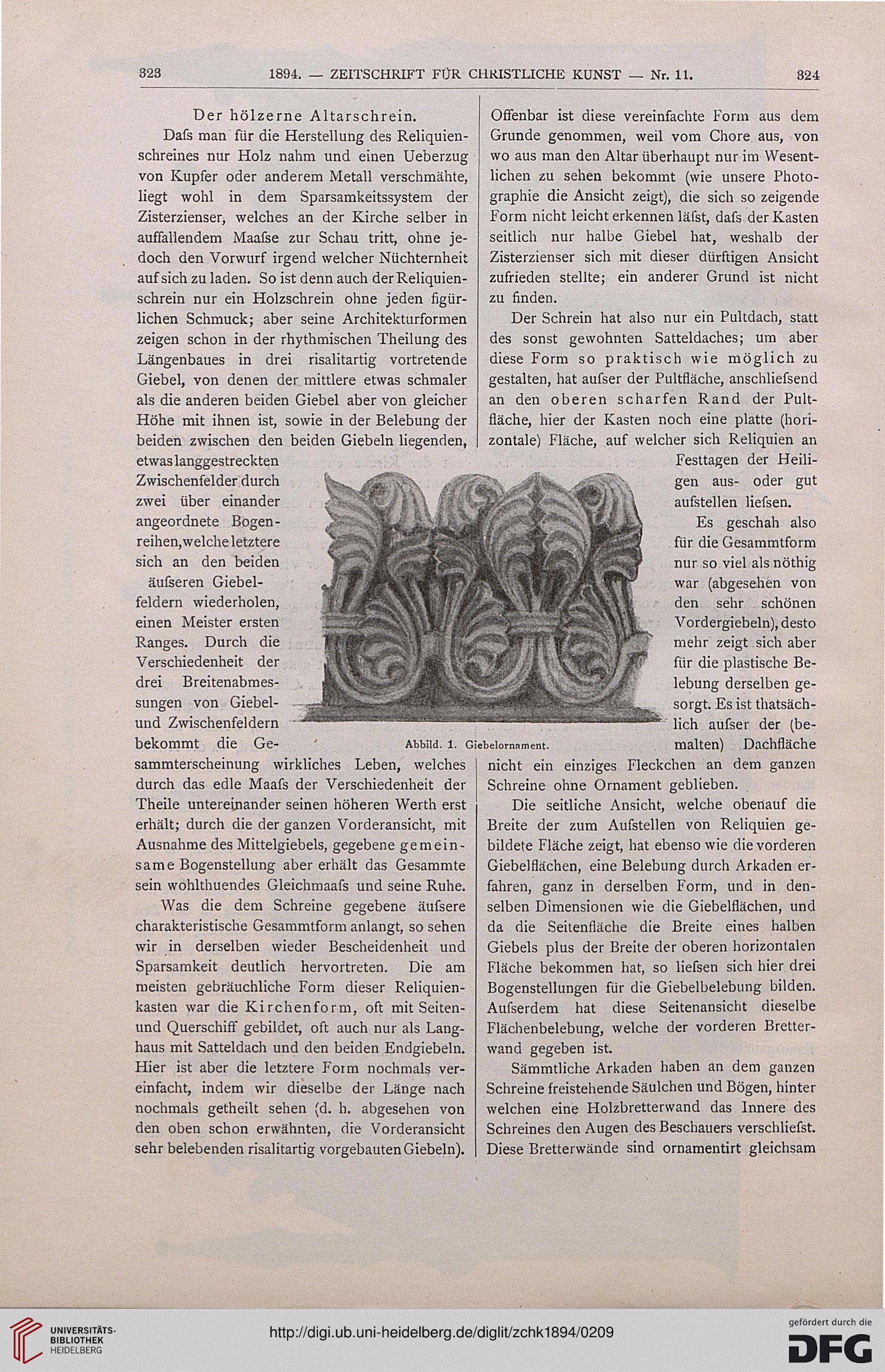323
1894. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 11.
324
Der hölzerne Altarschrein.
Dafs man für die Herstellung des Reliquien-
schreines nur Holz nahm und einen Ueberzug
von Kupfer oder anderem Metall verschmähte,
liegt wohl in dem Sparsamkeitssystem der
Zisterzienser, welches an der Kirche selber in
auffallendem Maafse zur Schau tritt, ohne je-
doch den Vorwurf irgend welcher Nüchternheit
auf sich zu laden. So ist denn auch der Reliquien-
schrein nur ein Holzschrein ohne jeden figür-
lichen Schmuck; aber seine Architekturformen
zeigen schon in der rhythmischen Theilung des
Längenbaues in drei risalitartig vortretende
Giebel, von denen der mittlere etwas schmaler
als die anderen beiden Giebel aber von gleicher
Höhe mit ihnen ist, sowie in der Belebung der
beiden zwischen den beiden Giebeln liegenden,
etwas langgestreckten
Zwischenfelder durch
zwei über einander
angeordnete Bogen -
reihen,welche letztere
sich an den beiden
äufseren Giebel-
feldern wiederholen,
einen Meister ersten
Ranges. Durch die
Verschiedenheit der
drei Breitenabmes-
sungen von Giebel-
und Zwischenfeldern
bekommt die Ge-
Abbild. 1. Giebelornament.
Offenbar ist diese vereinfachte Form aus dem
Grunde genommen, weil vom Chore aus, von
wo aus man den Altar überhaupt nur im Wesent-
lichen zu sehen bekommt (wie unsere Photo-
graphie die Ansicht zeigt), die sich so zeigende
Form nicht leicht erkennen läfst, dafs der Kasten
seitlich nur halbe Giebel hat, weshalb der
Zisterzienser sich mit dieser dürftigen Ansicht
zufrieden stellte; ein anderer Grund ist nicht
zu finden.
Der Schrein hat also nur ein Pultdach, statt
des sonst gewohnten Satteldaches; um aber
diese Form so praktisch wie möglich zu
gestalten, hat aufser der Pultfläche, anschliefsend
an den oberen scharfen Rand der Pult-
fläche, hier der Kasten noch eine platte (hori-
zontale) Fläche, auf welcher sich Reliquien an
Festtagen der Heili-
gen aus- oder gut
aufstellen liefsen.
Es geschah also
für die Gesammtform
nur so viel als nöthig
war (abgesehen von
den sehr schönen
Vordergiebeln), desto
mehr zeigt sich aber
für die plastische Be-
lebung derselben ge-
sorgt. Es ist thatsäch-
lich aufser der (be-
malten) Dachfläche
sammterscheinung wirkliches Leben, welches
durch das edle Maafs der Verschiedenheit der
Theile untereinander seinen höheren Werth erst
erhält; durch die der ganzen Vorderansicht, mit
Ausnahme des Mittelgiebels, gegebene gemein-
same Bogenstellung aber erhält das Gesammte
sein wohlthuendes Gleichmaafs und seine Ruhe.
Was die dem Schreine gegebene äufsere
charakteristische Gesammtform anlangt, so sehen
wir in derselben wieder Bescheidenheit und
Sparsamkeit deutlich hervortreten. Die am
meisten gebräuchliche Form dieser Reliquien-
kasten war die Kirchenform, oft mit Seiten-
und Querschiff gebildet, oft auch nur als Lang-
haus mit Satteldach und den beiden Endgiebeln.
Hier ist aber die letztere Form nochmals ver-
einfacht, indem wir dieselbe der Länge nach
nochmals getheilt sehen (d. b. abgesehen von
den oben schon erwähnten, die Vorderansicht
sehr belebenden risalitartig vorgebauten Giebeln).
nicht ein einziges Fleckchen an dem ganzen
Schreine ohne Ornament geblieben.
Die seitliche Ansicht, welche obenauf die
Breite der zum Aufstellen von Reliquien ge-
bildete Fläche zeigt, hat ebenso wie die vorderen
Giebelflächen, eine Belebung durch Arkaden er-
fahren, ganz in derselben Form, und in den-
selben Dimensionen wie die Giebelflächen, und
da die Seitenfläche die Breite eines halben
Giebels plus der Breite der oberen horizontalen
Fläche bekommen hat, so liefsen sich hier drei
Bogenstellungen für die Giebelbelebung bilden.
Aufserdem hat diese Seitenansicht dieselbe
Flächenbelebung, welche der vorderen Bretter-
wand gegeben ist.
Sämmtliche Arkaden haben an dem gauzen
Schreine freistehende Säulchen und Bögen, hinter
welchen eine Holzbretterwand das Innere des
Schreines den Augen des Beschauers verschliefst.
Diese Bretterwände sind ornamentirt gleichsam
1894. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 11.
324
Der hölzerne Altarschrein.
Dafs man für die Herstellung des Reliquien-
schreines nur Holz nahm und einen Ueberzug
von Kupfer oder anderem Metall verschmähte,
liegt wohl in dem Sparsamkeitssystem der
Zisterzienser, welches an der Kirche selber in
auffallendem Maafse zur Schau tritt, ohne je-
doch den Vorwurf irgend welcher Nüchternheit
auf sich zu laden. So ist denn auch der Reliquien-
schrein nur ein Holzschrein ohne jeden figür-
lichen Schmuck; aber seine Architekturformen
zeigen schon in der rhythmischen Theilung des
Längenbaues in drei risalitartig vortretende
Giebel, von denen der mittlere etwas schmaler
als die anderen beiden Giebel aber von gleicher
Höhe mit ihnen ist, sowie in der Belebung der
beiden zwischen den beiden Giebeln liegenden,
etwas langgestreckten
Zwischenfelder durch
zwei über einander
angeordnete Bogen -
reihen,welche letztere
sich an den beiden
äufseren Giebel-
feldern wiederholen,
einen Meister ersten
Ranges. Durch die
Verschiedenheit der
drei Breitenabmes-
sungen von Giebel-
und Zwischenfeldern
bekommt die Ge-
Abbild. 1. Giebelornament.
Offenbar ist diese vereinfachte Form aus dem
Grunde genommen, weil vom Chore aus, von
wo aus man den Altar überhaupt nur im Wesent-
lichen zu sehen bekommt (wie unsere Photo-
graphie die Ansicht zeigt), die sich so zeigende
Form nicht leicht erkennen läfst, dafs der Kasten
seitlich nur halbe Giebel hat, weshalb der
Zisterzienser sich mit dieser dürftigen Ansicht
zufrieden stellte; ein anderer Grund ist nicht
zu finden.
Der Schrein hat also nur ein Pultdach, statt
des sonst gewohnten Satteldaches; um aber
diese Form so praktisch wie möglich zu
gestalten, hat aufser der Pultfläche, anschliefsend
an den oberen scharfen Rand der Pult-
fläche, hier der Kasten noch eine platte (hori-
zontale) Fläche, auf welcher sich Reliquien an
Festtagen der Heili-
gen aus- oder gut
aufstellen liefsen.
Es geschah also
für die Gesammtform
nur so viel als nöthig
war (abgesehen von
den sehr schönen
Vordergiebeln), desto
mehr zeigt sich aber
für die plastische Be-
lebung derselben ge-
sorgt. Es ist thatsäch-
lich aufser der (be-
malten) Dachfläche
sammterscheinung wirkliches Leben, welches
durch das edle Maafs der Verschiedenheit der
Theile untereinander seinen höheren Werth erst
erhält; durch die der ganzen Vorderansicht, mit
Ausnahme des Mittelgiebels, gegebene gemein-
same Bogenstellung aber erhält das Gesammte
sein wohlthuendes Gleichmaafs und seine Ruhe.
Was die dem Schreine gegebene äufsere
charakteristische Gesammtform anlangt, so sehen
wir in derselben wieder Bescheidenheit und
Sparsamkeit deutlich hervortreten. Die am
meisten gebräuchliche Form dieser Reliquien-
kasten war die Kirchenform, oft mit Seiten-
und Querschiff gebildet, oft auch nur als Lang-
haus mit Satteldach und den beiden Endgiebeln.
Hier ist aber die letztere Form nochmals ver-
einfacht, indem wir dieselbe der Länge nach
nochmals getheilt sehen (d. b. abgesehen von
den oben schon erwähnten, die Vorderansicht
sehr belebenden risalitartig vorgebauten Giebeln).
nicht ein einziges Fleckchen an dem ganzen
Schreine ohne Ornament geblieben.
Die seitliche Ansicht, welche obenauf die
Breite der zum Aufstellen von Reliquien ge-
bildete Fläche zeigt, hat ebenso wie die vorderen
Giebelflächen, eine Belebung durch Arkaden er-
fahren, ganz in derselben Form, und in den-
selben Dimensionen wie die Giebelflächen, und
da die Seitenfläche die Breite eines halben
Giebels plus der Breite der oberen horizontalen
Fläche bekommen hat, so liefsen sich hier drei
Bogenstellungen für die Giebelbelebung bilden.
Aufserdem hat diese Seitenansicht dieselbe
Flächenbelebung, welche der vorderen Bretter-
wand gegeben ist.
Sämmtliche Arkaden haben an dem gauzen
Schreine freistehende Säulchen und Bögen, hinter
welchen eine Holzbretterwand das Innere des
Schreines den Augen des Beschauers verschliefst.
Diese Bretterwände sind ornamentirt gleichsam